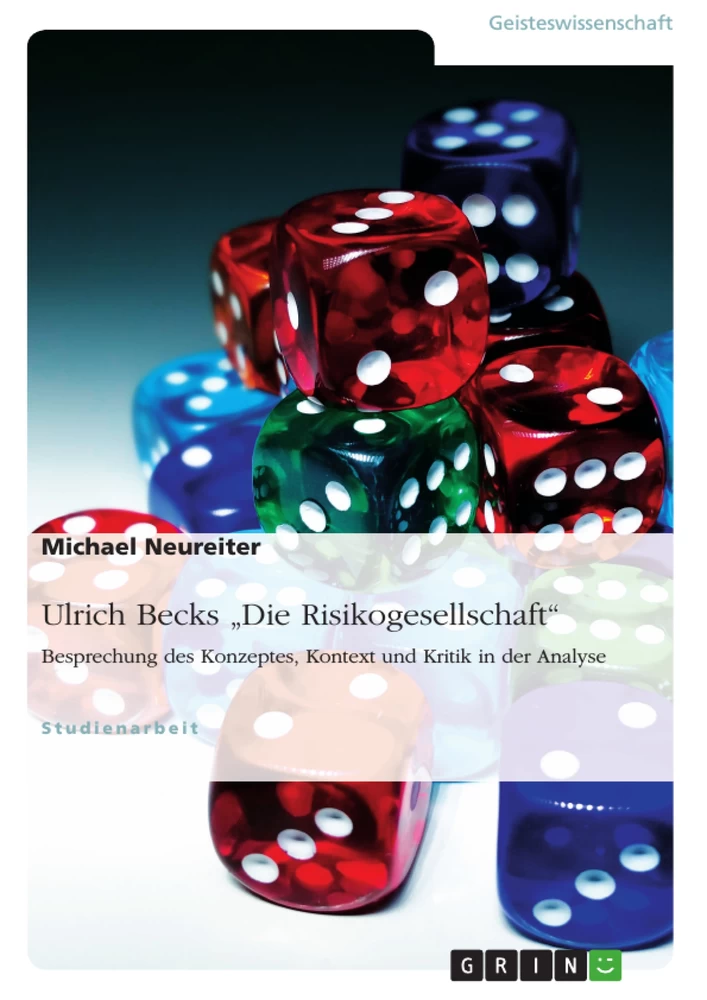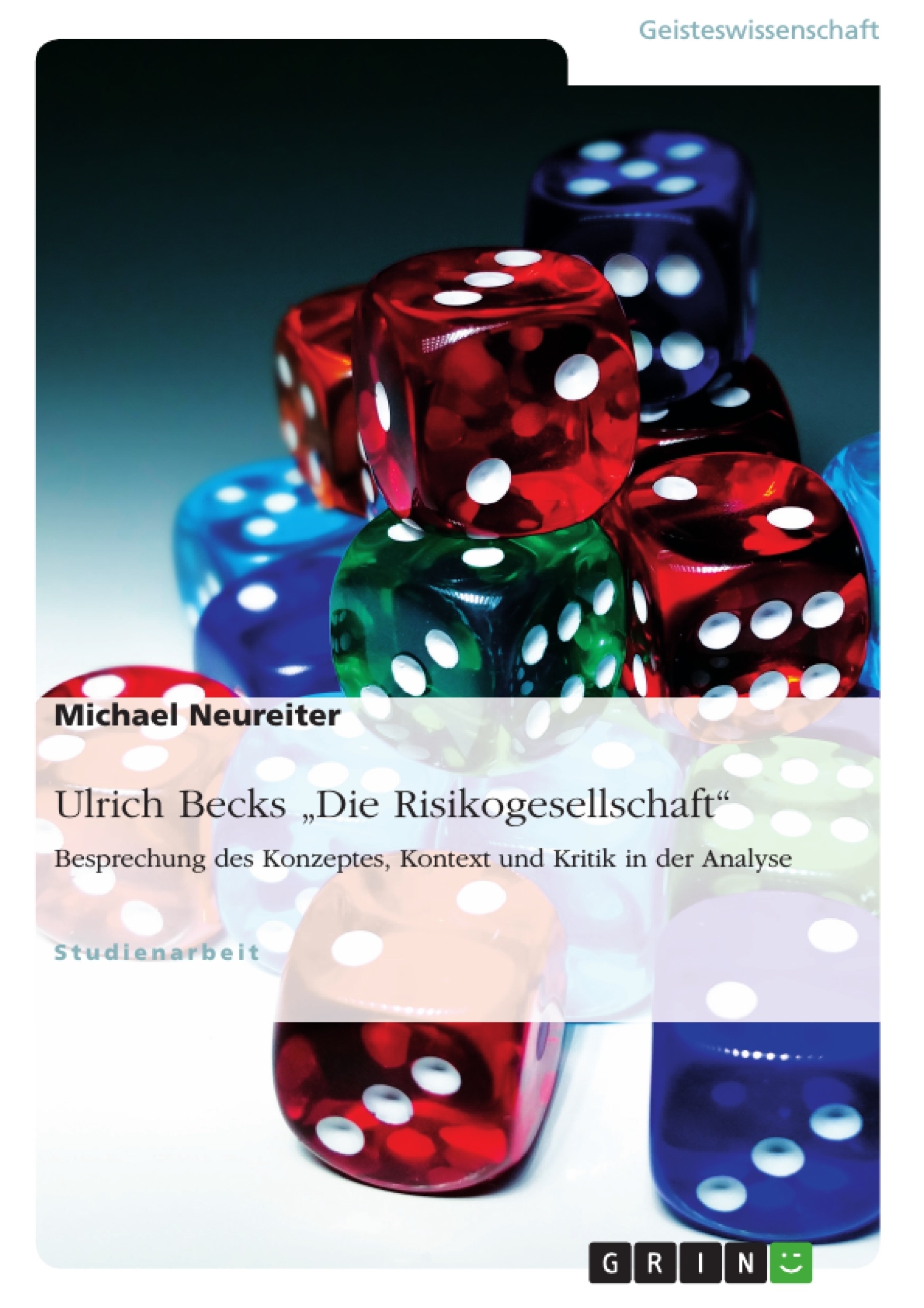Eine bekannte deutsche Sozialorganisation wirbt derzeit mit dem Slogan „In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“. Für den Soziologen stellt sich jedoch eher die Frage „In was für einer Gesellschaft leben wir?“. Denn erst wenn wir sicher zu sagen vermögen, wie unsere moderne Gesellschaft überhaupt beschaffen ist, macht es aus soziologischer Sicht Sinn, auf der Grundlage des ermittelten Ist-Zustandes Vorschläge zu dessen Verbesserung zu formulieren. Unglücklicherweise handelt es sich bei der menschlichen Gesellschaft um einen äußerst komplexen Untersuchungsgegenstand, weshalb bis zum heutigen Tage (leider) keine allgemeingültige Theorie zu deren Erklärung entwickelt werden konnte. Verschiedene Autoren haben unterschiedliche Aspekte der Gesellschaft als besonders prägend und erwähnenswert erachtet, weshalb heute eine Vielzahl sogenannte „Gesellschaftstheorien“ existiert, die allesamt auf ihre Weise versuchen, die zentralen Elemente, Probleme und Wirkungsweisen des Phänomens Gesellschaft herauszuarbeiten. Dabei wird der Aspekt von Gesellschaft, der als zentral angesehen wird, in vielen Fällen auch gleichzeitig zum Namensgeber der Theorie, weshalb solche Erklärungsansätze Titel wie „Erlebnisgesellschaft“, „Kommunikationsgesellschaft“, „Weltgesellschaft“, „Informationsgesellschaft“ oder „Multioptionsgesellschaft“ tragen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Einen vielbeachteten Erklärungsansatz der modernen Gesellschaft stellt das von dem deutschen Soziologen Ulrich Beck entworfene Konzept der sogenannte „Risikogesellschaft“ dar, das er 1986 in seinem gleichnamigen Buch erstmals vorgestellt hat. Ziel dieser Arbeit ist es, die zentralen Merkmale der Risikogesellschaft herauszuarbeiten und prägnant darzustellen, um dem Leser auf diese Weise einen Überblick über Becks relativ komplexe Gegenwartsdiagnose zu verschaffen. Darüber hinaus soll erläutert werden, in welchem Kontext die Risikogesellschaft im Hinblick auf Becks Gesamtwerk zu verstehen ist. Der dritte und letzte Punkt dient zur Darstellung eventueller Schwächen und Probleme des Konzepts der Risikogesellschaft. Dazu soll exemplarisch auf die Kritik der beiden deutschen Soziologen Rainer Geißler und Richard Münch eingegangen werden. In einem abschließenden Fazit sollen dann noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit komprimiert dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Konzept der Risikogesellschaft
- 1.1 Zu den Risiken moderner Gesellschaften
- 1.2 Interpretation, Definition und Anerkennung von Risiken
- 1.3 Zur Verteilung von Modernisierungsrisiken - Soziale Gefährdungslagen
- 1.4 Individualisierung in der Risikogesellschaft
- 1.5 20 Jahre später: von der Risiko- zur Weltrisikogesellschaft
- 2. Kontext: von der Ersten zur Zweiten Moderne
- 3. Zur Kritik an Ulrich Becks Theorie
- 3.1 Rainer Geißlers Vorwurf der Verschleierung sozialer Ungleichheitsverhältnisse
- 3.2 Kritische Würdigung bei Richard Münch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ulrich Becks Konzept der Risikogesellschaft. Ziel ist es, die zentralen Merkmale dieser Gegenwartsdiagnose zu erläutern und in den Kontext von Becks Gesamtwerk einzuordnen. Schließlich werden kritische Stimmen zu Becks Theorie, insbesondere von Rainer Geißler und Richard Münch, präsentiert.
- Das Konzept der Risikogesellschaft und ihre zentralen Merkmale
- Der Kontext der Risikogesellschaft im Hinblick auf Becks Gesamtwerk
- Kritik an Becks Theorie bezüglich sozialer Ungleichheit
- Vergleich von Risiken früherer und moderner Gesellschaften
- Die Rolle der Wissenschaft bei der Interpretation von Risiken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Frage nach dem Wesen der modernen Gesellschaft. Sie argumentiert für die Notwendigkeit einer soliden Grundlage zur Analyse vor der Formulierung von Verbesserungsvorschlägen. Sie beschreibt die Vielzahl existierender Gesellschaftstheorien und positioniert Becks Risikogesellschaft als einen bedeutenden Erklärungsansatz. Die Arbeit skizziert die Zielsetzung: die Darstellung der zentralen Merkmale der Risikogesellschaft, deren Einordnung in Becks Werk und die Auseinandersetzung mit Kritikpunkten an dem Konzept.
1. Das Konzept der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet Becks Konzept der Risikogesellschaft, wobei das Risiko als zentrales Merkmal der modernen Gesellschaft identifiziert wird. Es wird definiert als die Antizipation zukünftiger Katastrophen. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Risiken früherer und moderner Gesellschaften. Während frühere Risiken oft direkt erfahrbar waren (z.B. Armut), sind moderne Risiken oft latente, global wirkende Modernisierungsrisiken, die aus dem technischen Fortschritt resultieren (z.B. Umweltverschmutzung, atomare Bedrohung). Die Interpretation und Anerkennung von Risiken wird ebenfalls diskutiert, wobei die Rolle der Wissenschaft bei der Definition von Gefahren hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Modernisierungsrisiken, soziale Ungleichheit, Gegenwartsdiagnose, Rainer Geißler, Richard Münch, Risikointerpretation, Zweite Moderne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ulrich Becks Risikogesellschaft"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Ulrich Becks Konzept der Risikogesellschaft. Sie erläutert die zentralen Merkmale dieser Theorie, ordnet sie in Becks Gesamtwerk ein und untersucht kritische Positionen, insbesondere von Rainer Geißler und Richard Münch. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Kapitelzusammenfassung, eine Übersicht über die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte sowie ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept der Risikogesellschaft, den Vergleich von Risiken in traditionellen und modernen Gesellschaften, die Rolle der Wissenschaft bei der Risikointerpretation, die Kritik an Becks Theorie im Hinblick auf die soziale Ungleichheit und den Kontext der Risikogesellschaft innerhalb von Becks Gesamtwerk. Es wird auch auf die "zweite Moderne" Bezug genommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Konzept der Risikogesellschaft (inkl. Unterkapiteln zu Risiken moderner Gesellschaften, Risikointerpretation, Verteilung von Risiken und Individualisierung), ein Kapitel zum Kontext "Erste und Zweite Moderne", ein Kapitel zur Kritik an Becks Theorie (mit Fokus auf Geißler und Münch) und abschließend ein Fazit. Die Arbeit enthält zudem ein ausführliches Inhaltsverzeichnis.
Welche Kritikpunkte an Becks Theorie werden behandelt?
Die Arbeit thematisiert die Kritik von Rainer Geißler, der Beck vorwirft, soziale Ungleichheitsverhältnisse zu verschleiern, und die kritische Würdigung von Richard Münch. Diese kritischen Perspektiven werden im Detail präsentiert und analysiert.
Was sind die zentralen Merkmale von Becks Risikogesellschaft?
Zentrale Merkmale sind die Antizipation zukünftiger Katastrophen als zentrales Risiko, der Vergleich von direkt erfahrbaren Risiken früherer Gesellschaften (z.B. Armut) mit latenten, globalen Modernisierungsrisiken (z.B. Umweltverschmutzung), und die Rolle der Wissenschaft bei der Definition und Interpretation von Risiken.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Modernisierungsrisiken, soziale Ungleichheit, Gegenwartsdiagnose, Rainer Geißler, Richard Münch, Risikointerpretation und Zweite Moderne.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Becks Konzept der Risikogesellschaft umfassend zu erläutern und kritisch zu untersuchen. Es soll ein tieferes Verständnis der zentralen Merkmale dieser Theorie vermittelt und ihre Einordnung in Becks Gesamtwerk sowie die Auseinandersetzung mit relevanten Kritikpunkten ermöglicht werden.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich akademisch mit dem Konzept der Risikogesellschaft auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich für Studierende der Soziologie, Politikwissenschaft und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Michael Neureiter (Author), 2009, Ulrich Becks "Die Risikogesellschaft". Besprechung des Konzeptes, Kontext und Kritik in der Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/136787