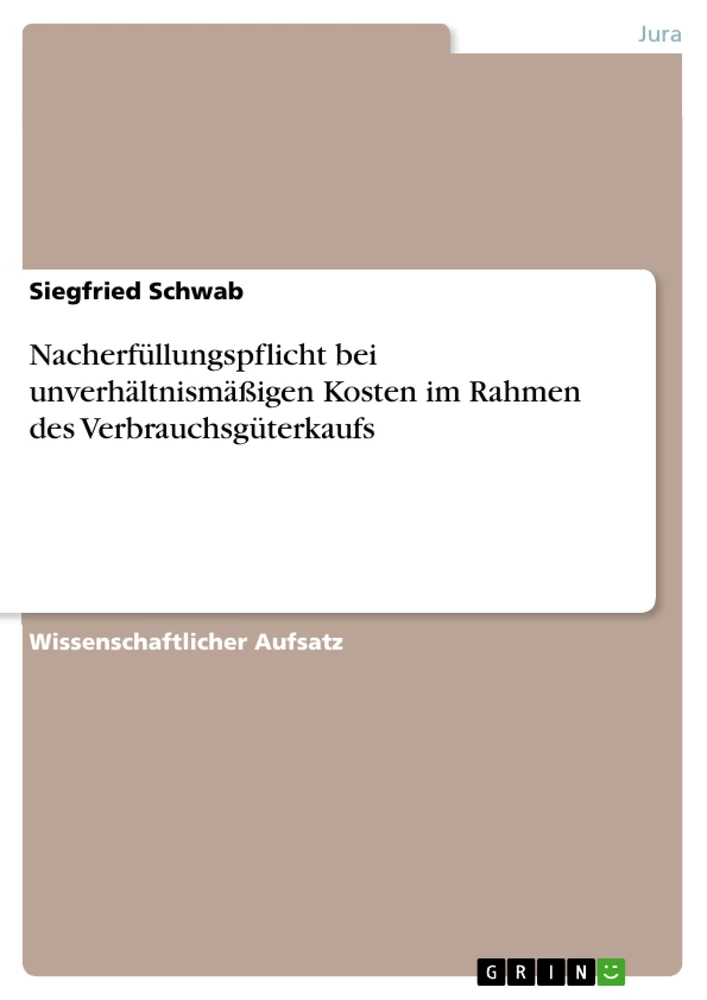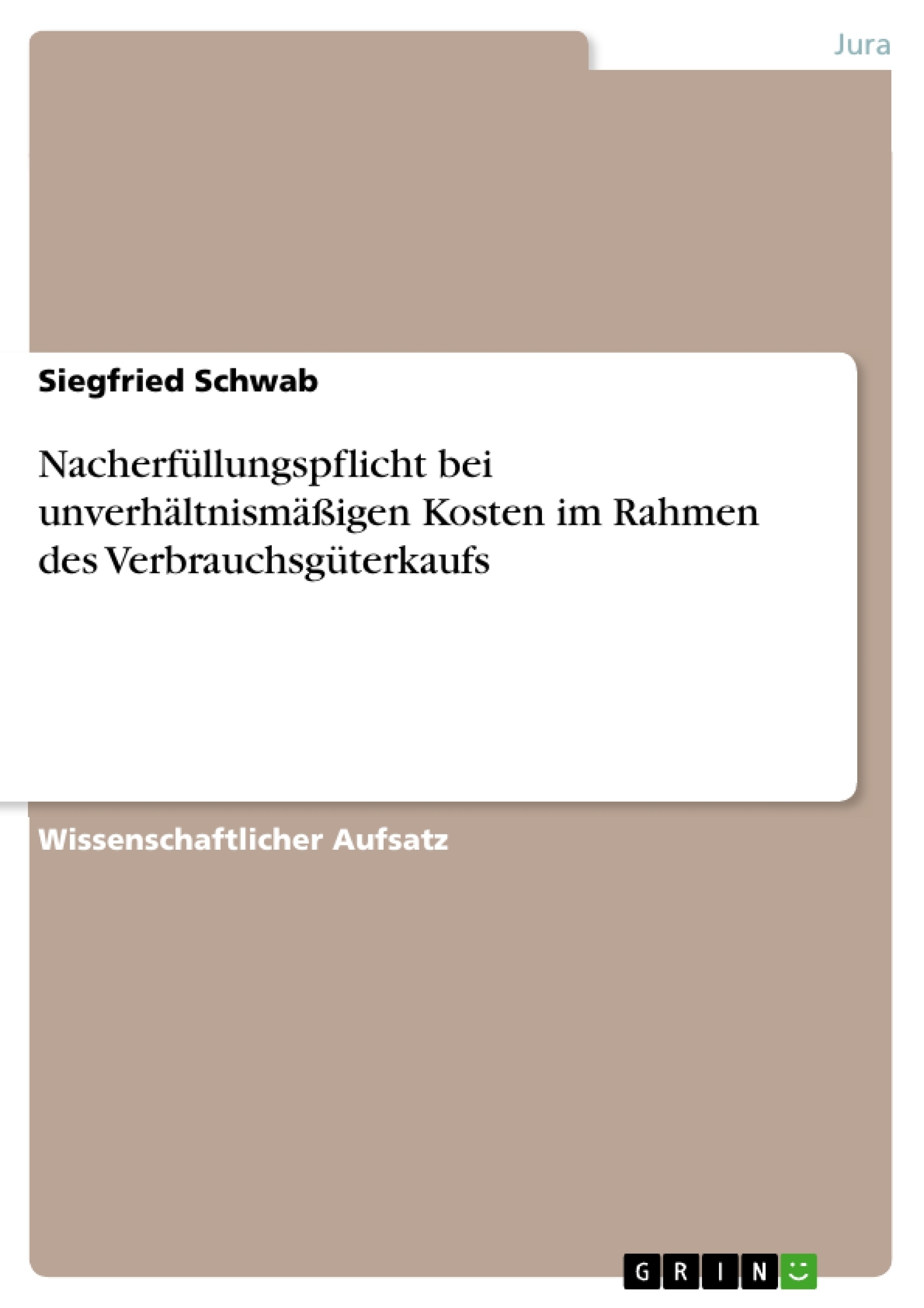Die Kosten für den Einbau einer neuen mangelfreien Sache zählen demgegenüber nicht zum Kostenaufwand nach § 439 Abs. 2 BGB; sie können nur unter den Voraussetzungen der §§ 434 Abs. 1, 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB unter Schadensersatzgesichtspunkten ersetzt verlangt werden, OLG Frankfurt a. M.: Urteil vom 14.02.2008 - 15 U 5/07, BeckRS 2008 05877. Anders das OLG Köln, OLG Köln, Urteil vom 21.12.2005 - 11 U 46/05, NJW-RR 2006, 677 - der Schadensersatzanspruch wegen Verkaufs und Lieferung mangelhafter Bodenfliesen umfasst nur die Aufwendungen für die Ersatzfliesen nebst Frachtkosten sowie der Entfernung und Rücknahme des mangelhaften Belags nebst Sockelleisten, nicht dagegen die Kosten der Neuverlegung. Schadensersatz für den Einbau der Fliesen (als Kosten des Einbaus neuer mangelfreier Fliesen) könnte der Kl. daher nur unter dem Gesichtspunkt der Verweigerung der Nacherfüllung verlangen. Das würde voraussetzen, dass die Nacherfüllung auch die Verlegung der nachzuliefernden mangelfreien Fliesen umfassen würde. Diese Ansicht wird vom OLG Karlsruhe vertreten, OLG-Report 2004, 465 = MDR 2005, 135 = BauR 2005, 109; ebenso Terrahe, VersR 2004, 680; Faust, in: Bamberger/Roth, BGB, § 439 RN 18). Durch die Nacherfüllung solle der Käufer in die Lage versetzt werden, mit der Sache so zu verfahren, als wäre diese mangelfrei gewesen. Damit sei auch der Zustand geschuldet, in dem sich die Sache befände, wenn sie mangelfrei gewesen wäre; zu den Aufwendungen i. S. von § 439 Abs. 2 BGB zählten damit auch die Kosten des Ein- und Ausbaus der Fliesen. Dem ist nicht zu folgen. Die geschuldete Nacherfüllung beschränkt sich auf Nachlieferung mangelfreier Fliesen. Der Einbau und die Verlegung der Fliesen ist dagegen nicht Bestandteil der Verkäuferpflichten aus §§ 433, 434 BGB. Die gegenteilige Auffassung vermengt Kauf- und Werkvertrag
Nacherfüllungspflicht bei unverhältnismäßigen Kosten im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs*[1]
1. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts gem. Art. 234 EG[2] zur Vorabentscheidung vorgelegt:
2. Sind die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 1 und 2 der Richtlinie[3] 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 5. 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter dahin auszulegen, dass sie einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegenstehen, wonach der Verkäufer im Falle der Vertragswidrigkeit des gelieferten Verbrauchsgutes die vom Verbraucher verlangte Art der Abhilfe auch dann verweigern kann, wenn sie ihm Kosten verursachen würde, die verglichen mit dem Wert, den das Verbrauchsgut ohne die Vertragswidrigkeit hätte, und der Bedeutung der Vertragswidrigkeit unzumutbar (absolut unverhältnismäßig) wären?
3. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Sind die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 und 3 Unterabs. 3 der vorbezeichneten Richtlinie dahin auszulegen, dass der Verkäufer im Falle der Herstellung des vertragsgemäßen Zustands des Verbrauchsgutes durch Ersatzlieferung die Kosten des Ausbaus des vertragswidrigen Verbrauchsgutes aus einer Sache, in die der Verbraucher das Verbrauchsgut gemäß dessen Art und Verwendungszweck eingebaut hat, tragen muss?[4]
Der Kl. kaufte bei der Bekl., die einen Baustoffhandel betreibt, am 24.01.2005 45,36 qm polierte Bodenfliesen eines italienischen Herstellers zum Preis von 1191,61 Euro ohne und 1382,27 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Er ließ rund 33 qm der Fliesen im Flur, im Bad, in der Küche und auf dem Treppenpodest seines Hauses verlegen. Danach zeigten sich auf der Oberfläche Schattierungen, die mit bloßem Auge zu erkennen sind. Der Kl. erhob deswegen Mängelrüge, die die Bekl. nach Rücksprache mit dem Hersteller am 26.07.2005 zurückwies. In einem vom Kl. eingeleiteten selbstständigen Beweisverfahren kam der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass es sich bei den bemängelten Schattierungen um feine Mikroschleifspuren handele, die nicht beseitigt werden könnten, so dass Abhilfe nur durch einen kompletten Austausch der Fliesen möglich sei. Die Kosten dafür bezifferte der Sachverständige mit 5026,35 Euro ohne und 5830,57 Euro einschließlich 16% Mehrwertsteuer. Nach vergeblicher Leistungsaufforderung mit Fristsetzung hat der Kl. die Bekl. in dem vorliegenden Rechtsstreit auf Lieferung mangelfreier Fliesen und auf Zahlung von 5830,57 Euro nebst Zinsen in Anspruch genommen. Das LG hat die Bekl. aus dem - vom Kl. nicht geltend gemachten - Gesichtspunkt der Minderung zur Zahlung von 273,10 Euro nebst Zinsen verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Auf die Berufung des Kl. hat das OLG die Bekl. unter teilweiser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils zur Lieferung von 45,36 qm mangelfreier Fliesen und zur Zahlung von 2122,37 Euro nebst Zinsen verurteilt. Mit ihrer vom BerGer. zugelassenen Revision wendet sich die Bekl. gegen ihre Verurteilung zur Zahlung von 2122,37 Euro nebst Zinsen. Die Revision ist teilweise unzulässig. Im Übrigen hängt die Entscheidung von der Auslegung des Art. 3 Abs. 2 und 3 Richtlinie 1999/44/EG ab. Aus diesem Grund hat der BGH das Verfahren ausgesetzt und beschlossen, dem EuGH seine Vorabentscheidungsfragen vorzulegen.[5]
[...]
[1] BGH, Beschluss vom 14.01.2009 - VIII ZR 70/08, EuZW 2009, 270ff = NJW 2009, 1660ff.Die Richtlinienwidrigkeit des Nutzungsersatzes bei Nachlieferung im Verbrauchsgüterkauf aus Anlass des Urteils des EuGH v. 17. 4. 2008, EuZW 2008, 310 bespricht Herresthal, in NJW 2008, 2475. Das Urteil wurde in EuZW 2008, 312 besprochen von Fischinger.
* Mit Erläuterungen von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ. unter Mitarbeit von Diplom-Betriebswirtin (BA) Silke Schwab.
[2] In einem Verfahren nach Art. 234 EG, der auf einer klaren Aufgabentrennung zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof beruht, fällt jede Beurteilung des Sachverhalts in die Zuständigkeit des nationalen Gerichts. Ebenso hat nur das nationale Gericht, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung für den Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorzulegenden Fragen zu beurteilen. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, wenn diese die Auslegung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ausnahmsweise obliegt es dem Gerichtshof, zur Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit die Umstände zu untersuchen, unter denen er von dem nationalen Gericht angerufen wird. Er kann die Entscheidung über eine Vorlagefrage eines nationalen Gerichts nur ablehnen, wenn die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn er nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine sachdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind, EuGH, Urteil vom 18.07.2007 - C-119/05. Schmid, Martina, Die Grenzen der Auslegungskompetenz des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG, 2005 - Zusammenspiel von Gemeinschaftsrecht und nationalen Privatrechten - Zulässigkeit der autonomen Rechtsangleichung, insbesondere der überschießenden Richtlinienumsetzung - Schuldrechtsmodernisierungsgesetz - Verbrauchsgüterkaufrichtlinie - Die richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts - "Quasi-richtlinienkonforme" Auslegung im überschießenden Bereich - Das Vorabentscheidungsverfahren, Art. 234 EG - Die Auslegungskompetenz des EuGH bei überschießender Umsetzung - Entwicklung der sogenannten "Dzodzi-Rechtsprechung" - Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung - Nationales Verfassungsrecht - Vorlagerecht/Vorlagepflicht im überschießenden Bereich - Bindungswirkung im überschießenden Bereich - Mögliche Beschränkung des Vorlagerechts - Die Entwicklung der Europäischen Gerichtsbarkeit nach Nizza.
Es ist Sache der innerstaatlichen Gerichte, die Vorschriften des nationalen Rechts so weit wie möglich derart auszulegen, dass sie in einer zur Verwirklichung des Gemeinschaftsrechts beitragenden Art und Weise angewandt werden können, Die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EGV in der Rechtsprechungspraxis des BVerfG, Warnke Markus, 2004. BVerfG und EuGH stehen in einem Kooperationsverhältnis - so sagt es jedenfalls das BVerfG. Die einzige verfahrenstechnische Möglichkeit des richterlichen Dialoges ist das Vorlageverfahren nach Art. 234 EGV. Nach dessen Absatz 3 ist eine Vorlage auch für Verfassungsgerichte verbindlich. Trotz zahlreicher Vorabentscheidungsersuche aus Deutschland hat ausgerechnet das BVerfG diese Chance – soweit ersichtlich - des direkten Austausches mit dem EuGH nicht genutzt. Bestand bisher in keinem Verfahren die Pflicht zu einer Vorlage?
Hierbei ist ein innerstaatliches Gericht, das im Rahmen seiner Zuständigkeit die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts anzuwenden hat, gehalten, für die volle Wirksamkeit dieser Normen Sorge zu tragen, indem es erforderlichenfalls jede entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts aus eigener Entscheidungsbefugnis unangewendet lässt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der EuGH gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Es stellt einen Entzug des gesetzlichen Richters dar, wenn ein nationales Gericht seiner Pflicht zur Anrufung des EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 234 EGV (vor dem 1. Mai 1999: Art. 177 EGV) nicht nachkommt (vgl. BVerfGE 73, 339 <366 f.>; 82, 159 <194 ff.>; 2. Kammer des Ersten Senats, DVBl 2001, S. 720).
[3] Die Überlagerung des deutschen Rechts durch das europäische Gemeinschaftsrecht und die Rechtsprechungspraxis des EuGH machen es notwendig, über die jeweiligen Kompetenzen und die Rechtsanwendung im Einzelfall kritisch nachzudenken. Ziel der Auslegung von Rechtsvorschriften ist dabei der historische Normzweck. Auslegungskriterien sind der Wortlaut und die historische Entstehungsgeschichte. Der EuGH darf dabei nicht die Souveränität der Mitgliedstaaten verletzen. Nationale Gesetze, die gegen unmittelbares Gemeinschaftsrecht verstoßen, dürfen nicht angewendet werden, Höpfner/Rüthers, AcP 209, 1. Nationales Recht ist richtlinienkonform auszulegen. Die Mitgliedstaaten müssen nach Art. 10 EGV Vorschriften des nationalen Rechts so anwenden, dass die Ziele des Gemeinschaftsrechts nicht gefährdet werden und dieses größtmögliche Wirkung entfalten kann, vgl. Grosche/Höft, NJOZ 2009, 2297f. Diese Pflicht haben die Gerichte unabhängig davon, ob die Auslegung eine Belastung des Einzelnen begründet, EuGH, NJW 2004, 3547. Dabei müssen die Besonderheiten der Richtlinie berücksichtigt werden. Diese sind nur hinsichtlich ihrer Ziele, nicht jedoch im Hinblick auf die Wahl der Mittel verbindlich, Schürnbrand, JZ 2007, 912. Primär ist der nationale Gesetzgeber zur Umsetzung der Richtlinie verpflichtet. Ihn trifft aufgrund der zugewiesenen Umsetzungspflicht auch das damit verbundene Irrtumsrisiko. Die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung beginnt mit Ablauf der Umsetzungsfrist, vgl. Ruffert, in Callies/Ruffert, Art. 249 EGV, RN 119
[4] Offen bleibt, ob der Verkäufer auch zum Einbau der ersatzweise gelieferten Sache verpflichtet ist, verneinend BGH, NJW 2008, 2837, mit Anm. Skamel, NJW 2008, 2820, JuS 2008, 933 mit Anm. Faust u. Pfeiffer, LMK 2008, 266216 - Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie erfasse lediglich die Kosten der Nacherfüllung selbst; Mangelfolgeschäden unterlägen dem nationalen Haftungsrecht, vgl. Pfeiffer , in: AnwKomm-BGB, Art. 3 der Richtlinie 1999/44/EG RN 13. Allerdings sieht Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie vor, dass der Käufer auch dann eine Minderung des Kaufpreises geltend machen kann, wenn die Abhilfe ihm „erhebliche Unannehmlichkeiten“ verursacht. Dies ist jedenfalls dem Wortlaut nach so zu lesen, dass selbst bei einer erfolgreichen Nacherfüllung (hier Lieferung einwandfreier Parkettstäbe) verbleibende Unannehmlichkeiten zu einer Herabsetzung des Kaufpreises und zu einem hierauf beruhenden RN 16; ders ., ZGS 2002, 390; Ernst/Gsell , ZIP 2000, 1410, 1418. Falls der EuGH die Richtlinie im Sinne ihres Wortlauts auslegt, stellt sich allerdings für die deutschen Gerichte die Problematik einer passenden Rechtsgrundlage im deutschen Recht im Rahmen einer richtlinienkonformen Auslegung. In Frage käme einmal § 280 Abs. 1 BGB. Diese Vorschrift setzt allerdings Vertretenmüssen des Verkäufers voraus. Fehlt es, bliebe aber die Möglichkeit, den offenen Begriff des Vertretenmüssens – nach den Umständen, § 276 BGB – insoweit im Sinne einer verschuldensunabhängigen Haftung zu deuten. Vorstellbar (obschon ein Systembruch) wäre zum anderen eine ausdehnende Interpretation des § 441 BGB, so Faust, a.a.O.
[5] 1. Ist eine Kaufsache ihrem bestimmungsgemäßen Zweck entsprechend vom Käufer eingebaut worden und stellt sich erst im Nachhinein heraus, dass sie mangelhaft ist, so gehören zu den von dem Verkäufer verschuldensunabhängig zu tragenden Nacherfüllungskosten i. S. des § 439 II BGB die Kosten für die Lieferung der mangelfreien Sache an den Wohnort des Käufers, für den Ausbau der bereits eingebauten mangelhaften Sache und für deren Entsorgung.
2. Die Kosten für den Einbau einer neuen mangelfreien Sache zählen demgegenüber nicht zum Kostenaufwand nach § 439 Abs. 2 BGB; sie können nur unter den Voraussetzungen der §§ 434 Abs. 1, 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB unter Schadensersatzgesichtspunkten ersetzt verlangt werden, OLG Frankfurt a. M.: Urteil vom 14.02.2008 - 15 U 5/07, BeckRS 2008 05877. Anders das OLG Köln, OLG Köln, Urteil vom 21.12.2005 - 11 U 46/05, NJW-RR 2006, 677 - der Schadensersatzanspruch wegen Verkaufs und Lieferung mangelhafter Bodenfliesen umfasst nur die Aufwendungen für die Ersatzfliesen nebst Frachtkosten sowie der Entfernung und Rücknahme des mangelhaften Belags nebst Sockelleisten, nicht dagegen die Kosten der Neuverlegung. Schadensersatz für den Einbau der Fliesen (als Kosten des Einbaus neuer mangelfreier Fliesen) könnte der Kl. daher nur unter dem Gesichtspunkt der Verweigerung der Nacherfüllung verlangen. Das würde voraussetzen, dass die Nacherfüllung auch die Verlegung der nachzuliefernden mangelfreien Fliesen umfassen würde. Diese Ansicht wird vom OLG Karlsruhe vertreten, OLG-Report 2004, 465 = MDR 2005, 135 = BauR 2005, 109; ebenso Terrahe, VersR 2004, 680; Faust, in: Bamberger/Roth, BGB, § 439 RN 18). Durch die Nacherfüllung solle der Käufer in die Lage versetzt werden, mit der Sache so zu verfahren, als wäre diese mangelfrei gewesen. Damit sei auch der Zustand geschuldet, in dem sich die Sache befände, wenn sie mangelfrei gewesen wäre; zu den Aufwendungen i. S. von § 439 Abs. 2 BGB zählten damit auch die Kosten des Ein- und Ausbaus der Fliesen. Dem ist nicht zu folgen. Die geschuldete Nacherfüllung beschränkt sich auf Nachlieferung mangelfreier Fliesen. Der Einbau und die Verlegung der Fliesen ist dagegen nicht Bestandteil der Verkäuferpflichten aus §§ 433, 434 BGB. Die gegenteilige Auffassung vermengt Kauf- und Werkvertrag
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in), 2009, Nacherfüllungspflicht bei unverhältnismäßigen Kosten im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/136257