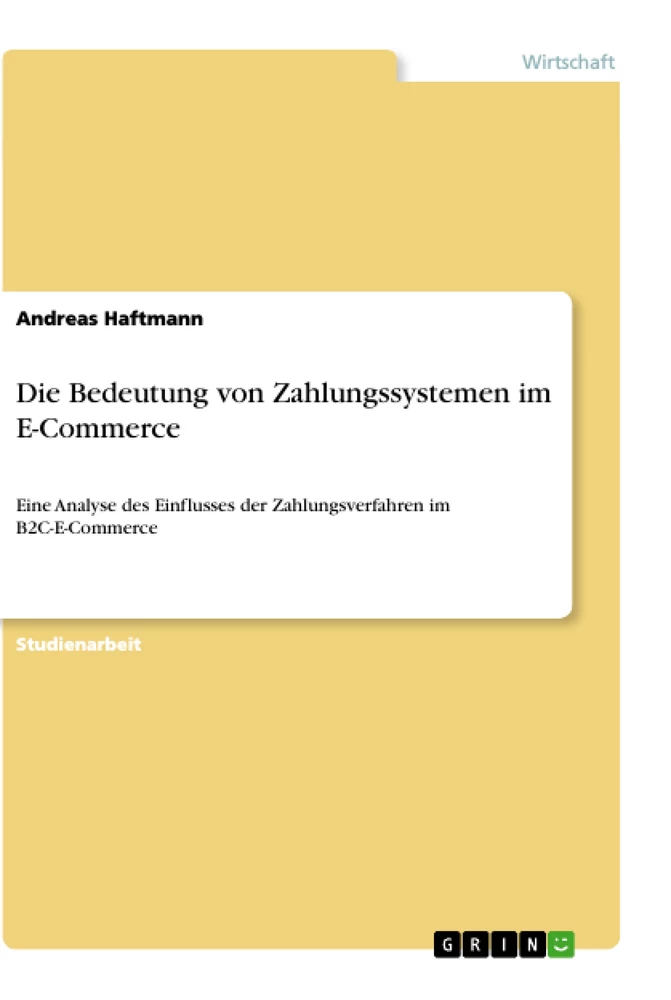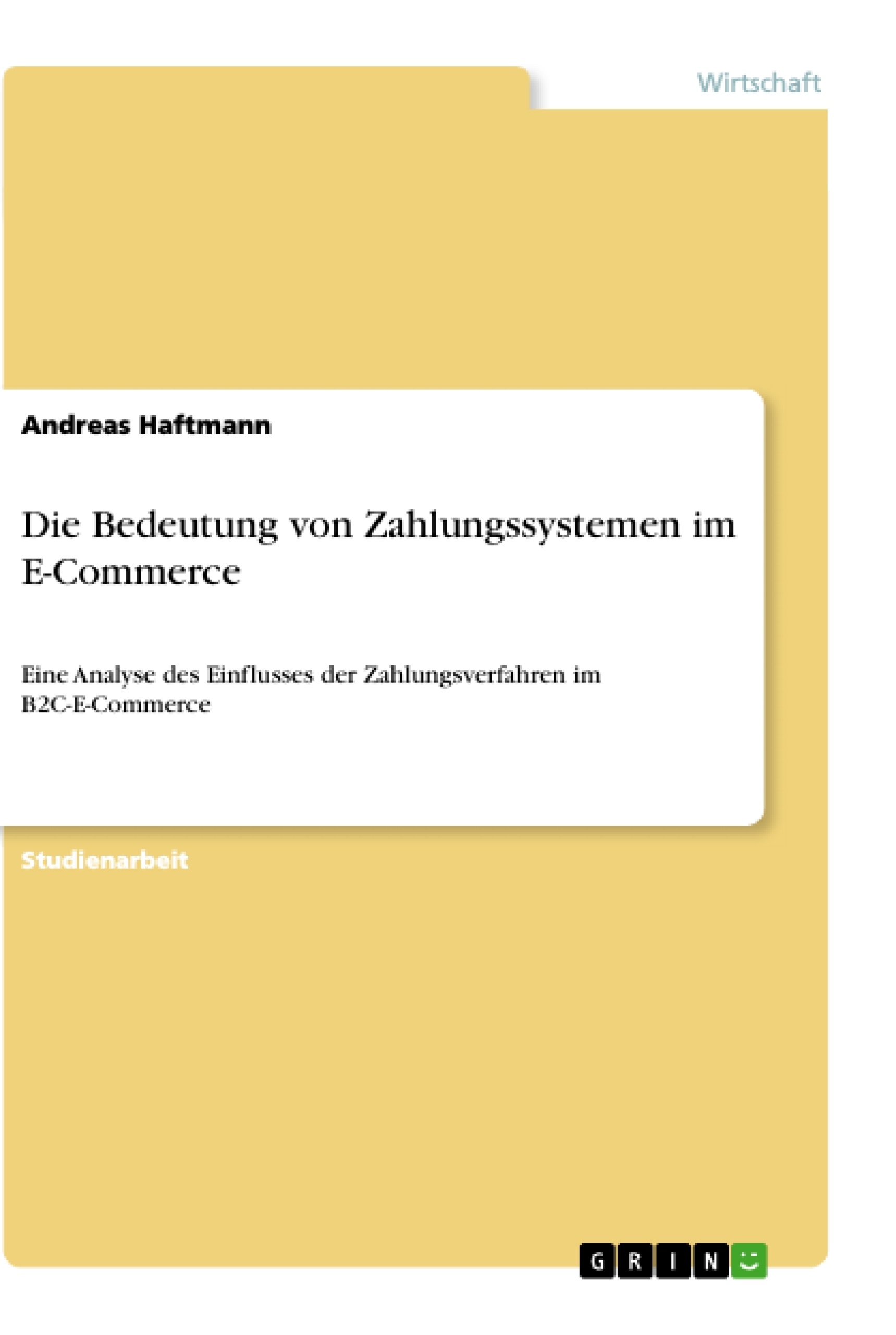In den 17 Jahren seines Bestehens hat sich das World Wide Web zu einem Massenmedium entwickelt. So haben ca. 65 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren innerhalb der letzten drei Monate das Internet genutzt, davon haben ca. 88 Prozent bereits im Internet eingekauft. Für das Jahr 2010 erwartet der Branchenverband BITKOM, dass von Privatpersonen ca. 145 Mrd. Euro für Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden, die direkt über das Internet bezogen werden.
Zur operativen Abwicklung der Bezahlung im Business-to-Consumer-Bereich (B2C-Bereich) haben sich Zahlungssysteme am Markt etabliert, die sich hinsichtlich verschiedenster Kriterien voneinander unterscheiden. Aktuelle Studien belegen, dass der Einfluss des Zahlungssystems weit über die rein technische Bewegung eines Geldbetrages hinausgeht.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, die am Markt befindlichen Zahlungssysteme zu erfassen und sie detailliert zu kategorisieren. Anschließend soll analysiert werden, welche Bedeutung sie einerseits für den Kunden und zum anderen für den Händler im E-Commerce haben können.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen von Zahlungssystemen
2.1 Übersicht
2.2 Klassische Zahlungssysteme
2.2.1 Vorkasse
2.2.2 Lastschrift
2.2.3 Nachnahme
2.2.4 Rechnung
2.2.5 Kreditkarte
2.3 E-Payment-Systeme
2.4 M-Payment-Systeme
2.5 Elektronisches Geld
3 Einordnung der Zahlungssysteme
3.1 Zeitpunkt der Zahlung
3.2 Höhe des Zahlbetrages
3.3 Speicherung von Daten
3.4 Nutzerkreis
4 Analyse des Einflusses der Zahlungssysteme
4.1 Anforderungen des Händlers an Zahlungssysteme
4.1.1 Sicherheit
4.1.2 Geschwindigkeit
4.1.3 Kosten
4.1.4 Akzeptanz
4.2 Anforderungen des Kunden an Zahlungssysteme
4.2.1 Sicherheitsaspekte und Vertrauen
4.2.2 Benutzbarkeit
4.2.3 Rabatte und Prämien
4.2.4 Akzeptanz
5 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Übersicht über die Zahlungssysteme
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zahlungsausfallsicherheit und Geschwindigkeit
Tabelle 2: Direkte und Indirekte Kosten
Tabelle 3: Akzeptanz und Abbruchquoten der unterschiedlichen Zahlungssysteme
1 Einleitung
In den 17 Jahren seines Bestehens hat sich das World Wide Web zu einem Massenmedium entwickelt (Hildebrandt, 2009). So haben ca. 65 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren innerhalb der letzten drei Monate das Internet genutzt (AGOF e.V., 2009), davon haben ca. 88 Prozent bereits im Internet eingekauft (BITKOM, 2009). Für das Jahr 2010 erwartet der Branchenverband BITKOM, dass von Privatpersonen ca. 145 Mrd. Euro für Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden, die direkt über das Internet bezogen werden (BITKOM, 2007).
Zur operativen Abwicklung der Bezahlung im Business-to-Consumer-Bereich (B2C-Bereich) haben sich Zahlungssysteme am Markt etabliert, die sich hinsichtlich verschiedenster Kriterien voneinander unterscheiden. Aktuelle Studien belegen, dass der Einfluss des Zahlungssystems weit über die rein technische Bewegung eines Geldbetrages hinausgeht.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, die am Markt befindlichen Zahlungssysteme zu erfassen und sie detailliert zu kategorisieren. Anschließend soll analysiert werden, welche Bedeutung sie einerseits für den Kunden und zum anderen für den Händler im E-Commerce haben können.
2 Grundlagen von Zahlungssystemen
In diesem Teil der Arbeit sollen zunächst verbreitete Zahlungssysteme vorgestellt werden. Zudem wird auch auf Einzellösungen bzw. Unternehmen eingegangen, die das jeweilige System in der Praxis anbieten.
2.1 Übersicht
Der Begriff E-Commerce wird in der Literatur sehr unterschiedlich definiert. Für diese Arbeit wird die folgende Definition verwendet: „E-Commerce bezeichnet die Vermarktung und Distribution von Unternehmensleistungen mit Hilfe eines umfassenden Einsatzes neuer Informations- und Kommunikationstechnologien“ (Kuß & Tomczak, 2000).
Für den E-Commerce ist weiterhin die Unterscheidung in physische und digitale Güter notwendig. Physische Güter sind materielle Mittel zur Bedürfnisbefriedigung und werden dem Kunden im Fernabsatz in der Regel auf dem Postweg übersandt. Als typische Beispiele lassen sich Bücher oder elektronische Geräte anführen. Bei digitalen Gütern handelt es sich um immaterielle Binärdaten, der Wertübergang erfolgt online und sofort. Typische Beispiele sind E-Books oder Musikdateien.
Aus der folgenden Grafik ist die Systematisierung der unterschiedlichen Zahlungssysteme ersichtlich, die in dieser Arbeit verwendet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Ubersicht fiber die Zahlungssysteme
Quelle: eigene Illustration (nach Vorlage von (Krabichler, Wittmann, Stahl, & Breitschaft ,
Zahlungsabwicklung im Internet, 2006))
2.2 Klassische Zahlungssysteme
Unter „klassischen Zahlungssystemen“ sollen all jene Verfahren zusammengefasst werden, die vor dem Aufkommen des Internets bestanden haben und auch außerhalb des Geschäftsverkehrs im Internet gebräuchlich sind.
2.2.1 Vorkasse
Im Internet ist die so genannte Vorkasse gebräuchlich, die über eine Überweisung bewerkstelligt wird: ein Zahlbetrag wird zwischen zwei Bankkonten übertragen. Dies kann durch die Abgabe eines Überweisungsformulars bei einem Kreditinstitut erfolgen, oder aber durch die Nutzung des Onlinebanking. Bei diesem Zahlungssystem erwartet der Händler den Zahlungseingang, bevor die Leistung erfolgt, d.h. bevor er die Ware zur Auslieferung freigibt.
Einige innovative Systeme bauen auf dieser Technik auf. Hierbei wird der Bezahlvorgang direkt in den Einkaufsvorgang eingebunden. Der Kunde wird zum Onlinebanking seiner Bank weitergeleitet, wo er sich mit seiner Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) und Kontonummer anmeldet. Daraufhin findet er ein bereits ausgefülltes Überweisungsformular vor, das dann nur noch mit einer Transaktionsnummer (TAN) bestätigt wird (direkt marketing, 2009). Damit wird ein Systembruch vermieden, damit der Kunde nicht in einem gesonderten Browserfenster die Bankwebsite aufrufen muss. Weiterhin wird dem Händler direkt mitgeteilt, wenn die Überweisung erfolgreich ausgeführt wurde. Zu benennen sind hier die beiden in Deutschland bekannten Systeme „giropay“1 und „Sofortüberweisung.de“2.
2.2.2 Lastschrift
Das Zahlen per Lastschrift funktioniert prinzipiell wie eine Überweisung, nur in umgekehrter Richtung. Hierbei gibt der Kunde seine Bankkontodaten auf der Internetseite des Händlers an und willigt ein, dass der Händler den Zahlbetrag vom Kunden-Bankkonto einziehen darf. Der Händler erteilt daraufhin seinem Kreditinstitut den Auftrag, den Betrag von diesem Konto abzubuchen.
2.2.3 Nachnahme
Bei der Nachnahme erfolgt die Bezahlung bei Lieferung der Ware in bar an das ausliefernde Logistikunternehmen. Die Sendung wird dem Kunden nur ausgehändigt, wenn dieser, oder sein Bevollmächtigter, die Ware vollständig bezahlt. Das Logistikunternehmen übermittelt daraufhin die Auslieferungs- und Zahlungsbestätigung an den Händler und überträgt den Zahlbetrag.
2.2.4 Rechnung
Die Rechnung dokumentiert die Forderung eines Geldbetrages, die dem Kunden in der Regel mit der Ware zusammen gesendet wird. Die Zahlung erfolgt nach Wareneingang beim Kunden durch Überweisung. Häufig sind in der Praxis vorgefertigte Überweisungsträger zu finden, die, nach Eintragung des Bankkontos durch den Kunden, einfach bei der Bank eingereicht werden können. Zur Ausführung der Überweisung kann aber auch das Onlinebanking verwandt werden.
2.2.5 Kreditkarte
Die Kreditkartenzahlung ist im E-Commerce eine häufig genutzte Option. Der Kunde übermittelt im Online-Shop seine Kreditkartendaten, welche anschließend von einem externen Unternehmen, dem so genannten Kreditkarten-Acquirer, geprüft werden. Der Acquirer fungiert dabei als Mittler zwischen Händler und Kreditkartenunternehmen. Die Abbuchung vom Kreditkartenkonto des Kunden und die Zahlungsbestätigung werden vom Acquirer vorgenommen, wofür dieser eine Gebühr (Disagio) erhebt (Krabichler, Wittmann, Stahl, & Breitschaft, E-Commerce-Leitfaden, 2009). Die Karten werden dabei entweder von einer Bank (MasterCard, Visa, JCB) oder einem Kreditkarteninstitut (AMEX, Discover, Diners Club) emittiert.
2.3 E-Payment-Systeme
Als E-Payment-Systeme sollen all jene Zahlungssysteme klassifiziert werden, die speziell für den Handel im Internet entwickelt wurden und auch nur innerhalb des E-Commerce gebräuchlich sind.
Prinzipiell funktionieren all diese Systeme nach einem ähnlichen Prinzip. Sowohl Kunde, als auch Verkäufer sind bei dem Anbieter der E-Payment-Lösung registriert. In der Einkaufsabwicklung wird der Kunde vom Shop zum Payment-Anbieter weitergeleitet und dort aufgefordert, sich anzumelden, bzw. sich als neuer Benutzer zu registrieren. Im folgenden Schritt bestätigt der Kunde die Zahlung an den Händler, woraufhin dieser über den Erfolg der Zahlung informiert und ihm der Zahlbetrag gutgeschrieben wird. Der zu zahlende Betrag wird dann vom Bankkonto des Kunden durch den E-Payment-Anbieter eingezogen. Einige Systeme funktionieren auch über eine Guthabenbasis. Der Kunde muss hierbei vorab ein Guthaben einzahlen, um Zahlungen vornehmen zu können.
Bei den in der Praxis üblichen Systemen ist zunächst nach E-Mail- und Inkassosystemen zu unterscheiden. Zu den E-Mail-Systemen zählt „PayPal“ 3, welches mit Abstand das meistgenutzte E-Payment-System ist (Krabichler, Wittmann, Stahl, & Breitschaft, Erfolgsfaktor Payment, 2008). Das Unternehmen wurde mittlerweile von eBay übernommen und ist in viele Auktionen auf eBay eingebunden, was maßgeblich zu dessen Akzeptanz beigetragen haben dürfte. Ein weiteres bekanntes System ist „moneybookers“4. Beiden Systemen liegt zugrunde, dass Zahlungen an jede beliebige E-Mailadresse gesendet werden können. Beim Anbieter wird mit dieser E-Mail-Adresse ein Konto eröffnet. Damit lassen sich Zahlungen einfach versenden und empfangen. Oft wird der Kunde im Einkaufsvorgang auf die Internetseite des Payment-Anbieters weitergeleitet. Dort muss er sich in sein Kundenkonto einloggen und die Zahlung bestätigen. Beide beschriebenen Systeme werden dabei über ein Guthabenkonto betrieben, woraus Zahlungen erfolgen können und welches durch eingehende Zahlungen aufgeladen wird. Weiterhin kann das Konto durch Überweisungen von einem Bankkonto aufgeladen werden. In der Regel ist auch die Auszahlung des Guthabens auf ein Bankkonto ab einem gewissen Betrag möglich.
Die Inkassosysteme funktionieren ähnlich, allerdings existiert hier kein Guthabenkonto, der Zahlbetrag wird einzeln bei jeder Zahlung vom Girokonto des Kunden per Lastschrift eingezogen. Ein bekanntes System ist „ClickandBuy“5. In Deutschland bietet auch PayPal einen ähnlichen Inkassoservice an (PayPal, 2009).
Eine weitere Möglichkeit des Bezahlens bieten telefonische Mehrwertdienste. Gerade für kleine Beträge kommen diese Zahlungssysteme in Frage. Hierbei muss zum Bezahlen einer Leistung eine kostenpflichtige Sonderrufnummer gewählt werden. Der Zahlbetrag wird dann auf der Telefonrechnung des Kunden berechnet. Ein solches System ist beispielsweise „T-Pay“ 6, welches von der Deutschen Telekom betrieben wird.
Nach der hier verwendeten Definition für E-Payment-Systeme sind durchaus auch die vorher beschriebenen Systeme zur Integration einer Vorkassezahlung (z.B. „giropay“) in den Einkaufsvorgang als E-Payment-System klassifizierbar.
2.4 M-Payment-Systeme
Unter M-Payment-Systemen werden jene Systeme verstanden, die zur Zahlungsabwicklung Mobiltelefone oder ähnliche mobile Endgeräte nutzen. Durch die mobile Anwendbarkeit ergeben sich vielfältige Nutzungsszenarien, wie bspw. den Kauf elektronischer Parkscheine. Aber auch im Onlinehandel entstehen dadurch große Potentiale. Zwar hat sich die Zahlform in Deutschland bisher wenig durchgesetzt (Krabichler, Wittmann, Stahl, & Breitschaft, E-Commerce-Leitfaden, 2009), jedoch ist diese Zahlungsvariante gerade aus Sicherheitsaspekten interessant.
Der Kunde wählt im Bestellvorgang im Onlineshop den gewünschten Payment-Anbieter aus und gibt seine Zugangsdaten (z.B. Mobilfunknummer und PIN) an. Er erhält dann eine SMS auf sein Mobiltelefon. Auf diese muss er bestätigend antworten, woraufhin die Zahlung ausgeführt wird. Ein solches Verfahren ist beispielsweise „mpass“ 7, das von den Netzbetreibern „Vodafone“ und „O2“ betrieben wird. Zwar steht dieser Dienst prinzipiell auch Kunden anderer Mobilfunknetze offen, doch diese müssen sich gesondert registrieren und wiederum ihre Zahldaten angeben.
Weiter zum M-Payment zuzuordnen sind so genannte Premium-SMS. Hier erfolgt die Abrechnung, ähnlich telefonischer Mehrwertdienste, über die Mobilfunkrechnung des Kunden. Allerdings ist diese Zahlungsmethode bei deutschen Netzbetreibern nur für explizit mobilfunknahe Dienstleistungen vorgesehen, was die Anwendbarkeit im Internet wesentlich einschränkt(MindMatics, 2006). Premium-SMS werden in dieser Arbeit deshalb nicht als Zahlungssystem für den E-Commerce gezählt.
2.5 Elektronisches Geld
Alle bisher vorgestellten Zahlungssysteme haben eine entscheidende Gemeinsamkeit. Der Kunde muss seine Identität in unterschiedlichem Maß zur Bezahlung offenbaren. Dies ist auch ein grundlegender Unterschied zum stationären Handel. Bei der Bezahlung am „Point Of Sale“ kann der Kunde durchaus seine Anonymität wahren, indem er mit Bargeld zahlt. Von Kunden kann aber genau diese Anonymität auch bei Internetkäufen nachgefragt werden, insbesondere beim Kauf digitaler Güter, bei denen also auch keine Versandadresse angegeben werden muss. Weiterhin ist gerade für kleine Zahlbeträge nach der Einfachheit eines Zahlungssystems zu fragen. Vom „einfachen Griff ins Portemonnaie“, wie im stationären Handel immer noch üblich, sind die beschriebenen Systeme weit entfernt.
[...]
1 Im Internet aufrufbar unter http://www.giropay.de.
2 Im Internet aufrufbar unter http://www.sofortueberweisung.de.
3 Im Internet aufrufbar unter http://www.paypal.de.
4 Im Internet aufrufbar unter http://www.moneybookers.de.
5 Im Internet aufrufbar unter http://www.clickandbuy.de.
6 Im Internet aufrufbar unter http://www.t-pay.de.
7 Im Internet aufrufbar unter http://www.mpass.de.
- Quote paper
- Andreas Haftmann (Author), 2009, Die Bedeutung von Zahlungssystemen im E-Commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135986