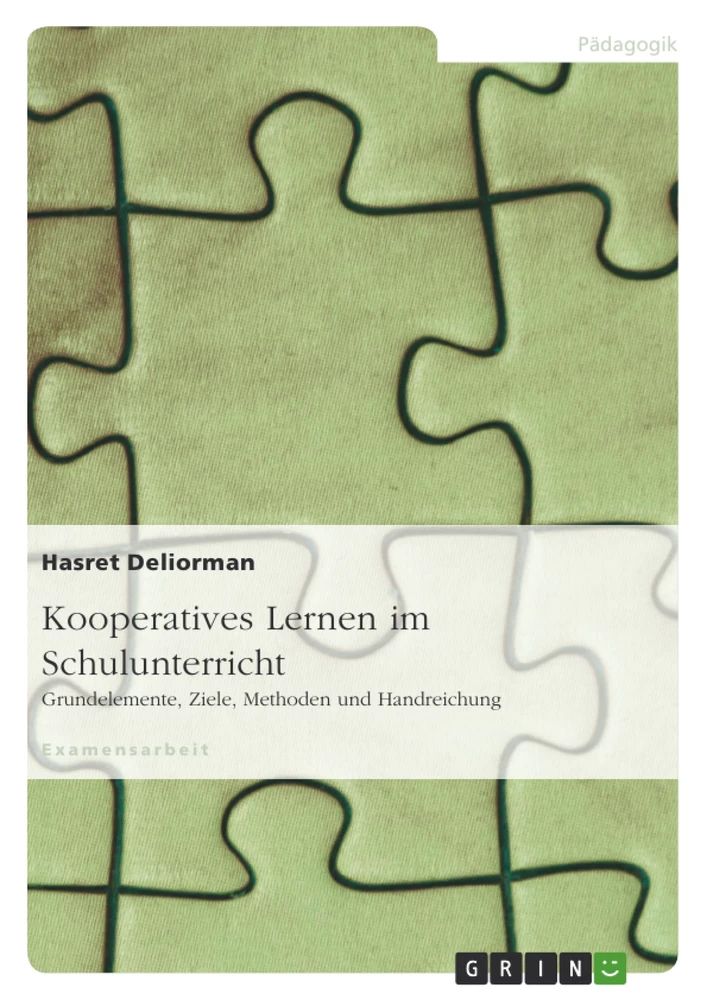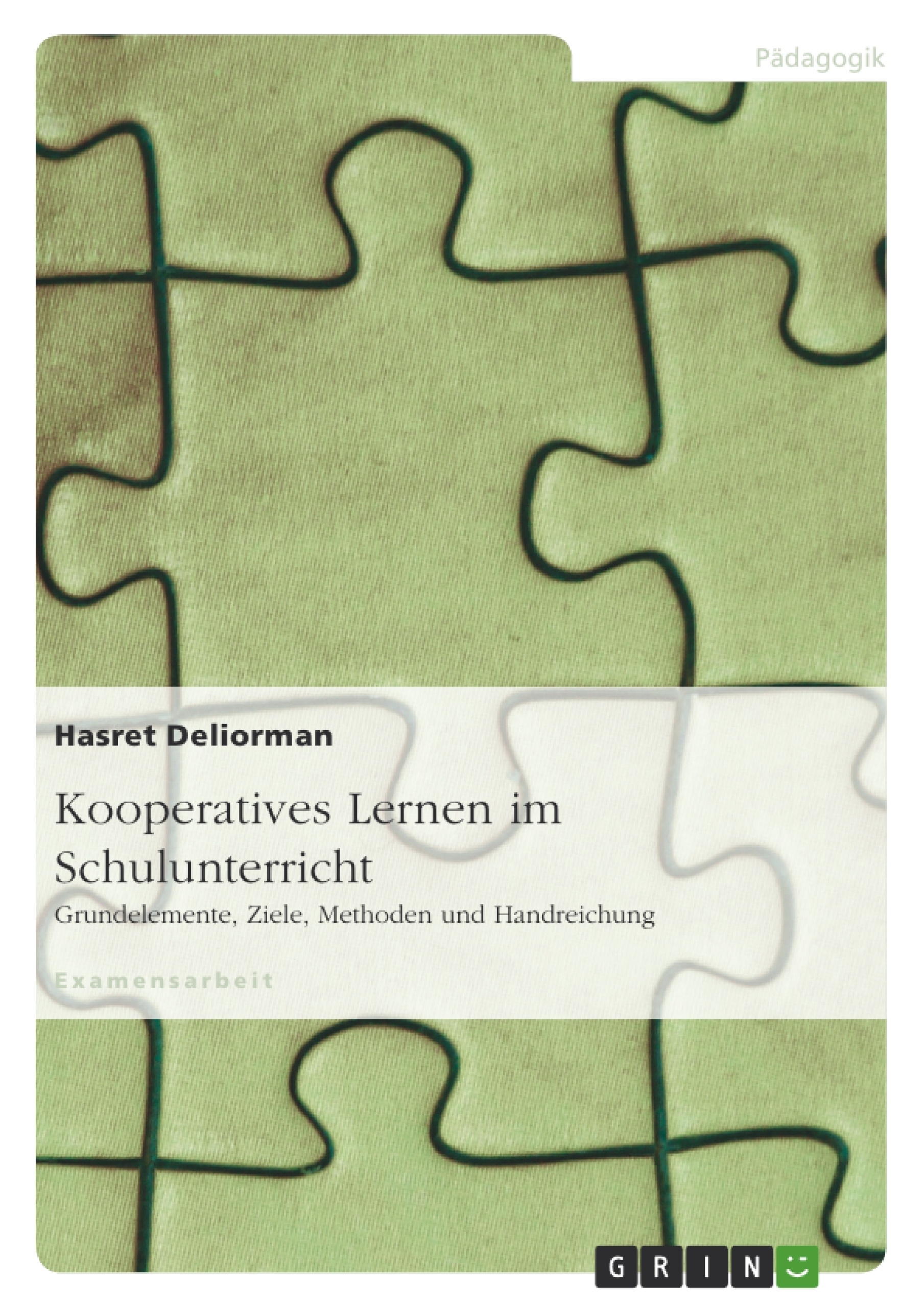Bis Mitte der 1960er Jahre war der schulische Unterricht von einem konkurrenzorientierten und individualistischem Lernen geprägt. Kooperative Arbeitsweisen waren recht unbekannt oder wurden gänzlich ignoriert (Johnson & Johnson, 2008:16). Durch den gesellschaftlichen Wandel gewannen auch Gruppenarbeiten an Anerkennung, sodass sie sich zu einem beliebten Element in den neueren Unterrichtsformen entwickeln konnten.
Die Idee des gemeinsamen Lernens wurde unter der Bezeichnung „Kooperatives Lernen“ neu aufgegriffen und weiterentwickelt. Seinen Anfang fand das angloamerikanische Cooperative Learning durch die Gestalt- und Gruppentherapie. Man ging von der Annahme aus, dass die gegenseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder entscheidend ist im Hinblick auf die Gruppendynamik und der jeweiligen Zielvorgabe.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Themenfeld des kooperativen Lernens im Schulunterricht auseinander. Kapitel 2 beinhaltet die Fragestellung, wieso die Verwendung kooperativer Lernformen im Unterricht eine Notwendigkeit darstellt und legt dar, welche gesellschaftlichen Veränderungen den Bedarf an neuen Lehrformen steigern. Zu diesem Zweck wird in den folgenden Kapitel 3 und 4 auf die Fragestellung eingegangen, was allgemein unter dem Begriff „kooperatives Lernen“ zu verstehen ist. Darüber hinaus werden Grundgedanken und Prinzipien dieser Lernform aufgezeigt und näher beleuchtet. Entwicklungspsychologische Hintergründe, die bei der Betrachtung kooperativen Lernens von großer Bedeutung sind, werden in Kapitel 5 erläutert. Kapitel 6 umfasst die Zielsetzung dieser Lernform. Eine neue Unterrichtsform fordert auch Veränderungen im Klassenzimmer. Kap.7 geht daher auf die vier grundlegenden Veränderungen ein und definiert die neuen Rollen der Beteiligten.
Kap.8 gibt einen Einblick in den Typus kooperativer Lernformen und seiner Variationen. In Kap.9 wird die Fragestellung beantwortet, wie ein Klassenzimmer mit solch einer Lernform in günstiger Weise zu leiten ist. Im Anschluss stelle ich in Kap.10+11 kooperative Lehr- und Lernformen vor, die, wie auch in Kap.12 beschrieben, auf den Fremdsprachenunterricht angewendet werden können. Große Unklarheiten im Rahmen des kooperativen Lernens lassen sich jedoch häufig in der Frage nach Bewertungsmöglichkeiten kooperativer Arbeit finden.
In Kap.13 werden daher drei unterschiedliche Formen der Leistungsbewertung aufgegriffen und auf das kooperative Lernen übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zur Entwicklung des Gegenstandes
- 1.2 Zur Auswahl des kooperativen Lernens als Thema der Arbeit
- 1.3 Zum Aufbau der Arbeit
- 2. Begründung kooperativen Lernens
- 3. Was ist kooperatives Lernen?
- 3.1 Definition
- 3.2 Grundprinzip
- 4. Fünf Grundelemente kooperativen Lernens
- 4.1 Soziale Fertigkeiten/Teamkompetenz
- 4.2 Direkte Interaktion/Face-to-Face Interaktion
- 4.3 Individuelle Verantwortungsübernahme
- 4.4 Gegenseitige positive Abhängigkeit
- 4.5 Evaluation/Prozess-Reflexion durch die Gruppe
- 5. Entwicklungspsychologische Theorien
- 5.1 Soziokonstruktivistische Perspektive Piagets
- 5.2 Soziokulturelle Perspektive Vygotskis
- 6. Ziele des kooperativen Lernens
- 6.1 Voneinander lernen
- 6.2 Gegenseitige Unterstützung
- 6.3 Selbstmanagement
- 6.4 Perspektivenwechsel
- 6.5 Förderung kooperativer Kompetenzen und sozialer Fertigkeiten
- 7. Vier Dimensionen des kooperativen Klassenzimmers
- 7.1 Veränderung der Klassenstruktur
- 7.2 Veränderung des Aufgabentyps
- 7.3 Veränderung der Lehrerrolle
- 7.4 Veränderung der Schülerrolle
- 8. Verschiedene Typen kooperativer Lerngruppen
- 9. Wie manage ich ein kooperatives Klassenzimmer?
- 9.1 Motivationale Aspekte
- 9.2 Gruppenbildung
- 9.3 Gruppenstärkung
- 9.3.1 Interview
- 9.3.2 Gruppenname und Gruppenlogo
- 9.4 Probleme und Umgang mit Problemen
- 9.4.1 Gruppenbezogene Belohnung
- 9.4.2 Das Zero-Noise Signal
- 9.4.3 Besondere Anerkennung
- 10. Das Gruppenpuzzle
- 10.1 Die Entstehungsgeschichte
- 10.2 Wie funktioniert das Gruppenpuzzle?
- 10.2.1 Die Aufgaben der Lehrkraft
- 10.2.2 Lernfreude der Schüler
- 10.3 Die Wirksamkeit des Gruppenpuzzles
- 10.3.1 Untersuchungspunkte
- 10.3.2 Durchführung und Ergebnisse der Voruntersuchung
- 10.3.3 Durchführung und Auswertung der Hauptuntersuchung
- 10.4 Worin liegen die Schwächen des Gruppenpuzzles?
- 11. Weitere Methoden kooperativen Lernens
- 11.1 Die Gruppenrallye (STAD= Student Teams Achievement Divisions)
- 11.2 Think - Pair - Share
- 11.3 Das Placemat-Verfahren
- 12. Kooperative Lernformen im Fremdsprachenunterricht
- 13. Wie bewerte ich die Leistung der Schüler?
- 13.1 Die Bewertung der Gruppenergebnisse
- 13.2 Die Bewertung des Arbeitsverhaltens
- 13.3 Die Bewertung individueller Leistung durch Aufsätze
- 14. Zusammenfassung
- 15. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den Einsatz kooperativen Lernens im Schulunterricht. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des kooperativen Lernens darzustellen und verschiedene Methoden sowie deren Anwendung und Bewertung im Unterricht zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit den Vorteilen und Herausforderungen dieser Lernform.
- Theoretische Grundlagen des kooperativen Lernens
- Methoden des kooperativen Lernens
- Klassenmanagement im kooperativen Unterricht
- Bewertung von Gruppen- und Einzelarbeit
- Anwendung im Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema kooperatives Lernen ein, beleuchtet dessen Entwicklung und die Auswahl dieses Themas für die vorliegende Arbeit. Sie gibt einen Überblick über den Aufbau der Hausarbeit und skizziert den methodischen Ansatz.
2. Begründung kooperativen Lernens: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit den didaktischen und pädagogischen Argumenten für den Einsatz von kooperativen Lernmethoden auseinandersetzen, die Vorteile gegenüber traditionellen Lernformen herausstellen und möglicherweise gesellschaftliche Begründungen anführen.
3. Was ist kooperatives Lernen?: Hier wird eine Definition von kooperativem Lernen gegeben und das Grundprinzip dieser Lernform erläutert. Es wird wahrscheinlich auf die Unterschiede zu anderen Gruppenarbeitsformen eingegangen und die spezifischen Merkmale kooperativen Lernens hervorgehoben.
4. Fünf Grundelemente kooperativen Lernens: In diesem Kapitel werden die fünf wesentlichen Elemente des kooperativen Lernens – soziale Fertigkeiten, direkte Interaktion, individuelle Verantwortlichkeit, gegenseitige Abhängigkeit und Evaluation – detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für den Lernerfolg erklärt. Wahrscheinlich wird die Interdependenz der Elemente herausgearbeitet.
5. Entwicklungspsychologische Theorien: Dieses Kapitel wird die soziokonstruktivistische Perspektive Piagets und die soziokulturelle Perspektive Vygotskis im Kontext des kooperativen Lernens beleuchten. Es wird die Relevanz dieser Theorien für das Verständnis von Lernprozessen in Gruppen darlegen und den theoretischen Hintergrund für die Wirksamkeit kooperativen Lernens liefern.
6. Ziele des kooperativen Lernens: Hier werden die Lernziele, die durch kooperatives Lernen erreicht werden können, umfassend beschrieben. Es wird vermutlich auf Ziele wie Voneinanderlernen, gegenseitige Unterstützung, Selbstmanagement, Perspektivenwechsel und die Förderung sozialer Kompetenzen eingegangen werden.
7. Vier Dimensionen des kooperativen Klassenzimmers: Dieses Kapitel beschreibt wahrscheinlich die Veränderungen in der Klassenstruktur, im Aufgabentyp, in der Lehrerrolle und in der Schülerrolle, die mit der Einführung kooperativen Lernens einhergehen. Es wird die Bedeutung dieser Veränderungen für den erfolgreichen Einsatz der Methode im Unterricht beleuchtet.
8. Verschiedene Typen kooperativer Lerngruppen: Dieses Kapitel wird vermutlich verschiedene Modelle und Organisationsformen von kooperativen Lerngruppen vorstellen und deren jeweilige Vor- und Nachteile analysieren. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der optimalen Gruppengröße und Zusammensetzung für unterschiedliche Lernziele.
9. Wie manage ich ein kooperatives Klassenzimmer?: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten des Klassenmanagements im kooperativen Unterricht. Es behandelt Themen wie Motivation, Gruppenbildung, Gruppenstärkung, den Umgang mit Konflikten und die Etablierung von Regeln und Routinen für effektive Gruppenarbeit. Es werden wahrscheinlich konkrete Methoden und Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen präsentiert.
10. Das Gruppenpuzzle: Dieses Kapitel beschreibt die Methode des Gruppenpuzzles ausführlich. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte, die Funktionsweise, die Rolle der Lehrkraft und die Wirksamkeit dieser Methode. Es wird sich auch mit den Schwächen und Grenzen des Gruppenpuzzles auseinandersetzen und möglicherweise Ergebnisse von empirischen Untersuchungen vorstellen.
11. Weitere Methoden kooperativen Lernens: Hier werden alternative Methoden des kooperativen Lernens vorgestellt und erklärt, beispielsweise Gruppenrallyes, Think-Pair-Share und das Placemat-Verfahren. Die Kapitel wird wahrscheinlich die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden im Vergleich zueinander diskutieren.
12. Kooperative Lernformen im Fremdsprachenunterricht: Dieses Kapitel wird die spezifische Anwendung kooperativer Lernmethoden im Fremdsprachenunterricht beleuchten. Es wird die besondere Bedeutung dieser Lernform für den Spracherwerb und die Entwicklung kommunikativer Kompetenz herausstellen.
13. Wie bewerte ich die Leistung der Schüler?: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden der Leistungsbewertung im kooperativen Unterricht dargestellt und analysiert. Die Bewertung der Gruppenergebnisse, des Arbeitsverhaltens und der individuellen Leistungen wird thematisiert. Es werden wahrscheinlich Methoden vorgestellt, die sowohl die Gruppenleistung als auch die individuellen Beiträge der Schüler berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Kooperatives Lernen, Gruppenarbeit, Lernmethoden, Klassenmanagement, Gruppenpuzzle, Entwicklungspsychologie, Fremdsprachenunterricht, Leistungsbewertung, Soziokonstruktivismus, Soziokulturelle Theorie, Piaget, Vygotski.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Kooperatives Lernen im Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einsatz kooperativen Lernens im Schulunterricht. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, verschiedene Methoden, deren Anwendung und Bewertung im Unterricht, sowie die Vor- und Nachteile dieser Lernform.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Theoretische Grundlagen des kooperativen Lernens, Methoden des kooperativen Lernens (inkl. Gruppenpuzzle, Think-Pair-Share, Gruppenrallye, Placemat-Verfahren), Klassenmanagement im kooperativen Unterricht, Bewertung von Gruppen- und Einzelarbeit und die Anwendung im Fremdsprachenunterricht. Die Arbeit bezieht sich auf entwicklungspsychologische Theorien von Piaget und Vygotski.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in 15 Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und Aufbau der Arbeit), Begründung kooperativen Lernens (didaktische und pädagogische Argumente), Definition und Grundprinzipien kooperativen Lernens, die fünf Grundelemente kooperativen Lernens (soziale Fertigkeiten, Interaktion, Verantwortung, Abhängigkeit, Evaluation), Relevanz entwicklungspsychologischer Theorien (Piaget und Vygotski), Lernziele kooperativen Lernens, die vier Dimensionen des kooperativen Klassenzimmers (Veränderung von Klassenstruktur, Aufgaben, Lehrer- und Schülerrolle), verschiedene Typen kooperativer Lerngruppen, Klassenmanagement im kooperativen Unterricht (Motivation, Gruppenbildung, Umgang mit Problemen), detaillierte Beschreibung der Gruppenpuzzle-Methode inkl. Wirksamkeit und Schwächen, weitere Methoden kooperativen Lernens (Gruppenrallye, Think-Pair-Share, Placemat), Anwendung im Fremdsprachenunterricht, Leistungsbewertung (Gruppenergebnisse, Arbeitsverhalten, individuelle Leistungen), Zusammenfassung und Fazit.
Welche Methoden des kooperativen Lernens werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden, darunter das Gruppenpuzzle, die Gruppenrallye (STAD), Think-Pair-Share und das Placemat-Verfahren. Jedes Verfahren wird hinsichtlich seiner Funktionsweise, Vor- und Nachteile erläutert.
Wie wird das Klassenmanagement im kooperativen Unterricht behandelt?
Der Abschnitt zum Klassenmanagement umfasst Aspekte der Motivation, Gruppenbildung, Gruppenstärkung (inkl. Interview, Gruppenname und Logo), Problemlösung (gruppenbezogene Belohnung, Zero-Noise Signal, besondere Anerkennung).
Wie wird die Leistungsbewertung im kooperativen Unterricht angesprochen?
Die Leistungsbewertung umfasst die Bewertung der Gruppenergebnisse, des Arbeitsverhaltens und der individuellen Leistungen (z.B. durch Aufsätze). Es werden Methoden vorgestellt, die sowohl die Gruppenleistung als auch individuelle Beiträge berücksichtigen.
Welche Entwicklungspsychologischen Theorien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die soziokonstruktivistische Perspektive Piagets und die soziokulturelle Perspektive Vygotskis, um den theoretischen Hintergrund für die Wirksamkeit kooperativen Lernens zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperatives Lernen, Gruppenarbeit, Lernmethoden, Klassenmanagement, Gruppenpuzzle, Entwicklungspsychologie, Fremdsprachenunterricht, Leistungsbewertung, Soziokonstruktivismus, Soziokulturelle Theorie, Piaget, Vygotski.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich für den Einsatz kooperativer Lernmethoden im Unterricht interessiert. Sie ist besonders relevant für Lehramtsstudierende, Lehrer*innen und Pädagog*innen.
- Quote paper
- Hasret Deliorman (Author), 2009, Kooperatives Lernen im Schulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135910