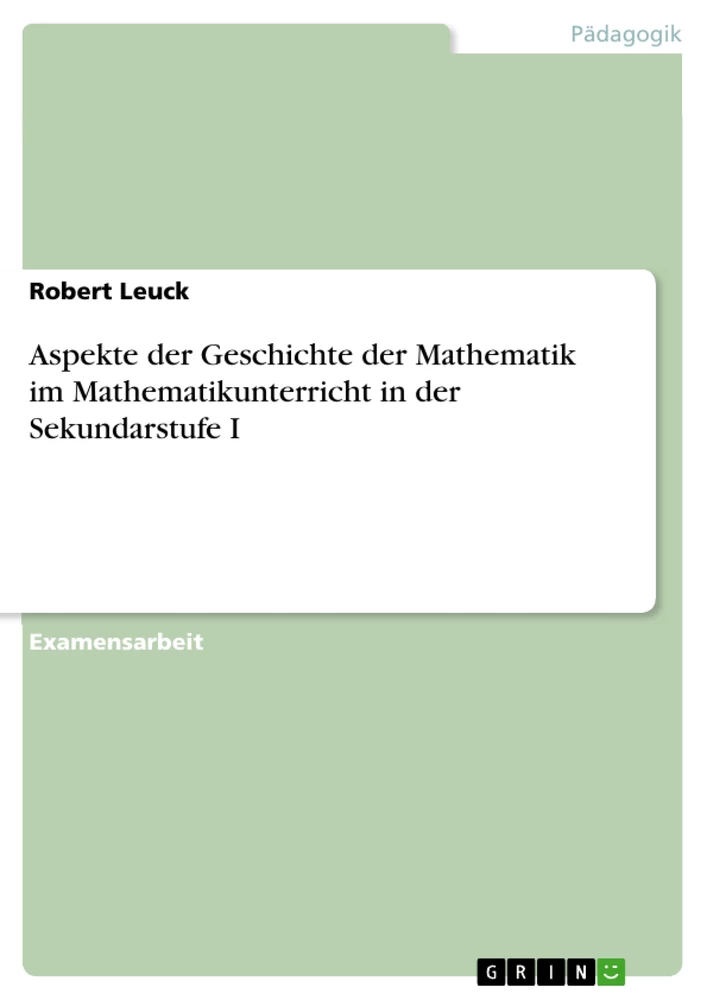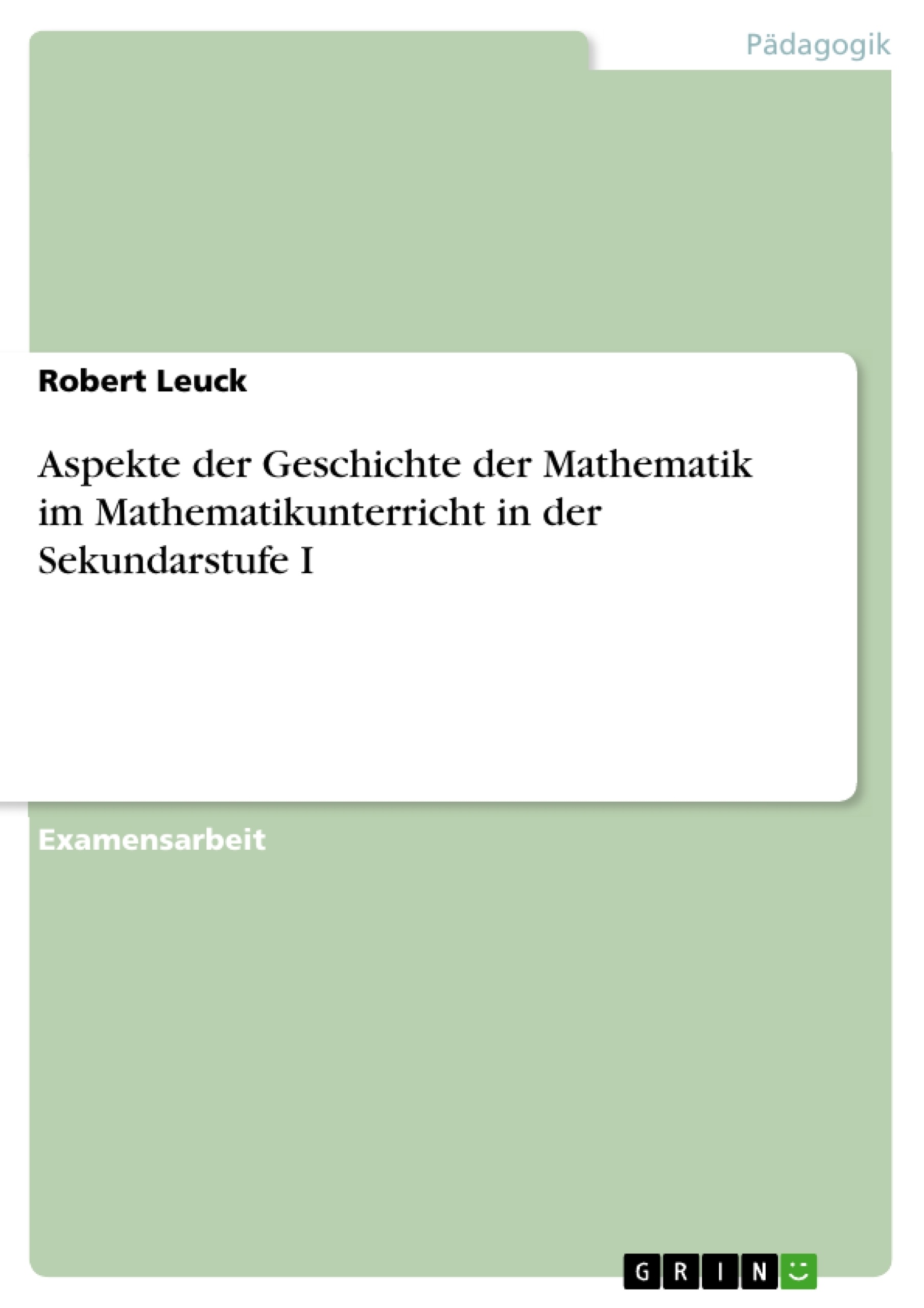Die Geschichte der Mathematik spielt im heutigen Mathematikunterricht eine untergeordnete Rolle. Zwar enthalten Schulbücher historische Anekdoten und Bezüge, Biographien und Porträts, jedoch erhalten diese bei näherer Betrachtung eher einen oberflächlichen Charakter, wenn man bedenkt, dass sowohl Schulbuch als auch Lehrkraft das Potenzial der Genese mathematischer Sachverhalte gar nicht weiter nutzen. Ein Grund mehr, nach einzelnen Fallbeispielen zu suchen, in denen Lehrer das genetische Prinzip erfolgreich anwenden und ihren Unterricht befruchtend beeinflussen. Im Bereich der Didaktik gibt es diverse Literatur, aber wenige aktuelle Monographien zum Thema, historische Bezüge innerhalb unterrichtsmathematischer Sachverhalte herzustellen, diese damit zu motivieren und in puncto Kultur und Sozialisation in einen logischen Einklang zu bringen.
Den aktuellen Hype in der Didaktik erfährt doch eher das Integrieren mathematischer Computersoftware. Das Übergewicht des Einsatzes neuer Medien im Unterricht ist wirklich merklich
auch innerhalb von Beiträgen auf Tagungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik.
Der Vergleich hinkt natürlich, denn den Computer oder den programmierbaren Taschenrechner im Mathematikunterricht einzusetzen bedeutet ja nicht, auf den historischen Ursprung des
mathematischen Gegenstandes zu verzichten, dennoch gibt es eklatante Widersprüche. Pythagoras, Ries und Leibniz hatten keinen PC zur Verfügung, auch keinen Mac oder Geräte wie
von Texas Instruments. Die Verknüpfung der Möglichkeiten, als Schüler mit Unterstützung
des Lehrers auf den Wegen der großen Mathematiker zu wandeln und dabei Fehlern und Verallgemeinerungen zu begegnen oder Grenzen und Gesetzmäßigkeiten zu präzisieren mit der
Beschleunigung und Visualisierung durch die Maschine stellt eine verlockende Herausforderung dar. Beschleunigung heißt, dass triviale Rechenleistungen vom PC oder Taschenrechner
als Rechenknecht übernommen werden. Dies kann man sich letztendlich wie kleine Zeitsprünge im Leben der Mathematiker vorstellen, die oft Jahrzehnte mit Einzelproblemen
verbrachten. Visualisierung bedeutet, dass Bilder, Zeichnungen, Abbildungen, Statistiken, Graphen, Gebilde, Figuren, Körper etc. schnell verfügbar sind, um dem Vorstellungsvermögen und der fotografischen Einsicht der Schüler entgegen zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Der Nutzen der Mathematikgeschichte in der Mathematiklehre
- 2.2 Hindernisse und Grenzen
- 2.3 Das genetische Prinzip
- 2.4 Die hermeneutische Methode
- 2.5 Das Prinzip der historischen Verankerung
- 2.6 Weitere Methoden
- 2.7 Rahmenlehrplan und Schulbücher
- 2.8 Ein Blick ins Ausland
- 3. Schulrelevante historische Themen
- 4. Konkrete Anwendungsbeispiele für die Sekundarstufe I
- 4.1 Ein genetisches Beispiel
- 4.2 Ein Beispiel der Hermeneutik
- 4.3 Ein Rollenspiel
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterrepräsentanz der Mathematikgeschichte im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I und fragt nach den Möglichkeiten einer gewinnbringenden Integration. Sie beleuchtet theoretische Grundlagen, praktische Anwendungsmöglichkeiten und die Herausforderungen bei der Umsetzung im Unterricht.
- Der Nutzen und die Möglichkeiten der Integration von Mathematikgeschichte in den Unterricht.
- Die Herausforderungen und Hindernisse bei der Integration von Mathematikgeschichte.
- Die Anwendung verschiedener didaktischer Prinzipien (genetisches Prinzip, hermeneutische Methode etc.).
- Die Berücksichtigung von Lehrplänen und Schulbüchern.
- Konkrete Anwendungsbeispiele für die Sekundarstufe I.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der untergeordneten Rolle der Mathematikgeschichte im Mathematikunterricht dar und führt in die zentrale Forschungsfrage ein: Kann Mathematikgeschichte gewinnbringend in den Mathematikunterricht integriert werden? Sie verweist auf den geringen Nutzen des vorhandenen historischen Kontextes in Schulbüchern und den Fokus auf den Einsatz von Computern im Unterricht, im Gegensatz zur Auseinandersetzung mit der Genese mathematischer Konzepte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der historischen Seite des Problems.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert den Stellenwert der Mathematikgeschichte in der Mathematikdidaktik. Es diskutiert den Nutzen, die Grenzen und die möglichen didaktischen Methoden (genetisches Prinzip, hermeneutische Methode, Prinzip der historischen Verankerung), um Geschichte im Mathematikunterricht einzusetzen. Der Einfluss von Lehrplänen und Schulbüchern sowie ein internationaler Vergleich werden ebenfalls betrachtet, um das aktuelle Verständnis und den Umgang mit der Mathematikgeschichte im Unterricht zu beleuchten.
3. Schulrelevante historische Themen: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über relevante Themen der Mathematikgeschichte für die Sekundarstufe I. Es thematisiert die Schwierigkeit für Lehrende, relevante Aspekte für den Unterricht auszuwählen und die eigene Wissensbasis zu erweitern. Der Kapitel betont die Bedeutung des historischen Hintergrunds des heutigen mathematischen Grundkanons, der größtenteils aus Errungenschaften bis zum 17. Jahrhundert besteht und dessen Bedeutung auch durch den Computereinsatz nicht geschmälert wird. Es verdeutlicht den Aufklärungsbedarf bezüglich zeitgeschichtlicher Mathematik der Moderne.
4. Konkrete Anwendungsbeispiele für die Sekundarstufe I: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele für die Anwendung von Mathematikgeschichte im Unterricht der Sekundarstufe I. Es zeigt auf, wie das genetische Prinzip, die hermeneutische Methode und Rollenspiele eingesetzt werden können, um den Unterricht zu bereichern und das Verständnis der Schüler zu fördern. Obwohl die Beispiele nur eine Auswahl darstellen, sollen sie die Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Mathematikgeschichte, Mathematikunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik der Mathematik, Genetisches Prinzip, Hermeneutische Methode, Historische Verankerung, Lehrplan, Schulbuch, Unterrichtspraxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Mathematikgeschichte im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Unterrepräsentanz der Mathematikgeschichte im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I und erforscht Möglichkeiten für eine sinnvolle Integration. Sie beleuchtet theoretische Grundlagen, praktische Anwendungen und Herausforderungen bei der Umsetzung im Unterricht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund mit Diskussion verschiedener didaktischer Prinzipien (genetisches Prinzip, hermeneutische Methode etc.), schulrelevante historische Themen, konkrete Anwendungsbeispiele für die Sekundarstufe I und eine Zusammenfassung. Zusätzlich werden Lehrpläne, Schulbücher und ein internationaler Vergleich betrachtet.
Welche didaktischen Prinzipien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert das genetische Prinzip, die hermeneutische Methode und das Prinzip der historischen Verankerung als mögliche Methoden, um Mathematikgeschichte im Unterricht einzusetzen.
Welche konkreten Beispiele für den Unterricht werden gegeben?
Die Arbeit bietet konkrete Beispiele für die Anwendung der Mathematikgeschichte im Unterricht der Sekundarstufe I, inklusive eines genetischen Beispiels, eines Beispiels zur Hermeneutik und eines Rollenspiels. Diese Beispiele sollen die Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung veranschaulichen.
Welche Herausforderungen werden bei der Integration von Mathematikgeschichte im Unterricht genannt?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten für Lehrende, relevante historische Aspekte auszuwählen und die eigene Wissensbasis zu erweitern. Sie spricht den geringen Nutzen des vorhandenen historischen Kontextes in Schulbüchern an und den Mangel an Auseinandersetzung mit der Genese mathematischer Konzepte im Vergleich zum Fokus auf Computereinsatz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Schulrelevante historische Themen, Konkrete Anwendungsbeispiele für die Sekundarstufe I, Zusammenfassung und Literaturverzeichnis. Der Theoretische Hintergrund beinhaltet detailliertere Unterkapitel zu den verschiedenen Methoden und Aspekten der Integration.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mathematikgeschichte, Mathematikunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik der Mathematik, Genetisches Prinzip, Hermeneutische Methode, Historische Verankerung, Lehrplan, Schulbuch, Unterrichtspraxis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Nutzen und die Möglichkeiten der Integration von Mathematikgeschichte in den Mathematikunterricht aufzuzeigen, die Herausforderungen und Hindernisse zu beleuchten und konkrete Anwendungsmöglichkeiten für die Sekundarstufe I zu präsentieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte der Sekundarstufe I, Mathematikdidaktiker, Lehramtsstudierende und alle, die sich mit der Verbesserung des Mathematikunterrichts beschäftigen.
- Quote paper
- Robert Leuck (Author), 2008, Aspekte der Geschichte der Mathematik im Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135020