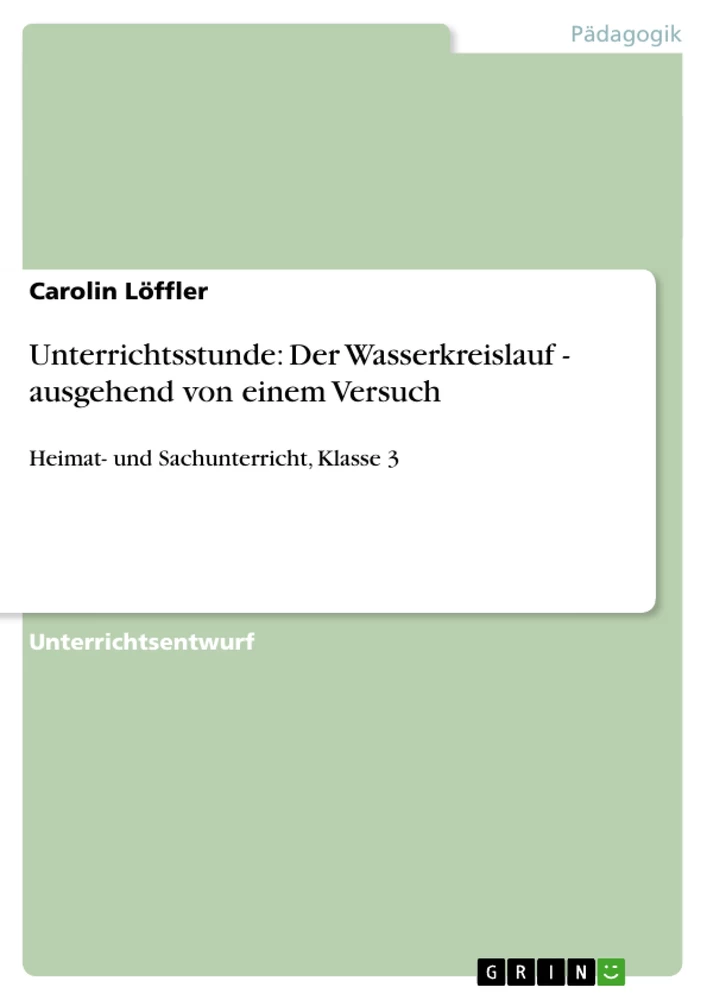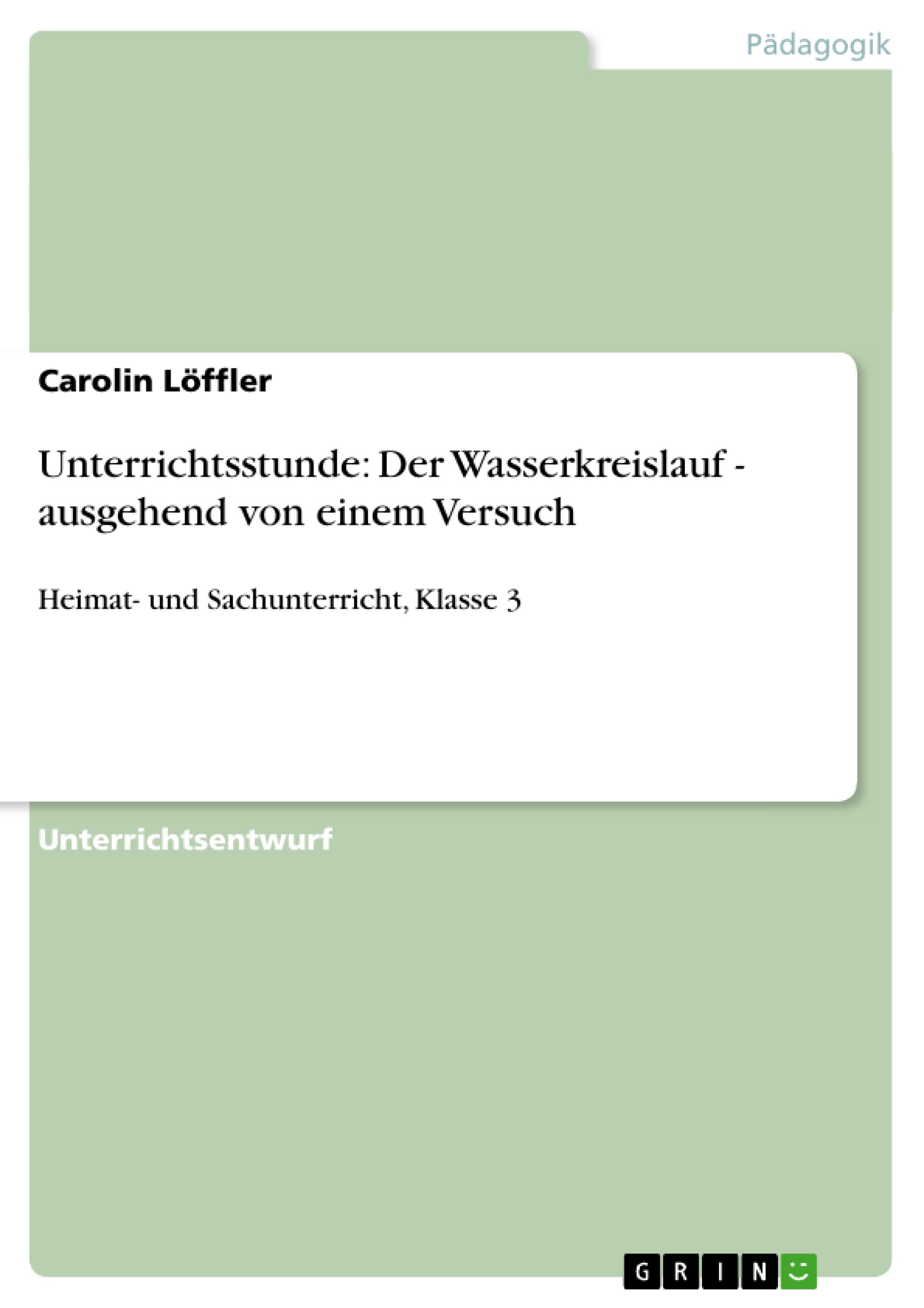Einstieg:
Nach der Begrüßung bitte ich die Kinder mit einem nonverbalen Zeichen in den Sitzkreis. Diese Sozialform ist dafür gut geeignet, da sie Gesprächsbereitschaft signalisiert.
Die SchülerInnen hören nun die Geschichte von Plitsch, dem Wassertropfen. Plitsch durchlebt den Wasserkreislauf von einer Wolke bis zum Eintreffen im Meer. Bevor er durch die Sonnenstrahlen verdunstet, endet die Geschichte. Die Kinder sollen den Inhalt nacherzählen und Vermutungen über den weiteren Verlauf anstellen. Somit können sie ihr Vorwissen einbringen. Durch diesen Einstieg werden die Kinder emotional angesprochen und dadurch motiviert und interessiert.
Erarbeitung I:
Die Kinder sollen daran anschließend in Gruppen einen Versuch zum Wasserkreislauf durchführen, bei dem das Verdampfen, das Kondensieren und das Regnen zu beobachten ist. Dabei wird ein Glas mit etwas Wasser gefüllt und dann über eine Kerze gehalten. Nach einiger Zeit kann man den Wasserdampf sehen. Hält man nun die gekühlte Kelle darüber, wird das Wasser daran wieder in kleinen Tropfen sichtbar, es kondensiert. Die Tropfen werden größer, bis sie dann heruntertropfen.
Da die Kinder bei dem Versuch mit einer Kerze arbeiten, gebe ich zu Beginn Sicherheitshinweise.
Danach bekommen die Kinder als Forschergruppen den Auftrag, ihre Vermutungen zu notieren, den Versuch durchzuführen und schließlich ihre Beobachtungen aufzuschreiben. Die Gruppen erhalten eine Kiste, in der sie alle Arbeitsmaterialien finden.
Falls eine Gruppe früher fertig ist, bekommt sie von mir noch den Auftrag, die beobachteten Phänomene in ihrem Alltag wiederzufinden.
Ich habe diesen Versuch ausgewählt, da er sehr viele einzelne Elemente zeigt, die für das Verstehen des Wasserkreislaufs wichtig sind. Möglich wäre auch, verschiedene Gruppen verschiedene Versuche durchführen zu lassen, die sie anschließend den anderen präsentieren. Dadurch hätten die Kinder aber immer nur einen kleinen Ausschnitt des Kreislaufs beobachten können (z.B. nur Verdunstung oder nur Kondensation) und die Übertragung auf die Natur wäre schwieriger.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sachanalyse
- 2. Einordnung in die Unterrichtseinheit
- 1. Was gehört zum Wetter dazu?
- 2. Wettervorhersage und –symbole
- 3. Thermometer: Funktionsweise, Nachbau, Ablesen und Einzeichnen von Temperaturen
- 4. Wettertagebuch
- 5. Lied: Das Wetter
- 6. Wind: Entstehung, Stärken, Bauen eines Windmessers
- 7. „Wetter im Schuhkarton“
- 8. Versuche zum Verdunsten und Kondensieren
- 9. Der Wasserkreislauf
- 10. Verschiedene Niederschläge
- 11. Gewittermusik
- 12. Wolkenformen
- 13. Test
- 3. Didaktische Analyse
- 4. Methodische Analyse
- 5. Bildungsplanbezug
- 6. Lernziele
- 7. Verlaufsplan
- 8. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert eine Unterrichtsstunde zum Thema Wasserkreislauf in der dritten Klasse. Ziel ist es, den Schülern den Wasserkreislauf durch einen selbst durchgeführten Versuch verständlich zu machen und das Verständnis für globale Zusammenhänge in der Natur zu fördern. Der experimentelle Ansatz soll das forschend-entdeckende Lernen unterstützen.
- Der Wasserkreislauf als naturwissenschaftliches Phänomen
- Verdunstung, Kondensation und Niederschlag als Teilprozesse
- Übertragung von Versuchsergebnissen auf natürliche Prozesse
- Förderung des experimentellen Lernens
- Zusammenhänge zwischen Wetterphänomenen und dem Wasserkreislauf
Zusammenfassung der Kapitel
1. Sachanalyse: Dieser Abschnitt liefert eine wissenschaftliche Definition des Wetters und betont die zentrale Rolle des Wassers in seinen verschiedenen Aggregatzuständen. Der Wasserkreislauf wird als ständiger Prozess von Verdunstung, Kondensation, Wolkenbildung, Niederschlag und Abfluss beschrieben. Die Rolle der Sonne bei der Verdunstung und die Abkühlung der Luft beim Aufsteigen werden detailliert erläutert, ebenso wie die verschiedenen Niederschlagsformen und das Schicksal der Wassertropfen nach dem Niederschlag. Der Text veranschaulicht die Kreislaufstruktur mit Bezug auf Abbildung 1.
2. Einordnung in die Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel ordnet die Stunde zum Wasserkreislauf in den Gesamtkontext der Unterrichtseinheit "Wetter" ein. Es listet die vorangegangenen und folgenden Unterrichtseinheiten auf, die sich mit verschiedenen Aspekten des Wetters beschäftigen, wie z.B. Wettervorhersagen, Thermometer, Wind und Wolkenbildung. Die Stunde zum Wasserkreislauf bildet einen wichtigen Bestandteil im Verständnis des Gesamtsystems Wetter.
3. Didaktische Analyse: Hier wird die Bedeutung des Themas Wetter für Kinder hervorgehoben, indem der direkte Einfluss von Wetterphänomenen auf das alltägliche Leben und die emotionalen Reaktionen der Kinder betont werden. Die Bedeutung des bewussten Wahrnehmens, Hinterfragens und Erklärens von Wetterbeobachtungen wird unterstrichen. Der Wasserkreislauf wird als Grundlage für das Verständnis von Wolken- und Niederschlagsbildung dargestellt, und es wird die Möglichkeit gezeigt, globale Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die Wichtigkeit des Experimentierens wird im Hinblick auf das weitere Schulleben der Schüler betont.
4. Methodische Analyse: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert den Ablauf der Unterrichtsstunde, beginnend mit einem erzählerischen Einstieg über die Geschichte eines Wassertropfens, gefolgt von einem Gruppenversuch zum Wasserkreislauf. Die einzelnen Phasen des Unterrichts – Erarbeitung I und II, Ergebnissicherung und Abschluss – werden mit den verwendeten Sozialformen und Medien ausführlich erklärt. Es wird auf die Sicherheitsaspekte des Experiments hingewiesen, und es wird dargelegt, warum die gewählte Methode der Durchführung des Experiments für das Verständnis des Wasserkreislaufes besonders geeignet ist.
5. Bildungsplanbezug: Dieser Teil verweist auf die Relevanz der Stunde im Kontext des baden-württembergischen Bildungsplans. Die Leitgedanken zum Kompetenzerwerb, didaktische Hinweise und Prinzipien werden zitiert und mit den Lernzielen der Stunde in Verbindung gebracht. Konkrete Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans, die in der Stunde adressiert werden, werden explizit genannt. Das verbindliche Experiment zum Wasserkreislauf wird ebenfalls erwähnt.
6. Lernziele: Dieser Abschnitt definiert das Grobziel der Stunde und listet detailliert die Feinziele auf. Die Feinziele beschreiben die konkreten Fähigkeiten und Kenntnisse, die die Schüler am Ende der Stunde erworben haben sollen. Sie umfassen das Zuhören, Nacherzählen, Vermutungen anstellen, Experimentieren, Beobachten, Dokumentieren, Beschreiben, Einordnen und Darstellen des Wasserkreislaufs.
7. Verlaufsplan: Der Verlaufsplan gibt einen detaillierten Zeitplan der Unterrichtsstunde an, einschließlich der einzelnen Phasen (Einstieg, Erarbeitung I und II, Ergebnissicherung, Abschluss), der Sozialformen und der verwendeten Medien. Die Zeiteinteilung ist präzise angegeben und gibt ein klares Bild vom Ablauf der Stunde.
Schlüsselwörter
Wasserkreislauf, Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, Wetter, Experiment, Didaktik, Methodik, Bildungsplan, Grundschule, Aggregatzustände, Wolkenbildung, Naturwissenschaften, Forschendes Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsplanung "Wasserkreislauf"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Unterrichtsplanung für eine Stunde zum Thema Wasserkreislauf in der dritten Klasse. Es beinhaltet eine Sachanalyse, die Einordnung in eine Unterrichtseinheit zum Thema Wetter, didaktische und methodische Analysen, den Bezug zum Bildungsplan, Lernziele, einen Verlaufsplan, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Unterricht behandelt?
Der Unterricht behandelt den Wasserkreislauf als naturwissenschaftliches Phänomen, mit Fokus auf Verdunstung, Kondensation und Niederschlag. Es werden die Zusammenhänge zwischen Wetterphänomenen und dem Wasserkreislauf erläutert und durch einen selbst durchgeführten Versuch veranschaulicht.
Wie ist der Unterricht aufgebaut?
Der Unterricht gliedert sich in verschiedene Phasen: einen erzählerischen Einstieg, einen Gruppenversuch zum Wasserkreislauf (Erarbeitung I und II), Ergebnissicherung und einen Abschluss. Die methodische Analyse beschreibt detailliert den Ablauf und die verwendeten Sozialformen und Medien.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Die Lernziele umfassen das Verständnis des Wasserkreislaufs, das Beobachten und Dokumentieren von Vorgängen, das Experimentieren und das Anwenden des Wissens auf natürliche Prozesse. Konkrete Feinziele beschreiben die zu erwerbenden Fähigkeiten und Kenntnisse detailliert.
Welchen Bezug hat der Unterricht zum Bildungsplan?
Das Dokument verweist explizit auf die Relevanz der Stunde im Kontext des baden-württembergischen Bildungsplans. Es werden die adressierten Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans genannt.
Welche Materialien/Medien werden im Unterricht verwendet?
Der Verlaufsplan listet die für jede Phase des Unterrichts verwendeten Medien und Sozialformen auf. Ein wichtiges Element ist der selbst durchgeführte Versuch zum Wasserkreislauf.
Wie wird der Wasserkreislauf im Unterricht veranschaulicht?
Der Wasserkreislauf wird durch einen selbst durchgeführten Gruppenversuch veranschaulicht. Die methodische Analyse beschreibt die Durchführung des Experiments im Detail und begründet die Wahl dieser Methode.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wasserkreislauf, Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, Wetter, Experiment, Didaktik, Methodik, Bildungsplan, Grundschule, Aggregatzustände, Wolkenbildung, Naturwissenschaften, Forschendes Lernen.
Welche Kapitel sind in der Unterrichtsplanung enthalten?
Die Unterrichtsplanung umfasst Kapitel zur Sachanalyse, Einordnung in die Unterrichtseinheit, didaktische und methodische Analyse, Bildungsplanbezug, Lernziele, Verlaufsplan und Literaturangaben.
Wo finde ich weitere Informationen zur Unterrichtseinheit "Wetter"?
Weitere Informationen zur gesamten Unterrichtseinheit "Wetter" sind im Kapitel "Einordnung in die Unterrichtseinheit" zu finden. Dieses Kapitel listet die vorangegangenen und folgenden Unterrichtseinheiten auf.
- Quote paper
- Carolin Löffler (Author), 2008, Unterrichtsstunde: Der Wasserkreislauf - ausgehend von einem Versuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/134922