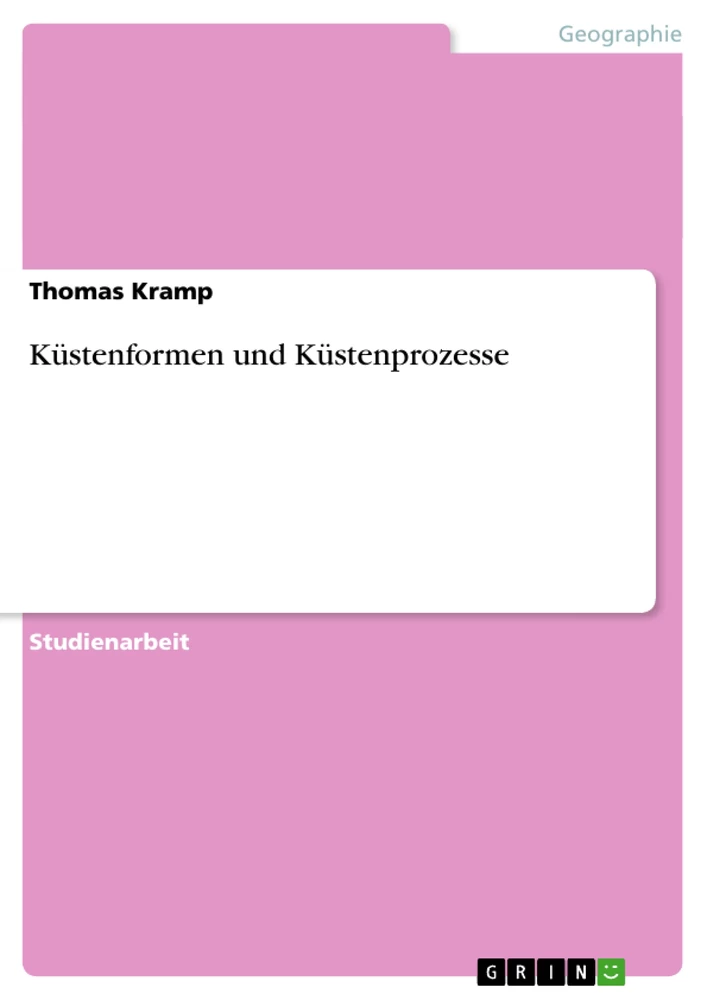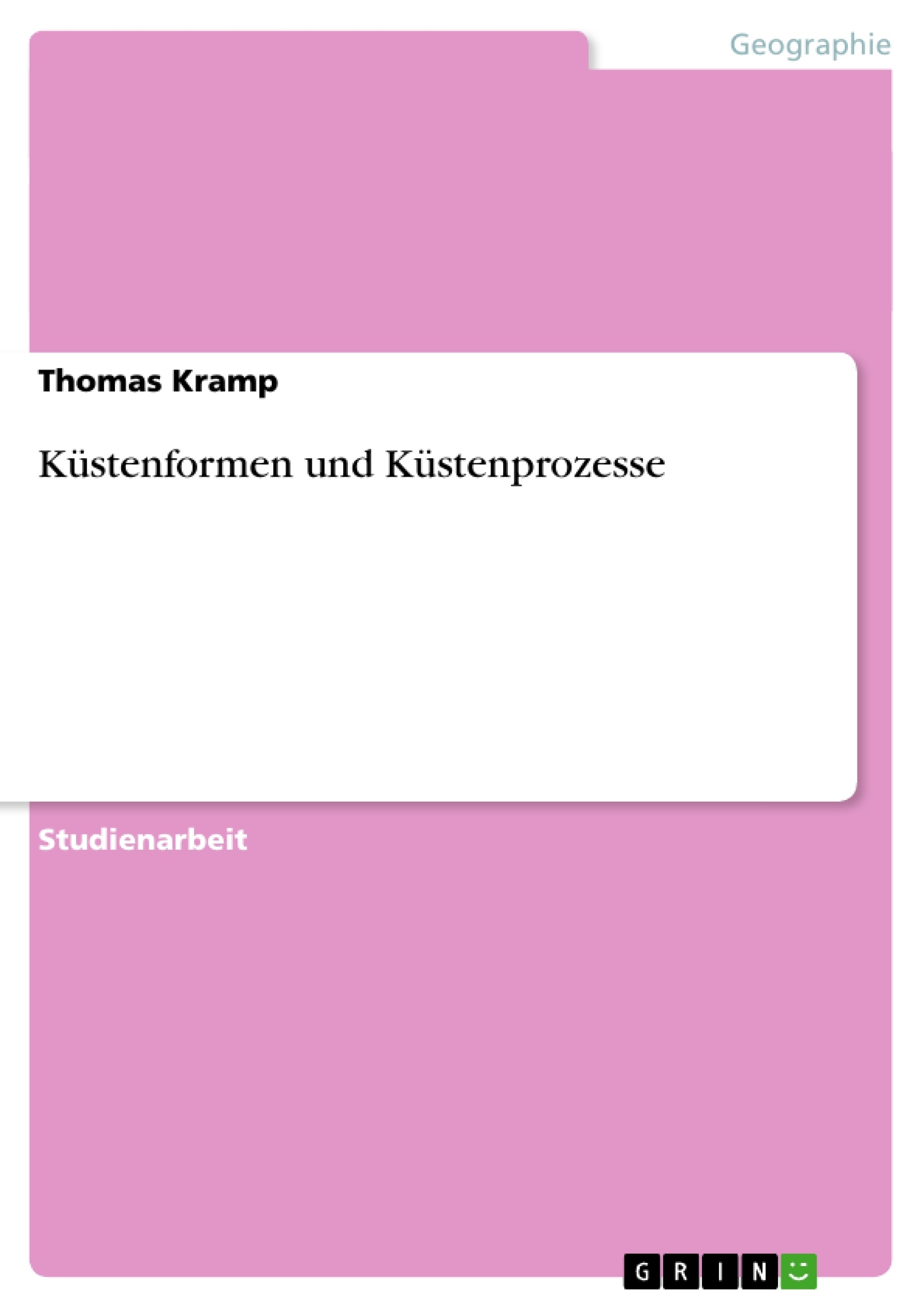Thema der folgenden Belegarbeit sind Küstenformen und Küstenprozesse, wie sie an den
deutschen Küsten der Nord- und Ostsee zu finden sind. Aus diesem Grunde wird auf Küstenformen
wie die Mangrovenküste oder die Korallenküste und die sie formenden Prozesse, nicht
näher eingegangen.
Küstenprozesse werden im Weiteren als Prozesse verstanden, welche bestimmte Küstenformen
hervorbringen und nicht nur einzelne Elemente der Küste, wie z.B. Dünen, beeinflussen.
Es handelt sich somit um die wesentlichen, die Küste gestaltenden, Kräfte (Kelletat;
1999; S. 98).
In der Einleitung soll die, dieser Arbeit zugrunde liegende, Definition des Begriffs Küste vorgestellt
werden. Außerdem wird die Küstenklassifikation nach H. Valentin erläutert, da sich
diese, mit ihrer Unterteilung der Prozesse und Küstenformen nach Meeresspiegelschwankungen,
Zerstörungs- und Aufbauvorgänge in der Gliederung der Arbeit wiederfindet.
Die Gliederung ist außerdem am Aufbau des Buches „Physische Geographie der Meere und
Küsten“ von D. Kelletat angelehnt.
Im zweiten Teil der Arbeit werden dann die Küstenformen der deutschen Nord- und Ostseeküste
und die für sich ursächlichen Prozesse beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis:
1. Einleitung
1.1. Definition des Begriffs Küste
1.2. Klassifikation der Küstenformen
2. Küstenprozesse
2.1 Brandungswellen
2.1.1 Strandversetzung
3. Küstenformen
3.1. Meeresspiegelschwankungen
3.1.1. kurzfristige Oszillation
3.1.1.1. Ästuare
3.1.1.2. Watten
3.1.2. langfristige Oszillation
3.1.2.1. Boddenküste
3.1.2.2. Fördenküste
3.2. Zerstörungsprozesse
3.2.1. Steilküste und Kliff
3.3. Aufbauvorgänge
3.3.1. Strände
3.3.2. Nehrungen und Haken
3.3.3. Ausgleichsküste
3.3.4. die deutschen Inseln
4. Küstenformen & -prozesse am Beispiel von Rügen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Terminologie im Küstenbereich
Abbildung 2: Schema der Küstenentwicklung nach Valentin
Abbildung 3: Küstenklassifikation nach Valentin
Abbildung 4: Kreisförmige Bewegung der Wellenteilchen
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Brandung
Abbildung 6: Vorgang der Strandversetzung
Abbildung 7: Schematisches Diagramm von Ästuarmäandern
Abbildung 8: Schematische Darstellung des isostatischen Ausgleichs
Abbildung 9: Eisgeprägte Ingressionsküste – die Boddenküste
Abbildung 10: Eisgeprägte Ingressionsküste – die Fördenküste
Abbildung 11: Entwicklung einer Steilküste
Abbildung 12:Formelemente der Kliffküste
Abbildung 13: litorale Serie der Kliffküste
Abbildung 14: litorale Serie der Lockermaterialküste
Abbildung 15: Veränderung der Insel Spiekeroog
Abbildung 16: Schematische Darstellung von Haken, Nehrung und Ausgleichsküste
1. Einleitung
Thema der folgenden Belegarbeit sind Küstenformen und Küstenprozesse, wie sie an den deutschen Küsten der Nord- und Ostsee zu finden sind. Aus diesem Grunde wird auf Küsten-formen wie die Mangrovenküste oder die Korallenküste und die sie formenden Prozesse, nicht näher eingegangen.
Küstenprozesse werden im Weiteren als Prozesse verstanden, welche bestimmte Küsten-formen hervorbringen und nicht nur einzelne Elemente der Küste, wie z.B. Dünen, beein-flussen. Es handelt sich somit um die wesentlichen, die Küste gestaltenden, Kräfte (Kelletat; 1999; S. 98).
In der Einleitung soll die, dieser Arbeit zugrunde liegende, Definition des Begriffs Küste vor-gestellt werden. Außerdem wird die Küstenklassifikation nach H. Valentin erläutert, da sich diese, mit ihrer Unterteilung der Prozesse und Küstenformen nach Meeresspiegel-schwankungen, Zerstörungs- und Aufbauvorgänge in der Gliederung der Arbeit wiederfindet. Die Gliederung ist außerdem am Aufbau des Buches „Physische Geographie der Meere und Küsten“ von D. Kelletat angelehnt.
Im zweiten Teil der Arbeit werden dann die Küstenformen der deutschen Nord- und Ostsee-küste und die für sich ursächlichen Prozesse beschrieben.
1.1. Definition des Begriffs Küste
Für den Terminus Küste gibt es zahlreiche Definitionen (Gierloff-Emden; 1980; S. 981).
Nach H. Valentin kann die Küste als das Gebiet zwischen der obersten landwärtigen und der untersten seewärtigen Brandungswirkung verstanden werden (Kelletat; 1999; S. 85). Dieser Bereich ist aber nicht nur durch die unterschiedlichen Wasserstände gekennzeichnet, sondern ragt darüber hinaus (ebd.; S. 84). Der Raum wird landwärts bezeichnet durch die Reichweite des Einflusses von Salzwasserspritzern oder –spray und den daraus folgenden morpho-logischen und ökologischen Bedingungen, wie z.B. einer bestimmten Vegetationsbedeckung (ebd.; S. 85). Seewärts erstreckt sich dieser Bereich über den Raum, in welchem durch die Brandungswirkung unter Wasser, spezielle Formen auf dem küstennahen Meeresboden ge-schaffen werden (ebd.; S. 85). Dies ist bis zu einer Wassertiefe, welche der halben Wellen-länge, d. h. dem Abstand von Wellenkamm zu Wellenkamm (Ahnert; 2003; S. 395), des Küstenabschnitts entspricht, der Fall (Kelletat; 1999; S. 85).
Da der Meeresspiegel, bspw. aufgrund seismischer oder tektonischer Ursachen, immer wieder Veränderungen unterworfen ist (ebd.), sollte die Küstenmorphologie sich nicht nur auf gegenwärtige Küsten beschränken (ebd.), sondern auch vorzeitliche Küstenformen ein-beziehen (ebd.). Dieser Gesamtbereich wird nach H. Valentin als Küstengebiet definiert. Die nachfolgende Abbildung soll die Definition der Küste bzw. des Küstengebietes, noch einmal verdeutlichen. Im weiteren wird die sich aber auf den Bereich der Küste beschränkt.
Abbildung 1: Terminologie im Küstenbereich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2. Klassifikation der Küstenformen
International hat die hierarchisch aufgebaute (Ahnert; 2003; S. 384) Klassifikation nach Valentin die weiteste Anerkennung gefunden (Kelletat; 1999; S. 202).
Sie ist die einzige, lückenlos auf alle bekannten Küsten anwendbare, Klassifikation (Ahnert; 2003; S. 384), welche sowohl den Zustand der Küste, als auch die geomorphologischen Prozesse identifiziert (ebd.).
Nach Valentin wirken auf die Küste zwei wesentliche Prozesssysteme ein (Ahnert; 2003; S. 384). Die Vertikalbewegungen des Meeresspiegels bzw. des Landes, die ein auf- oder unter-tauchen der Küste bewirken (ebd.) und die Arbeit der Gezeiten, Wellen und Strömungen, welche die Küste entweder abtragen und dadurch zurückverlegen oder durch Ablagerungen die Küste vorrücken lassen (ebd.; S. 385). Diese Unterteilung ist der unmittelbaren Bindung der litoralen Formgebung an das Meeresniveau (ebd.; S. 381) geschuldet. Jede Veränderung des Meeresspiegels bewirkt eine vertikale (ebd.), meist auch horizontale (ebd.), Veränderung der Küstenlage (ebd.). Dies führt dazu, dass die Formenentwicklung der Küste in der neuen Position von vorne beginnen muss (ebd.). Die folgende Abbildung soll das Schema der Klassifikation verdeutlichen.
Abbildung 2: Schema der Küstenentwicklung nach Valentin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Ahnert; 2003; S. 384)
Um eine Küstenform einzuordnen, wird zunächst eine Unterteilung nach vorgerückten, d.h. seewärts verschobenen Küsten (Kelletat; 1999; S. 202), und zurückweichenden Küsten vor-genommen (ebd.). Alle Küstenformen lassen sich in einer der beiden Kategorien einordnen (ebd.). Aufgrund des postglazialen Anstiegs des Meeresspiegels (Ahnert; 2003; S. 385), ge-hören die meisten Küsten der Welt zu den zurückgewichenen Küsten (ebd.). Auf diese grund-sätzliche Unterscheidung bauen weitere wie aufgetauchte Küsten oder untergetauchte Küsten auf (Kelletat; 1999; S. 202). Die Systematik bzw. die hierarchische Ordnung (ebd.; S. 204) der Klassifikation nach Valentin soll die folgende Abbildung noch einmal darstellen.
Abbildung 3: Küstenklassifikation nach Valentin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Ahnert; 2003; S. 386)
Die ersten beiden Ebenen ergeben sich direkt aus dem Schema (vgl. hierzu Abbildung 2) der Küstenentwicklung nach H. Valentin (Ahnert; 2003; S. 386), die weiteren beziehen sich auf Prozesssysteme und Strukturen (ebd.). Meist sind mehrere Hauptvorgänge wie Transgression und Akkumulation an der Formgebung der Küste beteiligt und führen zu einer engen Ver-gesellschaftung der Formen (Kelletat; 1999; S. 132).
2. Küstenprozesse
Von besonderer Bedeutung für die Küstenform sind neben den Gezeiten (Kellertat; 1999; S. 87) auch die Brandungswellen (ebd.; S. 90) und die dadurch entstehende Strandversetzung (ebd.; S: 139). Gezeiten und Brandung sind Einflussgrößen bzw. Elemente der maßgeblichen Küstenprozesse wie Meeresspiegelschwankungen, Aufbau- und Zerstörungsprozesse (Kell-etat; 1999; S. 98).
Die Entstehung der Gezeiten wurde bereits im Seminar hinreichend erläutert, aus diesem Grunde wird unter 2.1.2 nur die Entstehung und Wirkung von Brandungswellen beschrieben. Die Küstengestalt im Detail abhängig (Wilhelmy; 1992; S. 109) von der Widerstandsfähigkeit des Gesteins (ebd.), der Wellenenergie (ebd.) und dem Klima (ebd.).
Widerständiges Gestein fördert bspw. die Entstehung steiler Kliffe (ebd.), der Niederschlag, als Klimafaktor, bestimmt z.B. den Materialtransport von Festland zum Meer (Kelletat; 1999; S. 91).
2.1 Brandungswellen
Brandungswellen entstehen, wenn ein Wellenzug im flachen Wasser den Punkt erreicht, an dem die vertikale Kreisbewegung der Wasserteilchen (Strahler; 2002; S. 437) durch Reibung am Boden behindert wird (ebd.; S. 438).
Abbildung 4: Kreisförmige Bewegung der Wellenteilchen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Strahler; 2002; S. 437)
Dies ist in etwas ab einer Wassertiefe, welche der Hälfte der Wellenlänge entspricht, der Fall (ebd.). Bei den sich dem Ufer nährenden Wellen verkürzt sich dabei die Wellenlänge (ebd.), während die Höhe der Wellen zunimmt (ebd.), bis der Wellenkamm instabil wird und zu-sammenbricht (Ahnert; 2003; S. 397). Je nach Bodengefälle erfolgt das Brechen der Welle auf verschiedene Weise (ebd.). Die daraus resultierende Bewegung, der Wellenauflauf, verursacht auf dem Strand eine landwärts gerichtete Bewegung des Sedimentes (Strahler; 2002; S. 438). Wenn die Bewegungsenergie verbraucht ist, kehrt sich die Fließbewegung um (ebd.), nimmt Sand und Kies seewärts mit sich (ebd.), wobei das Transportvermögen dieses Wellenrücklaufs kleiner ist (Ahnert; 2003; S. 398).
Sedimentation erfolgt dadurch, dass die Sedimentfracht beim Kippen der Wasserbewegung abgelagert wird (Ahnert; 2003; S. 398). Das Wasser erlangt die für die Erosion nötige Ge- schwindigkeit aber erst, nachdem es bereits von der Ablagerungsstelle zurückgeflossen ist (ebd.). Die Bewegung des Wassers beim Brechen von Sturmwellen übt dagegen eine starke Erosionswirkung aus (Strahler; 2002; S. 438). Erosion erfolgt hierbei dadurch, dass Sturm-wellen, aufgrund ihrer größeren Steilheit und kürzeren Wellenlänge (Ahnert; 2003; S. 398), näher ans Ufer gelangen (ebd.; S. 399) und dadurch mehr Material bewegen können (ebd.).
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Brandung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.1 Strandversetzung
Durch schräg auflaufende Wellen (Gierloff-Emden; 1980; S. 1139), werden Sedimentpartikel diagonal den Strand hinaufbefördert (Wilhelmy; 1992; S. 112). Der anschließende Wellen-rückstrom folgt jedoch dem größten Gefälle (ebd.) der Strandböschung (Ahnert; 2003; S. 402). Dadurch wird das Wasser und dessen Sedimentfracht senkrecht den Strand hinunter geführt (Wilhelmy; 1992; S. 112). Ein Sand- oder Kiespartikel welcher der von der Welle bewegt und nicht abgelagert wird (Ahnert; 2003; S. 402), folgt daher der Vor- und Rück-bewegung der transportierenden Wellen in einer Zickzackbahn (ebd.). Durch diese Bewegung wird das Material längs des Strands versetzt (Wilhelmy; 1992; S. 113). Bei relativ konstanter Windrichtung verläuft die Versetzung mehr oder minder in die gleiche Richtung (ebd.), wobei der Versatz der Partikel 1m bis 25 m pro Tag betragen kann (Gierloff-Emden; 1980; S. 1139).
Abbildung 6: Vorgang der Strandversetzung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Wilhelmy; 1992; S. 113)
3. Küstenformen
3.1. Meeresspiegelschwankungen
Meeresspiegelschwankungen sind sowohl kurzfristige Oszillationen des Meeresspiegels bspw. Gezeiten (Kelletat; 1999; S. 98), als auch langfristige Schwankungen (ebd.) wie der Meeresanstieg durch eine Warmzeit. Hier wäre die Flandrische Transgression zu nennen, welche die gegenwärtige Küstenformung weltweit beeinflusste (Ahnert; 2003; S. 381).
Das frühere Relief in welches das Meer vordringt beeinflusst entscheidend die marinen Prozesse und die entstehenden Küstenformen (Hendl, Liedtke; 2002; S. 209). So können sich Wattküsten im Tidebereich überfluteter flachreliefierter Tiefländer bilden (ebd.). Rias- oder Fjordküsten sind dagegen an zertalte Gebirgsbereiche gebunden (ebd.).
3.1.1. kurzfristige Oszillation
Der Begriff kurzfristige Oszillation bezieht sich auf die Wirkung der Gezeiten. An den deutschen Küsten sind durch die Wirkung der Gezeiten zwei Küstentypen entstanden, Ästuare und Watten (Wilhelmy; 1992; S. 114), welche in ihrer Existenz ursächlich an die Gezeiten gebunden sind (ebd.).
3.1.1.1. Ästuare
Im Allgemeinen werden unter Ästuaren Buchten oder erweiterte Flussmündungen verstanden, welche vom Festland Süßwasserzufuhr haben (Gierloff-Emden; 1980; S. 1062). Der Grund-riss der Flussmündungen im Gezeitenbereich, wird durch die Seitenerosion der Tidenströme trichterförmig erweiter (Ahnert; 2003; S. 391).
Das Meerwasser dringt durch die Gezeiten in das Süßwasserbecken oder Kanal ein (Gierloff-Emden; 1980; S. 1062), dabei kommt es zur Mischung von Süß- und Salzwasser (ebd.), wobei das für den Ästuar charakteristische Brackwasser erzeugt wird (Ahnert; 2003; S. 391).
Häufig gestellte Fragen zum Inhalt der Sprachvorschau
Was ist das Thema dieser Sprachvorschau?
Das Thema dieser Sprachvorschau sind Küstenformen und Küstenprozesse, insbesondere an den deutschen Küsten der Nord- und Ostsee.
Was sind Küstenprozesse im Kontext dieser Arbeit?
Küstenprozesse werden als Prozesse verstanden, welche bestimmte Küstenformen hervorbringen und nicht nur einzelne Elemente der Küste beeinflussen. Es handelt sich um die wesentlichen, die Küste gestaltenden, Kräfte.
Welche Küstenklassifikation wird in der Arbeit hauptsächlich verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Küstenklassifikation nach H. Valentin, welche Prozesse und Küstenformen nach Meeresspiegelschwankungen, Zerstörungs- und Aufbauvorgängen unterteilt.
Was beinhaltet die Definition des Begriffs "Küste" laut dieser Arbeit?
Die Küste wird als das Gebiet zwischen der obersten landwärtigen und der untersten seewärtigen Brandungswirkung verstanden. Dieser Bereich wird landwärts durch den Einfluss von Salzwasserspritzern und seewärts durch die Brandungswirkung auf dem Meeresboden begrenzt.
Was sind die zwei wesentlichen Prozesssysteme, die nach Valentin auf die Küste wirken?
Die Vertikalbewegungen des Meeresspiegels bzw. des Landes (die ein Auf- oder Untertauchen der Küste bewirken) und die Arbeit der Gezeiten, Wellen und Strömungen (welche die Küste entweder abtragen oder durch Ablagerungen vorrücken lassen).
Welche Rolle spielen Brandungswellen bei der Küstenformung?
Brandungswellen entstehen, wenn ein Wellenzug im flachen Wasser durch Reibung am Boden behindert wird. Sie verursachen Erosion und Sedimentation und beeinflussen die Strandversetzung.
Was versteht man unter Strandversetzung?
Strandversetzung ist der diagonale Transport von Sedimentpartikeln den Strand hinauf durch schräg auflaufende Wellen, gefolgt vom senkrechten Rückstrom des Wassers, was zu einer Zickzackbewegung und einer Versetzung des Materials längs des Strandes führt.
Welche Arten von Meeresspiegelschwankungen werden unterschieden?
Es werden kurzfristige Oszillationen des Meeresspiegels (z.B. Gezeiten) und langfristige Schwankungen (z.B. Meeresanstieg durch Warmzeiten) unterschieden.
Welche Küstentypen sind an den deutschen Küsten durch die Wirkung der Gezeiten entstanden?
Ästuare und Watten sind Küstentypen, die an den deutschen Küsten durch die Wirkung der Gezeiten entstanden sind.
Was sind Ästuare?
Ästuare sind Buchten oder erweiterte Flussmündungen, welche vom Festland Süßwasserzufuhr haben und in denen es zur Mischung von Süß- und Salzwasser kommt, wobei das Brackwasser entsteht.
- Arbeit zitieren
- Thomas Kramp (Autor:in), 2007, Küstenformen und Küstenprozesse, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/134787