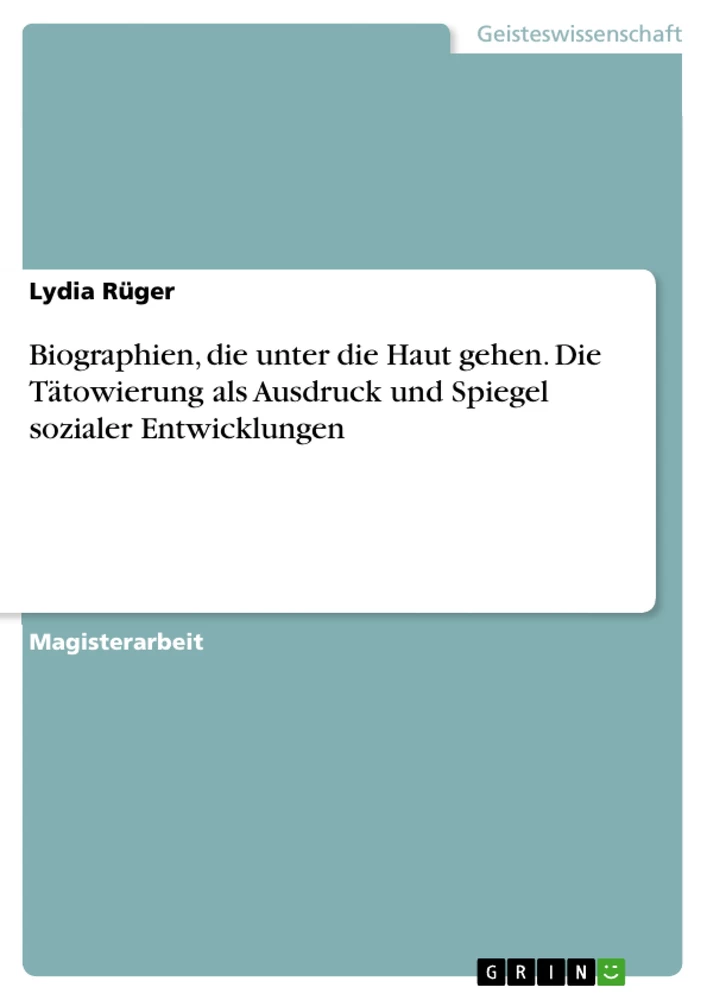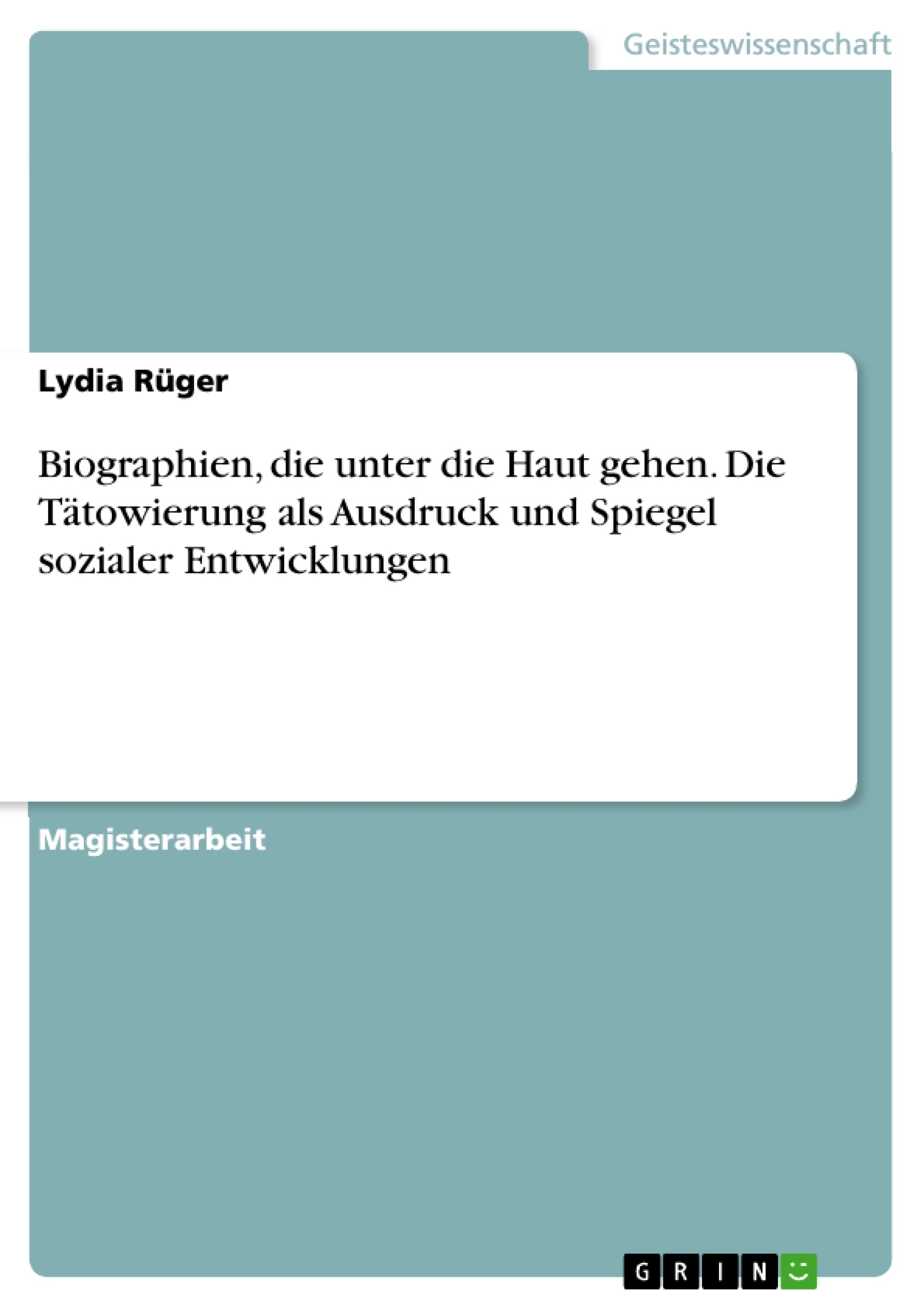Es ist die Unauslöschlichkeit, die unstreitbar den Reiz oder sogar die Magie von Tätowierungen ausmacht. Will man sich tätowieren lassen, muss man eine Entscheidung fürs Leben treffen, die man nicht mehr oder nur schwer rückgängig machen kann. Ein bisschen schwanger gibt es nicht und das trifft auch auf Tätowierungen zu. Es gibt untätowierte und tätowierte Haut und der Schritt von einem zum anderen ist mit einer gewissen Dramatik verbunden, denn es gibt kein Ausprobieren für ein paar Jahre und kein Probetragen, wie man es mit einer Jacke machen kann, mit einem Tattoo besitzt man ein Hautbild fürs Leben.
Im Jahr 2004 lebten in Deutschland circa 2 Millionen tätowierte Menschen und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl bis heute noch gestiegen ist. Kaum ein Spaziergang im Sommer, ein Besuch im Schwimmbad oder ein Tag am Strand, bei dem einem keine geschmückten oder verzierten Körper ins Auge fallen. Diese Entwicklung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zu übersehen. Ob in Form von künstlich gebräunten, mit künstlichem Haar geschmückten oder mit Tätowierungen verzierten, modifizierte und verschönerte Körper sind so allgegenwärtig, dass sie kaum noch Aufmerksamkeit erregen. Und schon lange sind die Körperbilder kein Phänomen der Unterschicht und der Außenseiter, sowohl namenhafte deutsche Sportler, wie Franzi van Almsick oder Stefan Kretschmar als auch Medienprofis wie Robbie Williams oder Heidi Klum bekennen sich zu ihrer Körperverzierung. [...]
In ersten Teil dieser Arbeit wird die Tätowierung
als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen betrachtet. Dabei möchte ich mich der Geschichte, der bisherigen Literatur zur Thematik und dem Vergleich mit anderen Formen der Körpermodifikation ebenso zuwenden, wie den Fragen ob tätowieren zu
einer Sucht werden kann oder als Methode der Selbstverletzung eingesetzt werden kann. Im empirischen Teil dieser Arbeit kommen in Form von Fragbögen und Interviews die Träger der "Hautbilder" zu Wort. [...]
I Inhaltsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
2. Fragestellung
3. Die Tätowierung als kulturelles Erbe
3.1 Etymologie des Wortes `Tätowierung´
3.2 Historische Entwicklung der Tätowierung
3.3 Begriffsklärung
4. Soziologisch-psychologische Einordnung der Tätowierung in die Welt der Körpermodifikationen
4.1 Formen von Körpermodifikationen unter besonderer Berücksichtigung von Tätowierung und Piercing
4.1.1 Implants
4.1.2 Dermal Anchor
4.1.3 Body-Suspension
4.1.4 Skarifizierungen
4.1.5 Spaltungen
4.1.6 Piercing
4.1.7 Tätowierungen
4.2 Besonderheiten der Tätowierung und Vergleich mit dem Piercing
5. Die Haut als Träger der Tätowierung
5.1 Die Haut aus biologischer Sicht
5.2 Die Bedeutung der Haut für das Tätowieren
6. Schmerz als Bestandteil der Tätowierung
7. Tätowieren und Sucht
8. Tätowieren und Selbstverletzung
9. Methodische Vorüberlegungen und Vorbereitung der empirischen Erhebungen
10. Durchführung der empirischen Erhebung
10.1 Fragebogenerhebung
10.2 Durchführung der Interviews
11. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
11.1 Fragebogenauswertung
11.2 Auswertung der narrativen Interviews
11.2.1 Transkription
11.2.2 Gedächtnisprotokolle
11.2.3 Inhaltsanalytische Globalauswertung
11.2.4 Inhaltsanalyse
12. Methodenkritik
13. Ergebnisdarstellung
13.1 Motive für Tätowierungen
13.1.1 Attraktivität
13.1.2 Gruppeneinfluss und Gruppenzugehörigkeit
13.1.3 Abgrenzung
13.1.4 Strukturierung der Biografie
13.1.5 Identitätsgenerierung und Identitätssicherung
13.1.6 Spiritualität
13.1.7 Schmerz
13.2 Funktionen von Tätowierungen
13.2.1 Schaffung von Individualität
13.2.2 Grenzziehung
13.2.3 Schaffung von Dauerhaftigkeit und Sicherheit
13.2.4 Kommunikation
14. Schlussbetrachtungen
15. Exkurs - Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen - Das Dilemma der Mittelschicht
IV Literatur
V Danksagung
VI Erklärung
VII Anhang
II Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Altersverteilung nach Geschlecht
Abbildung 2: Soziale Position
Abbildung 3: Persönliche Faktoren
Abbildung 4: Übersicht über Interviewpartner
III Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
Es ist die Unauslöschlichkeit, die unstreitbar den Reiz oder sogar die Magie von Tätowierungen ausmacht. Will man sich tätowieren lassen, muss man eine Entscheidung fürs Leben treffen, die man nicht mehr oder nur schwer rückgängig machen kann. Ein bisschen schwanger gibt es nicht und das trifft auch auf Tätowierungen zu. Es gibt untätowierte und tätowierte Haut und der Schritt von einem zum anderen ist mit einer gewissen Dramatik verbunden, denn es gibt kein Ausprobieren für ein paar Jahre und kein Probetragen, wie man es mit einer Jacke machen kann, mit einem Tattoo[1] besitzt man ein Hautbild fürs Leben.
Im Jahr 2004 lebten in Deutschland circa 2 Millionen tätowierte Menschen (vgl. Sonnenmoser 2004: 12) und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl bis heute noch gestiegen ist. Kaum ein Spaziergang im Sommer, ein Besuch im Schwimmbad oder ein Tag am Strand, bei dem einem keine geschmückten oder verzierten Körper ins Auge fallen. Diese Entwicklung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zu übersehen. Ob in Form von künstlich gebräunten, mit künstlichem Haar geschmückten oder mit Tätowierungen verzierten, modifizierte und verschönerte Körper sind so allgegenwärtig, dass sie kaum noch Aufmerksamkeit erregen. Und schon lange sind die Körperbilder kein Phänomen der Unterschicht und der Außenseiter, sowohl namenhafte deutsche Sportler, wie Franzi van Almsick oder Stefan Kretschmar als auch Medienprofis wie Robbie Williams oder Heidi Klum bekennen sich zu ihrer Körperverzierung. "Es ist echt", gesteht Heidi Klum, die sich den Namen ihres Mannes und drei kleine Sterne für ihre Kinder auf den Unterarm stechen ließ, einem RTL-Reporter. "Ich glaube, in meinem Alter - mit 35 - ist es okay[2]." Noch immer sind jedoch die Bilder von den tätowierten Deliquenten („Knastbrüdern“) oder Seefahrern in vielen Köpfen tief verankert. Es scheint demnach eine Diskrepanz zwischen den verinnerlichten Vorstellungen und der heutigen Phänomenologie des Tätowierens zu bestehen, denn keiner würde wohl Heidi Klum oder Franzi van Almsick auf Grund ihrer Hautbilder als kriminell einordnen. Doch warum erlebt diese Art von Körperveränderung einen solchen Zuwachs obwohl eine Tätowierung in vielen Bereichen des Lebens noch immer ein Hindernis darstellt? Und warum entscheiden sich gerade in einer Zeit, in der die Möglichkeiten sich auszudrücken oder darzustellen explosionsartig steigen, immer mehr Menschen für eine lebenslange Bindung an ein Hautbild?
Wenn Matthias Friederich in seiner Einleitung schreibt: „Tätowierungen und ihre Träger bilden eine Einheit. Eine sinnvolle wissenschaftliche Beschäftigung muß also Hautbild und Träger gleichermaßen erfassen“ (Friederich 1993: 9), so möchte ich mich in dieser Arbeit ebenfalls beidem widmen. In einem ersten Teil wird die Tätowierung als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen betrachtet. Dabei möchte ich mich der Geschichte, der bisherigen Literatur zur Thematik und dem Vergleich mit anderen Formen der Körpermodifikation ebenso zuwenden, wie den Fragen ob tätowieren zu einer Sucht werden kann oder als Methode der Selbstverletzung eingesetzt werden kann. Im empirischen Teil dieser Arbeit kommen in Form von Fragbögen und Interviews die Träger der Hautbilder zu Wort. Auch wenn sich diese Methodenkombination eher zufällig ergeben hat, war sie meines Erachtens dem Erkenntnisinteresse nur dienlich.
Zu Beginn werden einige allgemeine Elemente der Tätowierpraxis geklärt und somit Antworten auf folgende Fragen geliefert: Was ist eigentlich eine Tätowierung und wie kam der heutige Begriff zustande? Werden Tätowierungen trotz oder wegen des Schmerzes vollzogen? Im zweiten Teil soll ein Blick in die Praxis des Tätowierens helfen, das gesellschaftliche Phänomen des Tätowierens als solches zu begreifen und Aufschluss darüber geben wie die Betroffenen mit ihrem Hautbild umgehen und was sich durch die Tätowierung in ihrem Leben geändert hat.
2. Fragestellung
Im Gegensatz zur Soziologie beschäftigen sich andere Wissenschaften schon länger mit der Thematik Körpermodifikation, besonders die Kriminologie und Medizin sowie medizinische Psychologie haben schon zahlreiche Studien und Arbeiten zur Körperkunst hervorgebracht. Die vorliegende Arbeit soll die spärliche soziologische Literatur zum Thema Tätowierung ergänzen und über das soziale Phänomen Tätowierung aufklären, informieren und eine wissenschaftliche Diskussion anregen. Dabei sollen keine Beweise darüber geliefert werden ob Tätowierungen gut oder schlecht sind, diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, denn letztlich führen wir alle Körperveränderungen an uns durch.
Tätowiert zu sein bedeutet sich einer schmerzhaften Prozedur zu unterziehen, auf die meist noch eine langwierige Pflege folgt und zusätzlich eine dauerhafte Veränderung des Körpers mit sich bringt. Bei der Entscheidung für eine Tätowierung handelt es sich in unserem Kulturkreis um einen autonomen Akt, bei dem die Handlung als Folge einer selbstbestimmten Entscheidung zu verstehen ist, anders als bei vielen Körpermodifikationen mit rituellem Charakter anderer Kulturen. In der Psychologie wird davon ausgegangen, dass bestimmte psychische Motive vorliegen, wenn Menschen ihren Körper verletzen lassen. Der US-amerikanische Anthropologe Wilfrid Dyson Hambly stellt fest: „Körpermarkierungen sind essentiell mit der Psyche verbunden, je nach dem individuellen Verhältnis zwischen Leib und Seele“ (Hambly 1974 zitiert nach Stirn 2003b: 7). Denkbar wäre, dass der Akt des Tätowierens gleiche Aspekte enthält, wie selbstverletzendes Verhalten, da hier ebenso eine Verletzung der Haut erfolg, aus diesem Grund soll dieser Zusammenhang näher beleuchtet werden. Zudem gilt es herauszufinden, welche Rolle der Schmerz beim Erwerb einer Tätowierung spielt und wie die Betroffenen damit umgehen.
Die Motivation sich tätowieren zu lassen könnte weiterhin von biografischen oder lebensgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst werden, die zu einem Bedürfnis geführt haben die eigene Körpergrenze mittels Tätowierung erfahrbar zu machen. Um dies zu überprüfen sollen die Biografien der Tätowierten genauerer Betrachtung unterzogen werden. Dabei gilt es herauszufinden wie sich die Tätowierungen in die Biografie der Betroffenen eingliedern, zu welchen Zeitpunkten im Leben sich Menschen tätowieren lassen und welche Gründe sie dafür hatten. In anderen Kulturkreisen in denen Körperveränderungen wie die Tätowierung schon seit vielen Jahrhunderten praktiziert werden, haben diese starken rituellen Charakter und symbolisieren oft das Ende oder den Beginn eines Lebensabschnittes oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Tätowierungen haben somit expressiven Charakter und stellen einen das Selbstbild und die Identität beeinflussenden Prozess dar. Ob dies bei der westlichen Tätowierung noch immer der Fall ist, soll in dieser Arbeit ebenfalls Gegenstand der Untersuchung sein.
Da es sich bei meinem Forschungsgegenstand um ein Thema mit subjektivem Bezug handelt, das sich durch verbale Äußerungen der Betroffenen selbst am besten erschließen lässt, wurden qualitative (offene) Interviews als Methode gewählt. Mit einer zuvor durchgeführten Fragebogenuntersuchung sollen bestehende Hypothesen überprüft werden und mit Hilfe der narrativen Interviews sollen neue mögliche Hypothesen generiert werden um zukünftige Untersuchungen anzuregen. Die Aussagen der Interviews sollen jedoch zusätzlich dafür genutzt werden die theoretischen Positionen exemplarisch und dokumentarisch zu belegen.
Viele Autoren sprechen heute von einem Massenphänomen oder einem Modetrend, wenn die Thematik der Tätowierung behandelt wird. Sweetman sieht in der westlichen Tätowierung lediglich ein „empty signifier, once marginal and subcultural device, that has now gone mainstream, thus joining the ranks of the other ephemeral products available in the supermarket of style“ (Sweetman 1999: 55). Doch wenn die Tätowierung lediglich ein austauschbares Zeichen unter vielen ist, warum nehmen ihre Träger teilweise starke und langwierige Schmerzen in Kauf und investieren für den Erwerb Geld und eine lange Zeit der Pflege für eine unwiderrufliche Veränderung an ihrem Körper? Und welche Funktionen erfüllen die Tätowierungen für ihre Träger? Auf diese Fragen versuche ich in dieser Untersuchung eine Antwort zu finden. Zuvor scheint es mir allerdings notwendig dem Leser eine kurze Einführung in die Entwicklungsgeschichte des Tätowierens zu geben und eine klare Definition dem weiteren Vorgehen voran zu stellen.
3. Die Tätowierung als kulturelles Erbe
3.1 Etymologie des Wortes `Tätowierung´
„Laut Finke kennt und kannte jegliche lebende und tote Sprache einen Begriff für Tätowierungen mit Ausnahme von Sanskrit[4] -Sprachen“ (Bischof 2006: 15). Das Wort `tattoo´ entstammt ursprünglich einem tahitianischen Dialekt, in dem das Wort `tatau´ von dem Geräusch `ta-ta-ta´, welches während dem Einschlagen der Farbpigmente in die Haut entstand, abgeleitet wurde (vgl. Bischof 2006). Die Entwicklung des Begriffs in Europa beginnt erst Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Erscheinen des Reiseberichts von James Cooks erster Reise in den südpazifischen Raum, in dem er eine Sitte der Eingeborenen als etwas, „was man `Tattaw´ nennt“ beschrieb (Cook 1774 zitiert nach Joest 1887: 6). Im gleichen Jahr, in dem dieser Bericht entstand, brachte Cook einen tätowierten Polynesier Namens Omai mit nach London, was zu der Verbreitung des der Bezeichnung `tatauierung´ beitrug. Der Schritt zur deutschen Tätowierung ist, laut gängiger Meinung in der Literatur nur einer fehlerhaften Schreibweise zu verdanken, bei der die englische Silbe mit `tow´ statt mit `tau´ übersetzt wurde. Heute gebräuchlich sind die Begriffe Tätowierung und durch die in den letzten Jahren stattgefundene Angloamerikanisierung der deutschen Sprache die englische Form tattoo.[3]
3.2 Historische Entwicklung der Tätowierung
Der folgende historische Überblick ist lediglich ein Ausschnitt der umfangreichen Geschichte der Tätowierung, allerdings liefert er vielleicht einige Erklärungsansätze für die heute noch oft vertretenen stigmatisierenden Ansichten über diese Körperkunst. Den Körper zu verschönern und zu schmücken ist eines der frühesten Bedürfnisse der Menschen, allerdings sind die Ursprünge des Hautbildes, aufgrund seiner Vergänglichkeit mit dem Träger, schwer ausfindig zu machen. Die prähistorischen Belege zeigen, dass die Körperbemalung auf die gleiche Zeit zurückzureichen scheint wie die Höhlenmalerei. Der Ursprung der Bemalung liegt laut Buschan (1910) in dem Bestreichen mit Erden zur Kühlung und Abwehr von Insekten oder zur Tarnung. Erste Beweise für die frühe Praxis des Tätowierens stellen die ägyptischen Mumien zweier tätowierter Mädchen aus der 11. Dynastie (2000 v. Chr.) dar (vgl. Winlock, zitiert nach Ruhnke 1974: 17). Den wohl bekanntesten Fund stellt der prähistorische `Ötzi´ dar, der 1991 in einer Gletscherspalte im Ötztal in der Schweiz gefunden wurde und auf dem Wissenschaftler über 50 Tätowierungen gefunden haben. Nach langer Zeit der Spekulationen sind sich die Forscher heute über den Zweck dieser Tätowierungen fast alle einig. So befinden sich nahezu 100% der Strichtätowierungen auf Akupunkturpunkten, die für Rückenleiden und Verdauungsprobleme verwendet werden, weshalb die Wissenschaftler davon ausgehen, dass `Ötzi´ akupunktiert wurde. Das Alter wird mittlerweile auf Grundlage wissenschaftlicher Tests auf 5300 Jahre geschätzt (vgl. Feige 2003). Einen Aufschwung in Europa erhielt die Tätowierung Mitte des 18. Jahrhunderts, als James Cook von einer Reise den Südseeinsulaner Omai mit nach England brachte und ihn zu Attraktionszwecken ausstellte, wie es zu dieser Zeit üblich war (vgl. Oettermann 1994: 24ff). Omai erlangte hohe Popularität, da die Europäer die Welt der Südsee für das Paradies hielten, rein und unberührt und die Tätowierung als Schrift dieser Welt empfunden wurde (vgl. Oettermann 1994: 47ff). Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an bis zum ersten Weltkrieg erreichte die Tätowierung ihren Höhepunkt, was zur Niederlassung erster Berufstätowierer führte und auch von einer stark tätowierten Frau ist 1890 das erste mal zu lesen (vgl. Oettermann 1994: 58f). Zeitgleich erschien Lombrosos[5] kriminalanthropologisches Werk „Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung“, in dem er einen kausalen Zusammenhang zwischen kriminellen Neigungen und Tätowierungen herstellte. Dies führte dazu, dass Tätowieren allgemein als Manie bezeichnet wurde (vgl. Finke 1993). Ab den 20er Jahren wurde die Zurschaustellung von Tätowierten „(…)fast bis zum vollständigen Verbot reglementiert“ (Oettermann 1994: 91). Die Nazis verfolgten Tätowierte und deportierten sie in Konzentrationslager, da die weit verbreitete Meinung bestand sie würden den Staat zerstören und wären kriminell. Allerdings hielt diese Ansicht SS-Offiziere nicht davon ab sich selbst tätowieren zu lassen um ihre Zugehörigkeit zum politischen System zu demonstrieren (vgl. Oettermann 1994). Zudem waren in dieser Zeit Straf- und Zwangstätowierungen an der Tagesordnung, bei denen Gefangenen in Konzentrationslagern zum Zweck der Stigmatisierung Nummern und Blutgruppen tätowiert wurden (vgl. Oettermann 1994). Seit den 80er Jahren scheint der Hautstich eine Renaissance zu erleben, was unter anderem die zunehmende medizinische und allgemeine Literatur zu dem Thema und zum anderen die steigende Zahl der Hautbilder belegt (vgl. Friederich 1993). Die häufig fehlenden Belege für die Entwicklung haben allerdings zur Folge, dass sich die verschiedensten Standpunkte herausgebildet haben, wie diese Aussage von Finke zeigt: „Es konnte weiterhin die Annahme erhärtet werden, dass sich die Tätowierung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen in allen Erdteilen selbständig und unabhängig voneinander entwickelt hat und keineswegs von der Südsee in den europäischen Raum eingeschleppt wurde, wie es in einigen Veröffentlichungen immer wieder behauptet wird“ (Finke 1996: 49). Trotzdem wird an Hand der weit zurück reichenden Geschichte der Körperkunst deutlich, dass es kaum möglich ist, dass alle Menschen mit einer Körpermodifikation psychopathologische Züge aufweisen, sonst hätten wir die älteste Krankheit der Menschheit entdeckt.
3.3 Begriffsklärung
Eine eindeutige Begriffsklärung der Tätowierung scheint auf den ersten Blick einfach, auf den zweiten Blick wird allerdings deutlich wie unterschiedlich die Aussagen in der Literatur darüber sind, was man unter einer Tätowierung zu verstehen hat, wenn überhaupt eine klare Definition vorhanden ist. In einem Großteil der Literatur wird ganz auf eine Begriffsklärung verzichtet und somit der Eindruck erweckt, es existiere eine allgemein anerkannte Begrifflichkeit. Dass dies nicht der Fall ist, wird im Folgenden deutlich. Das klinische Wörterbuch bietet eine der ältesten Versuche einer Begriffserklärung: „ Tätowierung, Tatauierung polynes. tattau, Farbstichelung, Färbung von Malern und Hornhautflecken durch Einreiben von Farbstoff, gew. Tusche, in feine Stichöffnungen; der Name stammt von den Südseeinsulanern. Besonders ausgiebige und besonders laszive Tätowierung der Haut als Neigung bei Verbrechern, Lombroso. Aber auch sehr beliebt bei Matrosen“ (Dornblüth 1927). Auch wenn der Entwicklung dieser Zeit entsprechend, ist dieser Vorschlag in der heutigen Zeit wohl nicht mehr haltbar. Die gängigsten Vorstellungen von Tätowierungen sind Bilder oder Schriften auf der Haut von Menschen, leider gehen auch viele Autoren über diese Phänomenologie nicht hinaus oder treffen lediglich grobe Unterscheidungen, wie Christa Ruhnke: „Einige Autoren verstehen unter der Tätowierung jegliche Form bleibender Veränderung an der menschlichen Haut. Üblicher ist es, zu unterscheiden zwischen dem eigentlichen Tätowieren –nämlich der bleibenden Zeichnung der Haut durch Einbringen von Farbpartikeln- und den übrigen Formen der Veränderung der Hautoberfläche, wie dem Anbringen von Schnitt- und Brandnarben“ (Ruhnke 1974: 11). Doch diese Beschreibung greift eindeutig zu kurz, da nach Ruhnke auch eingebrachter Dreck in Schürfwunden als Tätowierung gelten würde. Lediglich der Vollständigkeit halber wird auch die Definition des bekannten Online- Lexikons Wikipedia erwähnt: „Eine Tätowierung (wissenschaftlich auch Tatauierung, umgangssprachlich (engl.) Tattoo) ist ein Motiv, das mit Tinte oder anderen Farbpigmenten in die Haut eingebracht wird“[6]. Bei dieser Definition wird schon die Einbringung in die Haut berücksichtigt, doch es fehlt die Absichtlichkeit, die Zielgerichtetheit der Handlung.
Finke bietet eine der aktuellsten Erklärungen und bringt in seiner Definition eine zusätzliche Dimension hinzu. Bei ihm bezeichnet die Tätowierung immer eine Erwerbs- oder Zweckmotivation, das bedeutet dass sie aus einem bestimmten Grund erworben wurde (Finke 1996: 17). In dieser Arbeit wird diese Ansicht geteilt und um den von Friederich vorgeschlagenen Aspekt, dass die eingebrachten Partikel einen bildhaften Charakter haben können, aber nicht zwangsweise haben müssen, erweitert (vgl. Friederich 1993). Im Folgenden wird also unter einer Tätowierung die künstlich vorgenommene, permanente und beabsichtigte, zielgerichtete Einlagerung von Farbpigmenten in die Haut verstanden, die nicht zwangsweise einen bildhaften Charakter haben müssen und bei der das Ziel des Tätowierers nicht mit dem des Tätowierten übereinstimmen muss.
3.4 Behandlung der Thematik in der Literatur
„Psychiatric disorders, such as antisocial personality disorder,
drug or alcohol abuse and borderline personality disorder,
are frequently associated with tattoos.”
(Raspa & Cusack 1990)
Bei der Sichtung der Literatur wurde schnell deutlich, dass trotz unterschiedlicher thematischer Zugänge, unter vielen Autoren Einigkeit darüber herrscht, dass es sich bei Tätowierten um eine psychopathologische Gruppe mit kriminellen Zügen handelt. Von den weit verbreiteten stereotypen Sichtweisen zeugt auch die folgende Aussage: „Vor kurzem noch druckten selbst Winkelzeitungen die Meldung nach, nach der der amerikanische Dermatologe Prof. Norman Goldstein nach 15jähriger Forschung nun endlich definitiv festgestellt habe, daß ‚Tätowieren ... ein Zeichen psychischer Labilität’ ist und daß es sich ‚bei einem Menschen, der mit mehr als drei Tätowierungen verziert ist, gewöhnlich um einen Psychopathen’ handelt“ (Oettermann 1982: 337). Diese und ähnliche Aussagen prägen bis heute, trotz häufig fehlender signifikanter Belege, das Bild der Gesellschaft von tätowierten Personen.
In diesem Zusammenhang ist übrigens auch die folgende Beobachtung bemerkenswert: „Dies übrigens eine Faustregel bis heute: Tätowierte schreiben keine Bücher, und die, die Bücher über Tätowierungen schreiben, sind nicht tätowiert“ (Oettermann 1994: 62). Da die vergangene Literatur durchaus die heutige Sicht zur Tätowierung beeinflusst, soll im Folgenden ein Überblick über einige Arbeiten gegeben werden, die von den gegensätzlichen Beurteilungsmöglichkeiten der Thematik zeugen und das Bild der Tätowierung bis in die heutige Zeit geprägt haben.
Eine der ersten Arbeiten, die zu dem noch eine sehr wertfreie Sicht darstellt, stammt von dem Völkerkundler Joest, der 1887 auf der Grundlage gesammelter Erfahrungen bei seinen mehrjährigen Reisen die Sitte des Tätowierens ausführlich darstellt und Zusammenhänge dieses kulturellen Phänomens beschreibt (vgl. Friederich 1993). „Joest sieht im Tätowieren einen Brauch, der bei allen, vorwiegend hellhäutigen Völkern herrscht oder geherrscht hat, wobei er sowohl eigenständig, aber auch durch gegenseitigen Einfluß entstanden sein kann“ (Friederich 1993: 23). „Nach seiner Meinung hat die Tätowierung bei außereuropäischen wie europäischen Völkern lediglich die Funktion „eines allbeliebten Körperschmucks““ (Joest 1887 zitiert nach Friederich 1993: 24).
Ungefähr zur gleichen Zeit, allerdings mit einem ganzen anderen Zugang bearbeitete der italienische Arzt Cesare Lombroso die Thematik. Zwischen 1863 und 1885 untersuchte er mit einigen anderen Autoren über 11000 Personen auf Anomalien und körperliche Merkmale. Lombroso kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der körperlichen Anomalien und Tätowierungen bei Kriminellen höher ist als bei nicht Kriminellen und dass das Tätowieren bei Kriminellen ein atavistisches[7] Merkmal ihres Charakters ist (vgl. Lombroso 1887). Mit diesen Ansichten kreiert Lombroso „den Menschentypus des „geborenen Verbrechers“ und setzt sich zum Ziel, „den Leser in den stand zu setzen, dass er (…) diesen Typus selbst erkenne.“ (Lombroso 1887 zitiert nach Friederich 1993: 26)
Der Regimentsarzt Leopold Goronzek untersuchte, im Anschluss an die von Lombroso angeregte Diskussion, im Jahr 1912 über 7000 Soldaten für eine medizinische Dissertation (vgl. Goronzek 1912). Diese Untersuchung ergibt 7% Tätowierte unter den Befragten, was Goronzek zu dem Schluss bringt, dass die Tätowierung keine Rückschlüsse auf die Psyche oder die Kriminalität der Träger zulässt. Als mögliche Erwerbsgründe nennt er Dummheit oder Nachahmung, als Körperschmuck sieht er die Tätowierung nicht (vgl. Friederich 1993).
1925 veröffentlicht der Dermatologe Erhard Riecke sein in ärztlicher Praxis gesammeltes Material, welches er durch seine eigenen Erfahrungen ergänzt. Die von Lombroso aufgestellten Theorien sieht Riecke als unbewiesene Behauptungen, da Vergleichswerte fehlen. „Wohl aber läßt sich sagen, dass im allgemeinen Tatauierung auf einen niederen Kulturstand schließen lässt, nicht gerade ein Zeichen fortgeschrittener Zivilisation darstellt und für keinen besonders hohen Intelligenzgrad spricht.“ Riecke sieht zudem in der Tätowierung einen „im Vergehen, im Aussterben befindlichen Brauch“ (Riecke 1925 zitiert nach Friederich 1993: 30). Als Erwerbsgründe führt Riecke die gleichen Gründe wie Goronzek an, bei denen zusätzlich häufig Alkohol eine Rolle spielt.
Die sozialpsychologische Arbeit des Volkskundlers Spamer aus dem Jahr 1933 ist eine sehr fundierte, der Friederich in seiner Studie besonders viel Raum gibt. „Volkskundlicher Betrachtung gilt jede menschliche Ausdrucksform nur als Mittel zur Erkenntnis der hinter ihrer Bildwerdung lebendigen, jene auslösenden inneren Kräfte. So ist auch das Hautbild Spieglung der Zeit in einem bestimmten, äußerlich und innerlich gebundenen Menschenraum“ (Spamer 1933 zitiert nach Friederich 1993: 8). In seiner Arbeit „Die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten“ verarbeitet Spamer Fach- und Tagesliteratur, eigene Erfahrungen und Bildmaterial und zeichnet in seinen Ausarbeitungen ein detailliertes Bild des Berufsstandes der Tätowierer. In der Tätowierung sieht Spamer einen Ersatz für die Körperbemalung, deren Verbreitung von der Weltwirtschaftslage abhängig ist.
Der Dermatologe Walther Schönfeld gibt 1960 eine Bestandsaufnahme der Tätowierpraxis und schildert sowohl kulturgeschichtliche Hintergründe als auch die Behandlung der medizinischen Problematik. Für den Versuch einer Analyse der Erwerbsmotivationen teilt Schönfeld die Träger in Motivationsgruppen ein, wobei er unterscheidet „landläufig, zwangsläufig Tätowierte, echte Straftätowierungen und die aus gesellschaftlicher Mode und Spleen Tätowierten“ (Schönfeld 1960 zitiert nach Friederich 1993: 37). Schönfeld versucht als einer der ersten sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen der Thematik zu nähern.
Unter gerichtsmedizinischen Aspekten wertet Udo Pfülb 1968 im Rahmen einer Dissertation 6000 ihm vorliegende Sektionsprotokolle des Instituts für gerichtliche Medizin der Universität Düsseldorf aus und findet in 154 Fällen Tätowierungen beschrieben. Er sieht in der Tätowierung ein wichtiges Hilfsmittel zur Identifikation. Aufgrund der sozialen Herkunft der beschriebenen tätowierten Leichen, schließt Pfülb allgemein auf einen niedrigen Intelligenzgrad bei Tätowierten, die zusätzlich Aussagen über Kriminalität und sexuelle Perversion erkennen ließen (vgl. Friederich 1993).
In einer juristischen Dissertation aus dem Jahre 1976 kam die Autorin Klees-Wambach „nach eigener Überzeugung“ zu der Feststellung, „dass Tätowierungen in der Regel ein Indiz für kriminelles Verhalten sind“ (Klees-Wambach 1976 zitiert nach Friederich 1993: 42). Mögliche Erwerbsmotivationen sind nach Klees-Wambach die schichtenspezifische Unfähigkeit, Konfliktsituationen verbal aufzuarbeiten oder gestörte Identifikationsprozesse. „Weiterhin seien Tätowierungen dem Kriminalisten insofern dienlich, als dass sie u. a. Hinweise auf Identität, Beruf und soziale Schicht des Täters sowie über die Deliktsbegehung liefern könnten“ (Klees-Wambach 1976 zitiert nach Friederich 1993: 42). Aus diesem Grund fordert die Autorin eine internationale Aufnahme aller Tätowierungen von Verbrechern.
Einen sehr umfangreichen Überblick über die Entwicklung der europäischen Tätowierung liefert Oettermann 1979 in seiner Arbeit „Zeichen auf der Haut. Die Geschichte der Tätowierung in Europa“, in der er eine Reihe historischer Bildbeispiele bietet. Oettermann beschreibt die Tätowierung sowohl als individuellen Widerstand gegen gesellschaftliche Strukturen als auch als Mittel des Staates Macht auszuüben und das Individuum einzuverleiben. Den Schwerpunkt seiner Arbeit legt Oettermann auf die „Geschichte, die Beschreibung und die Lebensläufe populärer Berufstätowierer und Tätowierter“ (Friederich 1993: 43).
Einen weit reichenden Überblick über die genannte Literatur zu Tätowierungen gibt die in diesem Kapitel schon häufig zitierte kultursoziologische Arbeit von Friederich. In 100 Einzelinterviews versucht er von 1985 bis 1987 ein breit gefächertes Bild tätowierter Personen, die gleichzeitig Mittelpunkt seiner Untersuchung sein sollen, zu erstellen. Zudem stehen die Hautbilder selbst im Interesse des Forschers, welche einen Überblick über die aktuelle Tätowierkultur geben sollen. „Eine volkskundliche Auseinandersetzung mit dem Forschungsobjekt Tätowierung muss sich vornehmlich mit dem Objekt selbst beschäftigen“ (Friederich 1993: 11). Das Ziel seiner Untersuchung sieht Friederich selbst „in einer umfassenden Darstellung der gegenwärtigen Tätowierkultur in der BRD“ (Friederich 1993: 83). Friederich kommt zu dem Ergebnis, dass die Tätowierung längst nicht mehr eine Ausdrucksform gesellschaftlicher Randgruppen ist, sondern ein schichtübergreifendes Phänomen, was sich nicht nur in Hafenstädten finden lässt und nicht von der sozialen Schicht oder dem Beruf des Trägers abhängig ist. Friederich sieht es zudem als erwiesen an, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen Kriminalität und der Tätowierung besteht, auch wenn bei einem großen Teil der Probanten Haftstrafen zu verzeichnen waren (Friederich 1993: 333).
Im Jahr 2004 veröffentlichte Aglaja Stirn, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, eine ihrer vielen psychomedizinisch orientierten Arbeiten mit dem etwas unzutreffenden Titel „Ergebnisse einer ersten deutschen Fragebogenuntersuchung“, da wie im letzten Abschnitt gezeigt, schon Friederich eine Fragebogenuntersuchung im deutschen Raum durchführte. Stirn befragte 104 Besucher auf der Frankfurter Tattoo Convention 2000 mit dem „Frankfurter Tattoo- und Piercing-Fragebogen (FTPF)“ um die Motive für ihre Bodymodifications ausfindig zu machen. In einer Reihe ihrer Arbeiten zu dem Thema Körpermodifikation wird jedoch immer wieder eine pathologisierende Haltung der Thematik gegenüber deutlich, was auch aus dem Wissenschaftsfeld der Autorin resultieren kann. „In der Fragenauswahl war zuvor antizipiert worden, dass Praktizierende von Körpermodifikationen ein besonderes, möglicherweise pathologisches Verhältnis zum Schmerz haben könnten“ (Stirn 2004a: 54). Stirn untersucht im Gegensatz zu Friederich die Tätowierung nicht separat, sondern wie in den meisten ihrer Arbeiten bevorzugt sie eine gemeinsame Betrachtung und Untersuchung von Tätowierungen und Piercings, was mir jedoch als problematisch erscheint wie sich im nächsten Kapitel noch zeigen wird. Eines der Ergebnisse dieser Studie formuliert Stirn wie folgt: „Hierin liegt ein Hinweis darauf, dass eine letztendliche Befriedigung durch ein Tattoo oder Piercing ebenso wenig erreicht werden kann wie die Ziele, die mit den Körpermodifikationen verbunden sind, nämlich Identitätsentwicklung und Individualität“ (Stirn 2004a: 56).
Eine Abhandlung, der auf Grund ihrer Aktualität hier etwas mehr Raum gegeben werden soll, die allerdings neben der Tätowierung auch andere Formen der Körpermodifikation aus einem psychologischen Standpunkt betrachtet, ist die Arbeit von dem Psychologen Erich Kasten aus dem Jahr 2006. Auf der Grundlage von Internetrecherchen versucht er die Motivationen der Betroffenen zu analysieren und vergleicht sie mit aktuellen Forschungsergebnissen aus Psychologie und Medizin. Dass es Menschen gibt, die sich mit dem Skalpell Symbole in die Haut schneiden, um so Narben zu erzeugen, werden die meisten einfach nur gruselig finden, aber letztlich ist das nur die Extremvariante eines urzeitlichen Verhaltens: Menschen verändern ihr Äußeres, Mädchen lackieren sich die Fingernägel, Männer gehen ins Bodybuilding-Studio, zunehmend mehr Menschen bezahlen viel Geld für Schönheitsoperationen, so leitet Kasten in seine Untersuchung ein (Kasten 2006: 11). Die Deutung von Körperveränderungen als Wunsch nach „Verbindlichkeit“ ist eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse seiner Arbeit. Erich Kasten möchte mit seinem Buch „Body Modification[8] – Psychologische und medizinische Aspekte von Piercing, Tattoo, Selbstverletzung und anderen Körperveränderungen“ zeigen welche Formen von Körperveränderungen möglich sind und welche Motive Menschen haben Schmerzen zu ertragen um ihren Körper zu verändern. Neben Rebellion und dem Versuch jugendlich zu wirken, führt Kasten auch die Wandlung der Funktion des Körpers von einem Mittel zur Arbeit zum Instrument zur Selbstinszenierung als Grund für die explosionsartige Verbreitung des Körperschmucks an. Er diene zudem der Individualisierung und der Kommunikation in einer überbevölkerten Massenwelt (vgl. Kasten 2006). „Der Kampf ums tägliche Brot ist dem Kampf gegen die Langeweile gewichen“ (Kasten 2006: 12). Seine unkonventionelle Methode der Dokumentenanalyse im Internet begründet er mit der Problematik Menschen mit extremen Körperveränderungen zu erreichen und mit dem Vorteil in kurzer Zeit sehr viele Informationen sammeln zu können und ohne aufwändige Befragungen eine eigene Auswahl der interessantesten Fälle treffen zu können. Der wissenschaftlichen Kritik an dieser Methode ist Kasten sich bewusst, da er selbst während der Recherche die Erfahrungen gemacht hat, dass negative Darstellungen plötzlich aus dem Netz verschwunden waren oder überarbeitet wurden, aus diesem Grund solle man die Beschreibungen mit Vorsicht genießen. Nachdem Kasten zu Beginn auf die historische Entwicklung des Körperschmucks eingeht, präsentiert er ein umfangreiches Repertoire verschiedenster Formen der Körperveränderung von der Nutzung von Make-up über Implantate bis zum Selbstkanibalismus, die er alle mit Bildmaterial und Beispielen hinterlegt. Auffällig ist die detaillierte Darstellung der auch noch extremen Methoden, die nichts für empfindliche Leser sind und selbst erfahrenen Bodmod – Begeisterten den Atem stocken lassen. Doch gerade diese ungehemmte und wertfreie Beschreibung des Autors macht diese Arbeit zu einem unverzichtbaren Beitrag für die Aufklärung über das gesellschaftliche Phänomen der Körperveränderung. Im Laufe meiner umfangreichen Literaturrecherche fand sich keine vergleichbare Arbeit. Neben den Formen der Bodymodifications widmet sich Kasten ebenso ausführlich den möglichen Motiven für diese Veränderungen am Körper, welche er mit den aktuellen medizinischen und psychologischen Erkenntnissen verbindet. In seiner Schlussbetrachtung versucht Kasten eine Prognose für die aktuelle Entwicklung zu stellen und beginnt mit der Feststellung, dass schon heute die Grenzen des Körpers überschritten sind und diese Entwicklung so schnell kein Ende nehmen wird, da es so scheint, als sei „in einer überbevölkerten gleichmachenden Welt (…) alles recht zu sein, was die Individualität unterstreicht“ (Kasten 2006: 340). Sowohl den medizinischen Fortschritt als auch die finanziellen Probleme des Gesundheitssystems sieht Kasten als Anlass weiter voranschreitender Verbreitung von körperveränderten Maßnahmen, die seiner Prognose nach bald nur noch vom Geldbeutel der jeweiligen Betroffenen abhängig sein werden. Die Ausführungen über die bereits möglichen Veränderungen und die eventuell bald realisierbaren Methoden wirken fast schon beängstigend, da es laut Kasten bald nichts mehr geben wird, was es nicht gibt. Abschließend findet Kasten die passenden Worte um all die vorangegangenen, teils schockierenden und abstoßenden Beschreibungen zumindest zu einem gewissen Teil zu relativieren: „(…) das Hauptanliegen dieses Buches: ein Plädoyer, die Psyche eines Menschen niemals allein danach zu beurteilen, wie sein Körper aussieht“ (Kasten 2006: 344). Dieses Zitat soll ein Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit bilden, in der ich zu zeigen versuche, dass die in der Gesellschaft allzu stark verbreitete Angewohnheit Mitmenschen aufgrund ihres Äußeren zu beurteilen nicht der richtige Weg ist, sondern dass es jeder Mensch verdient, egal ob dick oder dünn, egal ob tätowiert oder nicht dass man sich mit mehr als seiner Optik beschäftigt.
4. Soziologisch-psychologische Einordnung der Tätowierung in die Welt der Körpermodifikationen
„... schließlich zeigen verheilte Narben,
dass man mit einer Verletzung fertig wird.“
(Unbekannt)
Die wachsenden Möglichkeiten der Körpermodifikation führen oft selbst bei Liebhabern von körperveränderten Methoden zu Verwirrung. Bewirkte vor einigen Jahren noch ein Ohrring beim Mann weit reichende Diskussionen, gelten Bauchnabelpiercing und Nasenring in der BodMod Community mittlerweile regelrecht als langweilig. Gesucht werden immer extremere Methoden, um sich selbst zu inszenieren und das am liebsten auf den gut besuchten Conventions[9], bei denen sich die Besucher bereitwillig ihre Körper zeigen und Lob und Anerkennung dafür ernten. Die Methoden, den eigenen Körper mehr oder weniger dauerhaft zu verändern, reichen mittlerweile von Zunge spalten über Implantate, Brandings[10], Cuttings[11] und dermal Anchor[12] bis zu extremen Formen von Selbstverstümmelung oder Amputationen (vgl. Kasten 2006). Allen Methoden liegt eine bewusste Veränderung des Körpers zugrunde, in Motivation und Dauerhaftigkeit unterscheiden sie sich jedoch stark. Nicht vergessen werden soll bei der Betrachtung von Körperveränderungen, dass auch Haare färben, Augenbrauen zupfen, Rasieren oder Krafttraining Möglichkeiten der Körpermodifikation sind, auch wenn diese nicht irreversibel sind und daher als nicht so drastisch empfunden werden. Im allgemeinen Verständnis werden diese Formen jedoch nicht unter dem Begriff Bodymodification verstanden und somit sollen sie in diesem Kapitel auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Merkmal aller Bodymodifications ist neben der fehlenden medizinischen Indikation der Veränderung auch ein eigener Wille zu dieser. Einem Unfallopfer mit Narben oder Verbrennungen würde wohl kaum der Hang zu einer Körperverschönerung durch Bodymodifications unterstellt werden. Allerdings sind auch diese „sanften“ Veränderungen häufig mit Schmerz und Aufwand verbunden und zeugen von der Arbeit am eigenen Körper. Die Problematik liegt neben den fließenden Übergängen zwischen den verschiedenen Formen der Körperveränderung auch bei den unzähligen Motiven, die die Menschen zu diesen Änderungen bewegen und die verschiedenen Funktionen, die diese für ihre Träger oder für die Bodmoder[13] erfüllen.
Aus der Vielzahl der Methoden sollen in diesem Kapitel nur einige herausgegriffen werden um die Position der Tätowierung in der Welt der Bodymodifications zu finden und zu zeigen, dass man nicht alle Methoden in ihren Funktionen für die Träger gleichsetzen kann. Zudem sollen Piercings und Tätowierungen genauerer Betrachtung unterzogen werden und in einem Vergleich beider Körpermodifikationsformen gezeigt werden, dass sie sich in Bedeutungen und Funktionen für ihre Träger stark unterscheiden, was eine gemeinsame Untersuchung, wie sie in wissenschaftlicher Literatur häufig durchgeführt wird, problematisch macht.
4.1 Formen von Körpermodifikationen unter besonderer Berücksichtigung von Tätowierung und Piercing
Kasten (2006) beschreibt in seinem Buch „Body-Modification – Psychologische und medizinische Aspekte von Piercing, Tattoo, Selbstverletzung und anderen Körperveränderungen“ sehr ausführlich verschiedenste Arten von Körperveränderungen (auf seine Ausführungen sei in diesem Kapitel, falls nicht anderweitig zitiert, verwiesen). Wie schon erwähnt kann man ganz allgemein die verschiedenen Methoden der Körpermodifikation in permanente und widerrufliche Veränderungen unterteilen, zudem haben einige bildlichen Charakter und andere nicht. Widerrufliche oder „semi-permanente“ BodMods, also Veränderungen, bei denen der Ursprungszustand zumindest bedingt wiederhergestellt werden kann, sind neben Salinen Injektionen[14] und dermal Anchor auch die bekannteste Form des Bodypiercings. Permanente Körpermodifikationen sind unter anderem Skarifizierungen, zu denen auch Brandings und Cuttings gehören, Spaltung von Körperteilen und auch die Tätowierung. Die permanenten Formen der Bodymodification gehen meist mit einer Entfernung oder Veränderung der Haut einher, aber auch das Abfeilen der Zähne oder das Spalten der Zunge können zu dieser Gruppe gezählt werden.
4.1.1 Implants
Unter Implants (auch subdermal Implants[15] ) werden alle Objekte (Ringe, Kugeln, Sterne u.v.m.) verstanden, die unter die Epidermis implantiert werden und bei denen meist die Siluette auf der Haut zu sehen ist. Dazu wird die Haut an der gewünschten Stelle mit einem Schnitt geöffnet und so weit von der Unterhaut abgelöst, dass das gewünschte Objekt eingeschoben werden kann und anschließend der Schnitt genäht. Um das Implantat am „Wandern“ zu hindern, wird es mit Klebeband oder Verbänden fixiert um so einzukapseln. Häufig wird diese Prozedur unter örtlicher Betäubung vorgenommen, da beim Ablösen der Haut ein starker Schmerz entsteht. Implants sind zwar nicht so leicht selbst zu entfernen wie Piercings, können allerdings durch Öffnen der Haut wieder entnommen werden. Eine Zwischenform von Implants und Piercings sind die transdermal Implants[16], bei denen eine Halteplatte unter die Haut gesetzt wird und ein Gewindestab aus der Haut ragt, auf dem verschiedene Schmuckstücke angebracht werden können. Auch „Genital Beadings“ gehören in die Kategorie der Implants. Dabei handelt es sich um Kugelimplantate, die am Penisschaft oder den Schamlippen angebracht werden und neben ästhetischen Zwecken der sexuellen Luststeigerung beider Partner dienen sollen.[17]
4.1.2 Dermal Anchor
Eine ähnliche Funktion haben dermal Anchor, die allerdings wesentlich kleiner sind und nicht wie die transdermalen Implants mit einem Skalpell eingebracht werden. Dermal Anchor oder Hautanker gehören zu der Gruppe der Single Point Piercings, welche nicht durch einen Stichkanal an zwei Enden austreten sondern nur an einem Ende aus der Haut ragen (Marti 2007: 51). Dabei wird eine 2 mm große durchlöcherte Platte, auf der ein Gewindestab sitzt, in die Haut eingesetzt um mit ihr zu verwachsen („verankern“). Diese so genannten Microdermals existieren erst seit 2006, vorher wurden normale Piercings mit einer Schlaufe unter die Haut gesetzt. Es gibt mehrere Möglichkeiten den Anker einzusetzen, die von der Stelle und der Hautspannung abhängig sind, eine davon ist das Einbringen mit einem dermal Punch. Dabei werden die Gewebeteile mit einer Hohlnadel (die einen Durchmesser von bis zu acht Millimetern haben kann) heraus gestanzt, um die notwendige Hauttasche für den dermal Anchor zu schaffen. Auf den Gewindestab, der mit der Hautoberfläche abschließt, können verschiedene Steine geschraubt werden, die als Schmuck auf der Haut sichtbar sind. Häufige Probleme beim dermalen Anchor sind neben dem selbständigen Herausrutschen der Platte und dem Hängenbleiben an Kleidung auch die körpereigene Abstoßung des Fremdkörpers[18].
4.1.3 Body-Suspension
Der Begriff Suspension kommt aus dem lateinischen von „suspendere“, was so viel bedeutet wie „in der Schwebe lassen“[19]. Unter Suspension versteht man „das Aufhängen von Personen mit Seilen an Gestellen oder einem Baum. Hierzu durchsticht man die Haut an mehreren Stellen mit Haken, die dann mit einem Tau verbunden werden, an dem der Betreffende anschließend hochgezogen wird“ (Kasten, 2006, S. 87). Generell streben die Betreffenden danach, durch die Suspension eine neuartige Selbsterfahrung zu machen: „There are many different reasons to suspend, from pure adrenaline or endorphin rush, to conquering ones fears, to trying to reach a new level of spiritual consciousness and everything in between”, schreibt Suspension.org[20]. Je nach Anzahl der Haken und Körperstelle gibt es verschiedene Formen der Suspension, die sich unter anderem in vertikale und horizontale unterscheiden lassen. Zu den vertikalen zählen „Vertical Chest Suspensions“, „Suicide Suspensions“ und „Knee Suspensions“, zu den horizontalen gehören die „Coma Suspensions“ und die „Superman Suspensions“. Diese Namen bezeichnen entweder die Platzierung der Haken wie z. B. Knie oder Brust oder hängen von der Lage des Körpers ab, die Suicide- oder die Superman- Suspensions etwa verdanken ihren Namen dem Eindruck auf ihren Betrachter. Der Vorgang beginnt mit dem Anzeichnen der Stellen, die von Haken durchstochen werden sollen. Nach einer Desinfektion erfolgt das Einbringen der Haken, die meist speziell für diese Art der Körpermodifikation hergestellt werden. Über eine optimale Anzahl an Haken herrschen verschiedene Meinungen, je mehr Haken, desto besser kann sich die Zugkraft am Körper verteilen und desto geringer ist die Gefahr des Ein- oder Durchreißens der Haut, desto mehr Piercings sind jedoch nötig. An den durch die Haut gestochenen Haken wird ein Seil befestigt, mit dem der Betroffene dann mit Hilfe eines Flaschenzugs in die Luft gezogen wird (vgl. Kasten 2006). Nach einer Zeit von 5 bis 15 Minuten oder auch länger wird die Person wieder herab gelassen und die Wunden müssen medizinisch versorgt werden. Unangenehme Nebenwirkung ist das Eindringen von Luft in die Stichkanäle durch das Abziehen der Haut mit den Haken. Diese muss nach dem Entfernen der Haken mit aufwendigen Massagen herausgedrückt werden, um Infektionen zu vermeiden.
4.1.4 Skarifizierungen
Eine Form der permanenten Körperveränderungen sind Skarifizierungen[21], die allgemein nur eine Narbenbildung implizieren. Zu den Formen der Skarifizierung zählen unter anderem auch Anwendungen wie Branding und Cutting, aber auch durch Verätzen der Haut können die gewünschten Narben erzeugt werden. Die häufigste und präziseste Möglichkeit Schmucknarben zu erzeugen ist das Cutting, das Schneiden der Haut mittels Skalpell, welches sehr genaue Narben zum Ergebnis hat im Gegensatz zum skarifizieren durch Branding. Beim Cutting gibt es unterschiedliche Methoden, die vom einfachen Aufschlitzen der Haut bis zum Schneiden paralleler Linien und dem Entfernen der dazwischen liegenden Haut zum Erzeugen breiterer Narben reichen. „Nach Angabe einiger User soll Cutting, mit einem scharfen Skalpell durchgeführt, nicht viel schmerzhafter sein als das Tätowieren. Allerdings sind Adrenalinausschüttung und damit körperliche wie auch psychische Symptome der Aufregung weitaus stärker, und die Wunde blutet massiv“ (Kasten 2006: 83). Problematisch ist an dem Begriff Cutting, dass er auch in einem anderen Kontext verwendet wird, nämlich dem wilden, impulsiven Schneiden bei selbstverletzendem Verhalten, jedoch hat dieses Verhalten nicht das Ziel schmückende Narben zu erzeugen, sondern wird nur des Schmerzes wegen vollzogen. Auf die Hintergründe dieses Verhalten wird im Verlauf der Arbeit noch eingegangen, allerdings ist es für das weitere Verständnis notwendig zu verdeutlichen, dass das Cutting im Rahmen von Bodymodification die Körperverschönerung zum Hauptziel hat und sich in diesem Punkt von der Selbstverletzung unterscheidet. Dennoch gibt es auch Überschneidungen, da ein Teil der Körpermodifzierten angibt, den Schmerz als angenehm zu empfinden, was immer wieder dazu führt, dass alle schmerzhaften Körperveränderungen mit Selbstverletzung in Verbindung gebracht werden.
Die bekannteste Art der Scarification ist hingegen das Branding, hier gibt es zwei Formen, einmal das "Strike Branding" mittels geformten Metallstempeln und das "Cautery Branding" mittels eines so genannten HF-Kauterers. Dieses Gerät verödet die Haut mittels Strom und ergibt ähnlich dem Cutting recht "kontrollierbare" Narben.
4.1.5 Spaltungen
Eine sehr extreme Form der dauerhaften Veränderung des Körpers sind Spaltungen oder auch „Splitting“ genannt. Laut Kasten ist dies nur an der Zunge und an der Eichel oder dem ganzen Penis möglich (vgl. Kasten 2006). Auf der weltweit größten Homepage über Bodymodification, „Body Modification Ezine (BME)“ finden sich allerdings auch Spaltungen der Ohrläppchen, der Brustwarzen oder des Gaumenzapfen[22]. Zungenspaltungen werden meist mit dem Ziel eines amphibienhaften Aussehens vollzogen und erfolgen meist in Verbindung mit anderen Veränderungen, wie Zahnmodifikationen. Das Spalten im Genitalbereich ist weitaus seltener, dabei kann die Harnröhre des Penis aufgetrennt werden (sog. Subincisions), die Glans (Eichel), die Klitorisvorhaut oder auch der Hodensack. Einen Schritt weiter geht die Spaltung des kompletten Penis, die als „Genital Bisection“ bezeichnet wird und bei der, laut BME die volle Funktionsfähigkeit des Penis erhalten bleibt[23]. Nach Gründen für diese Modifikationen sucht man lang, laut BME liegen die Hauptgründe allerdings bei zusätzlicher sexueller Stimulation aufgrund der Empfindlichkeit der Harnröhre. Aber auch Empfängnisverhütung oder Ehrung des weiblichen Geschlechtsorgans werden als eventuelle Motivationsgründe genannt (vgl. Kasten 2006), in wieweit dies zutreffend ist, ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.
4.1.6 Piercing
Die beliebteste nicht permanente Form der Körpermodifikation ist das Piercing, welches sich wahrscheinlich gerade wegen der unkomplizierten Entfernung so großer Beliebtheit erfreut. „Piercings, obwohl eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, sind eine der ältesten Arten von Körperschmuck und kommen in sehr vielen frühen Kulturen vor. Schon im Altertum waren in Ägypten Piercings verbreitet“ (Kasten 2006: 48). Piercing heißt übersetzt so viel wie durchbohren oder durchstechen, was den Vorgang ziemlich genau beschreibt. Eine in der Literatur häufig verwendete Definition findet sich bei Greif und Hewitt:
“Piercing involves the insertion of a needle into various areas of the body to create an opening through which decorative ornaments such as jewellery may be worn“ (Greif und Hewitt 1998: 26)
Nach der Auswahl der gewünschten Stelle werden Ein- und Austrittspunkt markiert und die dazwischen liegende Haut mit einer speziellen Zange fixiert. Zum Stechen wird in der Regel eine Venenverweilkanüle mit einem Durchmesser zwischen 1,2 mm und 2,2 mm genutzt, die aus einer Nadel und einem darüber liegenden Plastikschlauch besteht. Nach dem Durchstechen der Haut wird die Nadel entfernt und der Schlauch verbleibt in der Haut, bis das entsprechende Schmuckstück eingebracht wurde. Danach wird der Plastikschlauch entfernt und das Piercing verschlossen. „Im Gegensatz zur Tätowierung werden beim Piercen alle drei Hautschichten durchstochen und die Funktion der Haut wird temporär gestört“ (Feige & Krause 2004: 109). Im Gegensatz zur Tätowierung geht das Anbringen sehr viel schneller, was automatisch auch die Dauer des Schmerzes verkürzt, allerdings ist der kurzzeitige Schmerz heftiger als beim Tätowieren. Die schwerwiegendere Verletzung der Haut hat zur Folge, dass auch die Heilung eines Piercings länger dauert als bei einer Tätowierung.
Auch wenn diese Fälle sicher existieren, nicht jeder mag den Schmerz beim Piercen. „Also was den Schmerz beim Stechen angeht: den hasse ich[24] “ berichtet ein Forumsmitglied auf die Frage wie der Schmerz beim piercen empfunden wird. Eine besondere Art der Piercings sind Surface Piercings oder Oberflächenpiercings. So werden alle Piercings bezeichnet, die an der Körperoberfläche angebracht sind und durch Stellen gehen, die weder konkav noch konvex geformt sind, sodass Ein- und Austrittskanal auf einer Ebene liegen[25]. Für diese Art wurden eigens besondere Stecker entwickelt, die nicht so schnell herauswachsen, wie die zuerst verwendeten Bananabells[26]. Diese Piercings werden Surface Bars genannt, sind u-förmig und besitzen je nach Körperstelle verschiene Austrittswinkel. Wie bei allen Piercings, die einen invasiven Eingriff darstellen, sollte auch bei den Surfaces auf Hygiene beim Stechen und eine korrekte Nachbehandlung geachtet werden.
4.1.7 Tätowierungen
Den Tätowierungen als Form der Bodymodification soll hier etwas mehr Raum gegeben werden, da es mir für das weitere Vorgehen sinnvoll erscheint einen gemeinsamen Wissensstand herzustellen und die Besonderheiten der Tätowierung im Gegensatz zu anderen Körperveränderungen hervorzuheben. Tattoos sind die Körperveränderungen mit der stärksten Bildhaftigkeit, da, auch wenn bei Branding oder Cutting eigene Motive und Bilder auf die Haut gebracht werden können, es keine andere Möglichkeit gibt, so präzise Bilder oder Texte auf der Haut zu realisieren. Wo bei Cutting und Branding schnell die Grenzen des Möglichen erreicht sind und bei Piercings oder Dermal Anchor lediglich Muster möglich sind, so sind die Motivmöglichkeiten bei Tätowierungen grenzenlos. Die Techniken des Tätowierens können in manuell und maschinell unterschieden werden, beiden Methoden gleich ist jedoch das Einbringen von Farbpartikeln in die Lederhaut (vgl. Friederich 1993). Bei dem Vorgang des Tätowierens wird die oberste Hautschicht durchstochen und die Farbpartikel in die Lederhaut (Cutis) eingebracht. Dabei sterben die Zellschichten im Unterhautgewebe ab und daher ist das menschliche Abwehrsystem nicht mehr in der Lage, diese Stoffe abzutransportieren. Die Farbpigmente werden beim Tätowieren in die intakten, unverletzten Zellen mittels des Prozesses der Osmose eingelagert und somit kommt die lebenslange Tätowierung zustande. Erfolgt der Stich nicht tief genug und die Farbe verbleibt in der Epidermis (Oberhaut), verschwindet die Farbe mit der nächsten Hauterneuerung nach 28 Tagen. Wird hingegen zu tief gestochen und die Farbe verbleibt in der Subcutis (Unterhaut), dann verlaufen die Linien des Bildes („Blow-Out“) und es wird von Narbengewebe überdeckt. Heutzutage wird eigentlich nur noch die elektrische Maschine benutzt, obwohl die manuellen Methoden auf Grund ihrer Seltenheit schon wieder an Kultfaktor gewinnen. Das Patent auf die Tätowiermaschine, wie sie heutzutage genutzt wird, ist 1891 von Prof. O’Riley eingetragen worden, nachdem sie 1875 erstmals erprobt wurde. Sie funktioniert ähnlich wie eine elektrische Türklingel. Am Kopf der Maschine befinden sich ein oder zwei Magnetspulen, die durch Zuführung von Strom aktiviert werden. Die über den Spulen befindliche Metallfeder wird von den Spulen angezogen, biegt sich nach unten und bewegt dadurch die angeschlossene Nadel. Wenn die Metallfeder nach unten gezogen wird, unterbricht sie den Stromkreis und die Magnetspulen werden wieder ausgeschaltet, die Feder schwingt wieder nach oben. Dort schließt sie wieder den Stromkreis und das gleiche beginnt wieder von vorne. Dadurch werden die an der Feder angeschlossenen Nadeln auf und ab bewegt. Manche Tätowierer erhöhen die Spannung der Feder, indem sie zusätzlich Gummibänder um die Pistole spannen. Die dadurch konstant gehaltene Stichfrequenz gewährt einen gleichmäßigen Druck und gleich bleibenden Farbstich. Die Geschwindigkeit, die an dem Netzteil der Maschine eingestellt wird, liegt zwischen 30 und 40 Stichen pro Sekunde (vgl. Friederich 1993). Der Vorgang des Tätowierens ist sehr zeitaufwendig und kann je nach Größe des Motivs auch mehrere Sitzungen über Monate oder Jahre verteilt in Anspruch nehmen. Das Stechen wird in Fachkreisen auch als „Exogene Pigmentierung“ bezeichnet, was so viel heißt wie „von außen eingebrachte Hautfärbung.“
4.2 Besonderheiten der Tätowierung und Vergleich mit dem Piercing
Schon beim Vergleich der Definitionen von Piercigs und Tätowierungen wird die Diskrepanz beider Formen der Körperveränderungen deutlich. So definiert der Brockhaus Piercing als: "Durchbohren oder Durchstechen der Haut zum Anbringen von Körperschmuck" (Brockhaus 2005). Mit einer Tätowierung hingegen werden Partikel dauerhaft in die Haut eingelagert und so ein Bild erzeugt, was persönliche Elemente des Tätowierers und des Tätowierten trägt. Der Künstler, wie sich die meisten Tätowierer heute bezeichnen, hat die Möglichkeit seinen künstlerischen Ausdruck in die Tätowierung einfließen zu lassen. Dem Piercer, der zwar auf die korrekte Position achten muss, sich aber sonst auf medizinische Aspekte konzentriert, bleibt das Ausleben seiner Kreativität verwehrt. Hinzu kommt, dass sich der Vorgang des Anbringens und die Nachbehandlung von Tätowierungen und Piercings deutlich unterscheiden, genauso wie das Schmerzempfinden und die Motive die Menschen zu diesen Körperveränderungen bewegen. Ein Piercing ist ein Schmuckstück, das zwar ebenfalls Ausdruck eines Lebensgefühls zu einem bestimmten Zeitpunkt sein kann, allerdings fehlt ihr die Permanenz, welche charakteristisch für die Tätowierung ist. Hingegen ist ein Piercing der Willkür des Trägers unterworfen, so kann das Schmuckstück der Laune oder der Kleidung angepasst oder entfernt werden. Tätowierungen sind permanent und sind in ihrem Ausdruck und in ihrer Motivik sehr variabel. Auch wenn allen Körpermodifikationen die bewusste Veränderung des Körpers zugrunde liegt, sollte meines Erachtens eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Formen erfolgen, da sie sich in ihren sozialen und psychologischen Funktionen für die Betroffenen sehr stark unterscheiden.
5. Die Haut als Träger der Tätowierung
Der Haut kommt als Träger der Tätowierung eine besondere Bedeutung zu. Sie begleitet uns das ganze Leben über, sie grenzt uns als Subjekt von unserer Umwelt ab und gleichzeitig können wir über sie Kontakt zu unseren Mitmenschen aufnehmen. Unsere Haut errötet vor Scham, zeigt krankhafte Veränderungen wenn wir Stress haben oder zeigt eine Gänsehaut wenn uns etwas sehr berührt. Der Haut kommen neben wichtigen physiologischen Funktionen auch bedeutende zwischenmenschliche und psychische Funktionen zu, die im Folgenden genauer betrachtet werden sollen. Im Zusammenhang mit der Tätowierung steht besonders die nonverbale Kommunikation im Fokus, zuvor sollen jedoch biologische Grundlagen der Funktion und des Aufbaus der Haut ihre große Bedeutung verdeutlichen.
[...]
[1] Tattoo ist der englische Begriff für die Tätowierung und kann synonym genutzt werden
[2] http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,560276,00.html
[3] Etymologie ist eine Richtung der vergleichenden Sprachwissenschaft, die Herkunft, Grundbedeutung und historische Entwicklung der Wörter sowie ihre Verwandtschaft mit Wörtern gleichen Ursprungs untersucht. (Meyers Lexikon)
[4] Das Sanskrit ist die klassisch gewordene Form des Altindischen, das zur indoarischen Gruppe der indogermanischen Sprachen gehört; in der durch Grammatiker (v.a. Panini, 5.Jahrhundert v.Chr.) normierten Gestalt bis 1000 n.Chr. alleinige Literatursprache, bis heute gepflegt als Gelehrtensprache und als heilige Sprache der Brahmanen. (Meyers Lexikon)
[5] Cesare Lombroso wurde 1935 in Verona geboren. Er war ein italienischer Arzt und Professor für gerichtliche Medizin und Psychatrie. Er wird als Begründer der Kriminologie bezeichnet. (Brockhaus)
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4towierung
[7] Atavismus bezeichnet das Wiederauftauchen von Eigenschaften weit entfernter Vorfahren beim Menschen
[8] Bodymodification oder kurz BodMod ist der englische Begriff für Körpermodifikation. Laut Erich Kasten bezeichnen sie alle Veränderungen, die am menschlichen Körper vorgenommen werden. (Kasten 2006) Nach allgemeinem Verständnis in der Gemeinschaft sind alle BodMods mit Schmerzen verbunden und bezeichnen ein Lebensgefühl.
[9] Tattoo Conventions sind Messen für Tätowierte und Interessenten, bei denen Berufstätowierer ihre Werke ausstellen und Händler alle nötigen Materialien anbieten. Zusätzlich gibt es Wettbewerbe für Tätowierungen aller Art und Unterhaltungsprogramme für die Besucher. Allgemein kann man sagen, dass sich alle Besucher in der Gemeinschaft zusammengehörig fühlen, da sie das Interesse für die Körperkunst verbindet.
[10] Brandings können mit dem Brandmarken eines Tiers mit einem Stempel verglichen werden.
[11] Cuttings sind Formen und Muster, die mit Hilfe eines Skalpells in die Haut geschnitten werden.
[12] dermal Anchors, die auch Mikrodermals genannt werden sind übersetzt Hautanker und sind eine recht junge Form der BodMods, die sich zurzeit großer Beliebtheit erfreuen.
[13] Als Bodmoder werden Menschen bezeichnet, die ihren Körper modifizieren, unabhängig davon ob es dauerhaft ist oder nicht.
[14] Bei salinen Injektionen wird physiologische Kochsalzlösung in verschiedene Körperteile injiziert mit dem Ziel diese Körperteile für eine Dauer von wenigen Stunden auf die doppelte Größe anschwellen zu lassen
[15] http://wiki.bmezine.com/index.php/Subdermal_Implant
[16] http://wiki.bmezine.com/index.php/Transdermal_Implant
[17] http://www.piercing-magazin.de
[18] http://www.wildcat.de
[19] http://de.wikipedia.org/wiki/Suspension
[20] http://www.suspension.org
[21] Skarifizierungen oder auch Scarification kommen vom englischen Wort „scar“ was soviel wie Narbe bedeutet. (Kasten 2006) Skarifizierung ist ein Überbegriff unter den viele verschiedene Arten der Narbenbildung fallen.
[22] http://www.bmezine.com
[23] http://wiki.bmezine.com/index.php/Genital_Bisection
[24] www.piercing.de
[25] http://dermal-anchor.crazy-ink-tattoo.de/
[26] Bananabells werden gebogene Piercingstäbe genannt, die aufgrund ihrer Form aussehen wie eine Banane.
- Quote paper
- Lydia Rüger (Author), 2009, Biographien, die unter die Haut gehen. Die Tätowierung als Ausdruck und Spiegel sozialer Entwicklungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133933