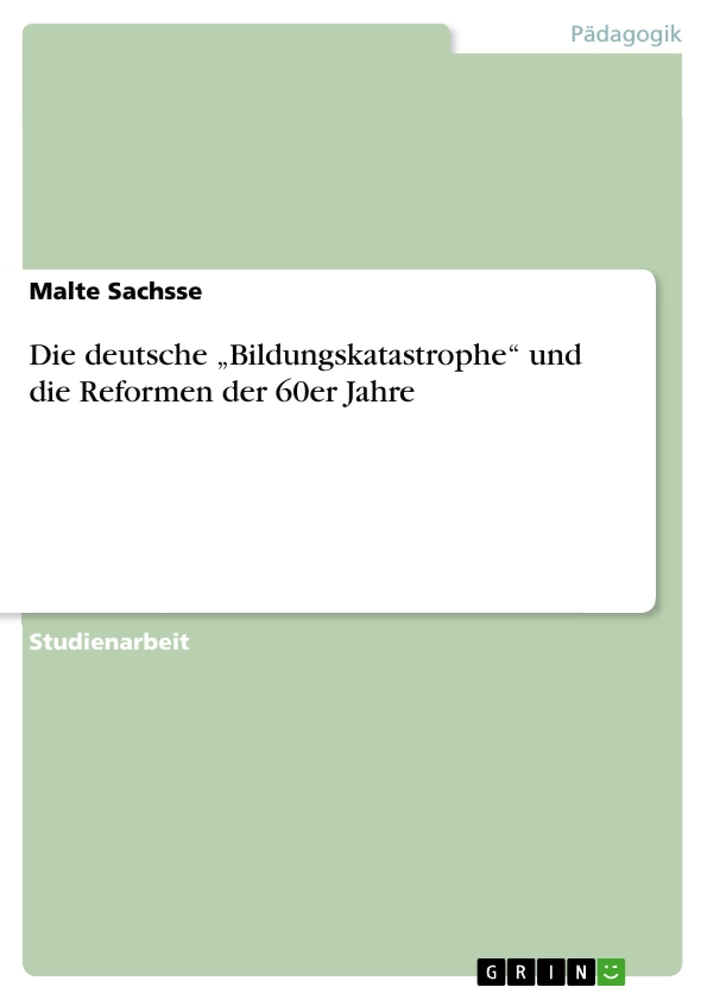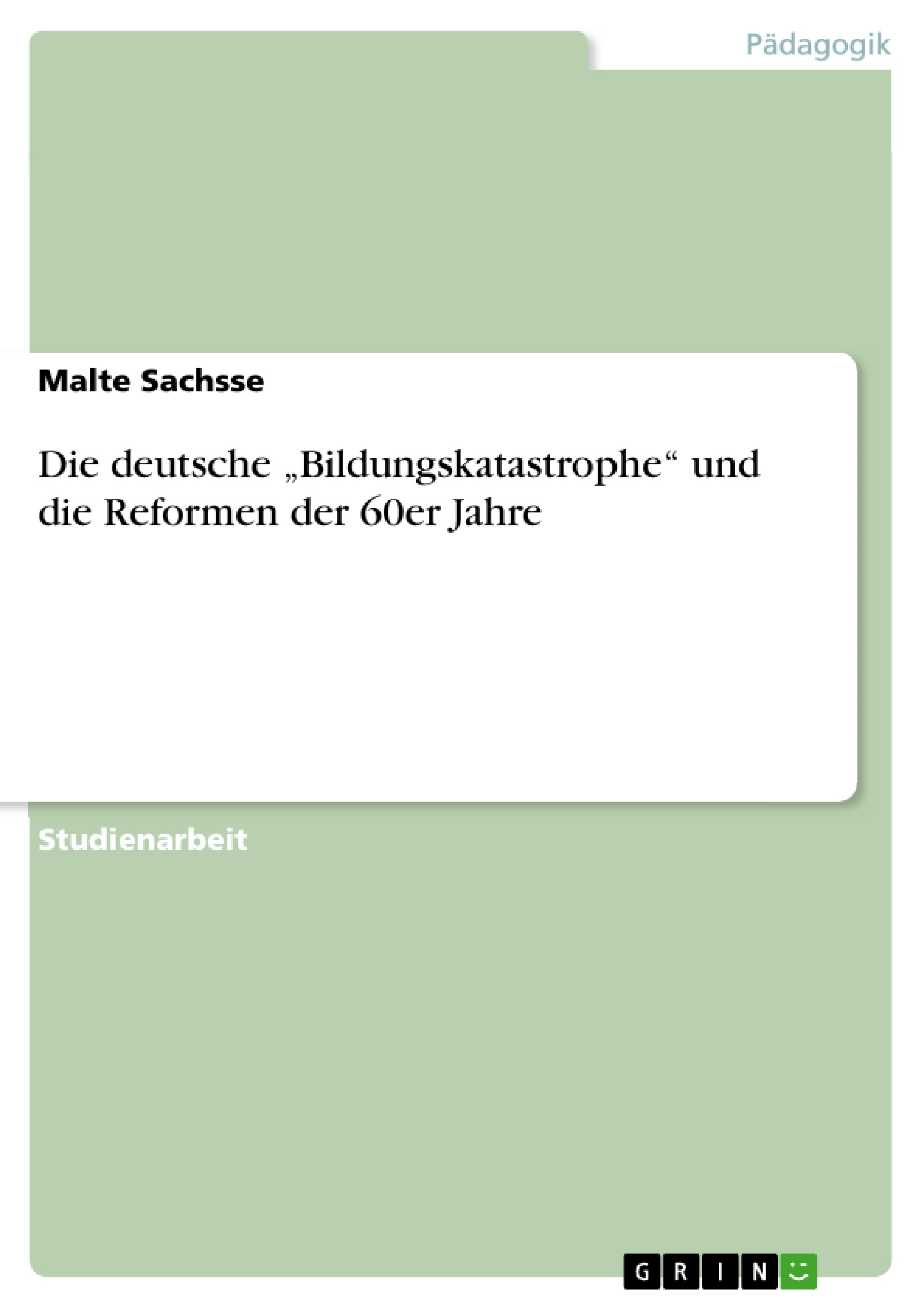Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland erfuhr in den 1960er Jahren tiefgreifende Veränderungen. In Reaktion auf eine massive Bildungsexpansion insbesondere der weiterführenden Sekundarschulen und Hochschulen, neue wirtschaftliche Herausforderungen und weiterhin ungelöste soziale Strukturprobleme wurde eine Diskussion in Gang gesetzt, die den Boden für umfangreiche Reformen und Reformansätze des Schulwesens bereitete. Die Kritik am deutschen Bildungssystem fand ihre Zuspitzung in dem von Georg Picht 1965 geprägten Schlagwort der „Deutschen Bildungskatastrophe“. Die vorliegende Arbeit untersucht die Argumente der Reformer, die gesellschaftlichen Hintergründe der Reform und fragt nach ihren tatsächlichen Ergebnissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motive der Schulreformen
- Picht und das ökonomische Motiv
- Dahrendorf und das Motiv der Chancengleichheit
- Bildungsexpansion
- Symptome, Ursachen und Wirkungen
- Reflektion
- Bildungspolitische Reformen und Reformkonzepte
- Institutionelle Reformbemühungen im parteipolitischen Kontext
- Der „Strukturplan für das Bildungswesen" des Deutschen Bildungsrates
- Voraussetzungen
- Der „Strukturplan"
- Bildungsplanung in der Krise
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die tiefgreifenden Veränderungen des deutschen Bildungswesens in den 1960er Jahren, die als Reaktion auf Bildungsexpansion, wirtschaftliche Herausforderungen und ungelöste soziale Probleme entstanden sind. Sie untersucht die Motive der Schulreformen, insbesondere das ökonomische Motiv, das auf die wirtschaftliche Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit der BRD zielte, sowie das Motiv der Chancengleichheit zwischen sozialen Gruppen. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen und Folgen der Bildungsexpansion und analysiert die Reformkonzepte, die in Reaktion auf die Kritik initiiert wurden, einschließlich des „Strukturplans für das Bildungswesen" des Deutschen Bildungsrates. Die Ergebnisse werden reflektiert und im Hinblick auf die gegenwärtige Bildungsdiskussion interpretiert.
- Die „Deutsche Bildungskatastrophe" und ihre Ursachen
- Die Rolle von Georg Picht und Ralf Dahrendorf in der Reformdiskussion
- Die Bildungsexpansion und ihre Auswirkungen
- Bildungspolitische Reformen und Reformkonzepte
- Der „Strukturplan für das Bildungswesen" und seine Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Reformdiskussion der 1960er Jahre im deutschen Bildungswesen vor und erläutert die Ursachen und Folgen der „Bildungskatastrophe". Sie führt die beiden Hauptmotive der Reformen ein: das ökonomische Motiv, das auf die wirtschaftliche Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit der BRD zielte, sowie das Motiv der Chancengleichheit zwischen sozialen Gruppen. Die Einleitung stellt die wichtigsten Protagonisten der Reformdiskussion, Georg Picht und Ralf Dahrendorf, vor und skizziert die Gliederung der Arbeit.
Das Kapitel „Motive der Schulreformen" analysiert die Argumente von Georg Picht und Ralf Dahrendorf. Pichts ökonomisches Motiv basiert auf der These, dass Bildungsnotstand wirtschaftlichen Notstand bedeute. Er kritisiert das deutsche Bildungssystem als unzureichend, um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken und fordert ein „Notstandsprogramm", das die Abiturientenzahl verdoppeln und die Lehrerausbildung verbessern soll. Dahrendorf hingegen betont das Recht auf Bildung als soziales Grundrecht und fordert eine „aktive Bildungspolitik", die materielle Chancengleichheit zwischen sozialen Gruppen sicherstellen soll. Er kritisiert Pichts „Notstandsdiagnose" als reaktive statt aktive Bildungspolitik und plädiert für eine umfassende gesellschaftliche Veränderung, die die Bildungsinfrastruktur verbessert und die Bildungsbeteiligung aller Bürger fördert.
Das Kapitel „Bildungsexpansion" untersucht die Ursachen und Folgen der massiven Zunahme der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen in den 1960er Jahren. Die demographische Entwicklung, die gestiegenen Bildungswünsche von Eltern und Schülern sowie die höheren Qualifikationsanforderungen in der Wirtschaft haben die Bildungsexpansion vorangetrieben. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die Schulorganisation und die Lehrerausbildung und reflektiert die Kritik an der „Akademikerschwemme" und dem „Niveauverlust" der Abiturienten.
Das Kapitel „Bildungspolitische Reformen und Reformkonzepte" beleuchtet die institutionellen Reformbemühungen im parteipolitischen Kontext. Die Arbeit beschreibt die bildungspolitischen Leitsätze der verschiedenen Parteien und die Entstehung des Deutschen Bildungsrates. Sie analysiert die Empfehlungen des Bildungsrates, insbesondere den „Strukturplan für das Bildungswesen", der ein Stufenschulsystem mit einer schulformunabhängigen Orientierungsstufe und einer starken Verzahnung von beruflicher und allgemeiner Bildung vorschlug. Das Kapitel untersucht die Voraussetzungen für die Entstehung des „Strukturplans" und die Probleme bei seiner Umsetzung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die deutsche „Bildungskatastrophe", die Schulreformen der 1960er Jahre, Bildungsexpansion, Chancengleichheit, Georg Picht, Ralf Dahrendorf, der Deutsche Bildungsrat, der „Strukturplan für das Bildungswesen", Gesamtschule, Orientierungsstufe und Bildungsplanung. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Folgen der Reformdiskussion und beleuchtet die Herausforderungen der Bildungspolitik im Kontext der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der 1960er Jahre.
- Quote paper
- Malte Sachsse (Author), 2007, Die deutsche „Bildungskatastrophe“ und die Reformen der 60er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133847