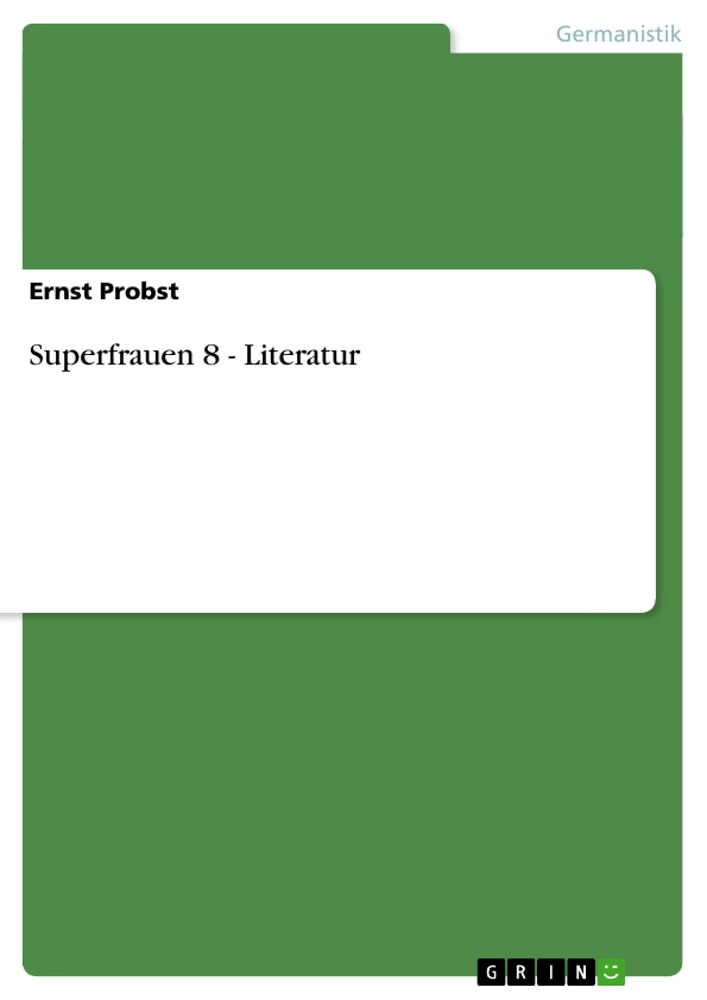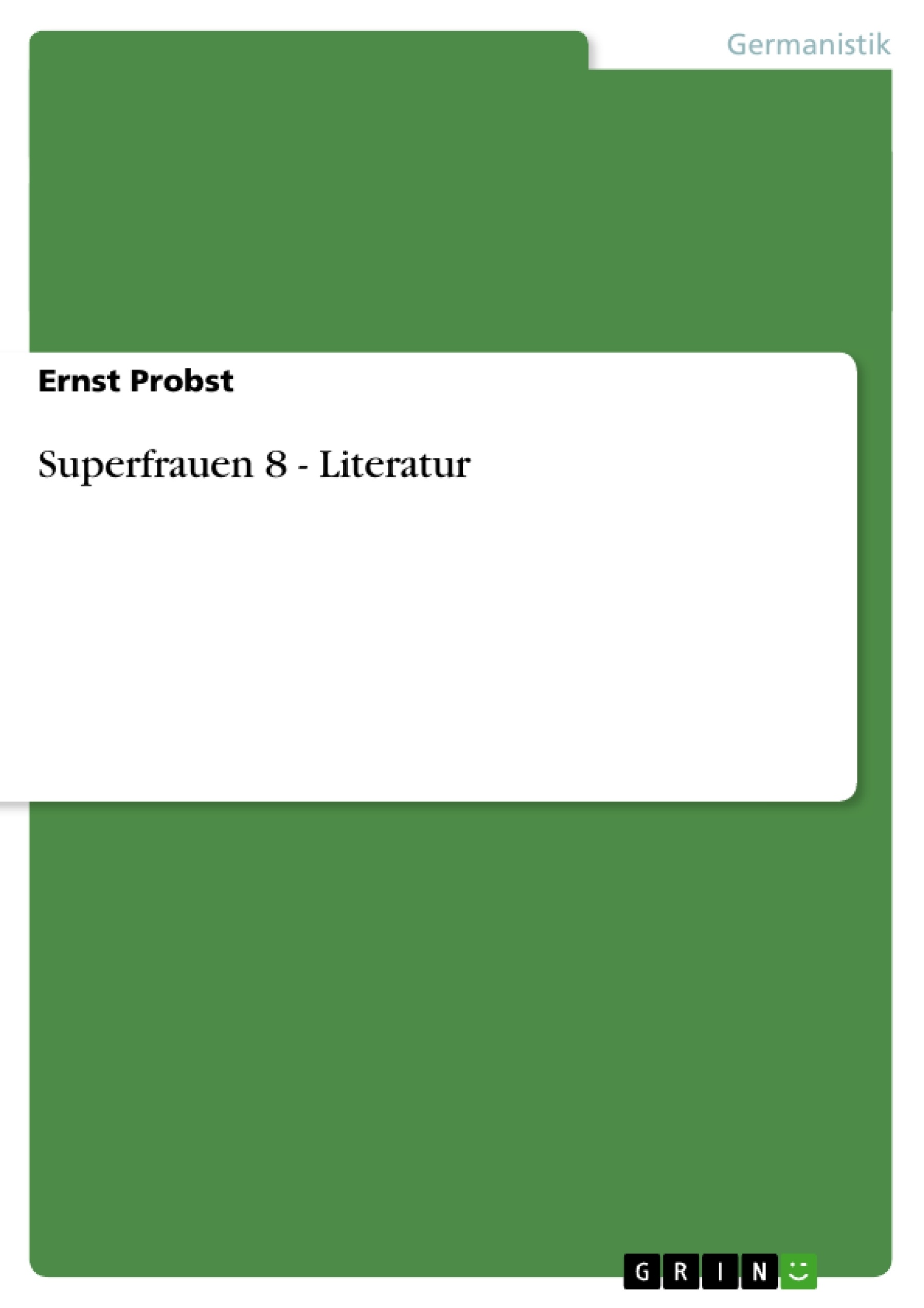Der Vater von Vicki Baum (1888–1960) betrachtete Bücher als Schmutz und Schund. Als seine Tochter für eine kleine Geschichte einen Preis gewann, forderte er ihr heiliges Ehrenwort, sie solle niemals mehr in ihrem Leben auch nur eine Zeile schreiben. Doch die 14-Jährige folgte ihm nicht, verließ die väterliche Wohnung und wurde später eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der 1940-er und 1950-er Jahre. Verständnislos und ablehnend reagierte die Bevölkerung des Heimatdorfes von Grazia Deledda (1871–1936), der späteren ersten Nobelpreisträgerin Italiens für Literatur, auf deren frühe Abdruckerfolge. Um weiteren negativen Reaktionen ihrer Nachbarn vorzubeugen, wählte sie für einen Fortsetzungsroman in einer Tageszeitung ein Pseudonym. Auch die Anfänge von Enid Blyton (1897–1968), die mit mehr als 700 Abenteuerbüchern als Großbritanniens fleißigste Kinder- und Jugendbuch- Autorin gilt, waren nicht ermutigend. Als sich zuhause Hunderte von abgewiesenen Manuskripten häuften, kritisierte ihre Mutter, dass sie so viel Geld für Papier, Umschläge und Porto ausgab und hielt die schriftstellerische Tätigkeit ihrer Tochter für Zeitverschwendung. Die Schicksale dieser drei weltberühmt gewordenen Autorinnen belegen, wie schwer es schreibende Frauen früher hatten, sich als Schriftstellerinnen durchzusetzen. Doch sie gingen trotz aller Widerstände ihren Weg und schafften irgendwann den Durchbruch. Das vorliegende Taschenbuch „Superfrauen 8 – Literatur“ von Ernst Probst schildert das Leben und Werk von zahlreichen Schriftstellerinnen und Lyrikerinnen in Wort und Bild. Es zeigt auf, wie sehr diese talentierten Frauen früher unter ihren verständnislosen Eltern, Ehemännern und Zeitgenossen litten. Leider gibt es solche Verhaltensweisen teilweise auch heute noch.
Inhaltsverzeichnis
Dank
Vorwort
Anna Achmatowa
Die „tragische Muse
der russischen Poesie“
Isabel Allende
Die Bestsellerautorin aus Chile
Bettina von Arnim
Die große Frau der jüngeren Romantik
Ingeborg Bachmann
Die Grenzgängerin aus Kärnten
Vicki Baum
Die vielgelesene Autorin
Harriet Beecher-Stowe Die Frau, von der „Onkel Toms Hütte“ stammt
Tania Blixen
Dänemarks
große Schriftstellerin
Enid Blyton
Die „geistige Mutter“ von
Hanni und Nanni
Anne, Charlotte und Emily Jane Brontë
Das Autorinnentrio aus England
Christine Brückner
Die „Enkelin von Theodor Fontane“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pearl S. Buck
Die „Mittlerin zwischen Ost und West“
Carmen Sylva
Die königliche Dichterin
Barbara Cartland Liebesgeschichten
am laufenden Band
Rosalía de Castro
de Murguía
Die Symbolgestalt
der galicischen Literatur
Agatha Christie
Die Autorin, die
„Miss Marple“ ersann
Patricia Cornwell
Die amerikanische
Thrillerautorin
Hedwig Courths-Mahler
Die „Meisterin
des Happy-End“
Utta Danella
Die deutsche
Bestsellerautorin
Gracia Deledda
Die Literatur- nobelpreisträgerin
aus Sardinien
Emily Dickinson
Das Mysterium
von Liebe und Tod
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Marie von
Ebner-Eschenbach
Die „Meisterin
kluger Aphorismen“
George Eliot
Englands erste moderne
Romanautorin
Anne Frank
Ihr Tagebuch ergriff die Welt
Nadine Gordimer
Die weiße Gegnerin
der Apartheid
Thomasine Gyllembourg Die „Schöpferin der bürgerlichen Novelle“
Daphne du Maurier Klementyna Hoffmanowa
Die britische Die erste Polin, die
Bestsellerautorin / vom Schreiben lebte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sarah Orne Jewett
Die „Meisterin der
Local-color-Literatur“
Anna Luise Karsch
Die dichtende Kuhmagd
Helen Keller
Die blinde, stumme
und taube Autorin
Marie-Madeleine Gräfin von La Fayette
Die „Meisterin des psycho-logischen Romans“
Selma Lagerlöf
Die erste Nobelpreisträgerin
für Literatur
Sophie La Roche Deutschlands erste Unterhaltungsautorin
Astrid Lindgren
Die „geistige Mutter“ von
„Pippi Langstrumpf“
Katherine Mansfield
Englands
erfolgreiche Erzählerin
Karin Michaëlis
Die Autorin
der Mädchenbücher über
„Bibi“
Gabriela Mistral
Chiles Nobelpreisträgerin
für Literatur
Tony Morrison
Die erste schwarze
Literatur-
nobelpreisträgerin
Bozena Nemcová
Die „Meisterin
tschechischer Prosa“
Sandra Paretti
Der „weibliche
Konsalik“
Ida Pfeiffer
Die Weltreisende
aus Wien
Nelly Sachs
Die leidende
deutsche Dichterin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
George Sand
Die „Meisterin
des problematisierenden
Frauenromans“
Sappho
Die „zehnte Muse“
Caroline von Schlegel
Die große Frau
der Frühromantik
Anna Seghers
Weltruhm mit
„Das siebte Kreuz“
Mary Shelley
Frankensteins „geistige Mutter“
Edit Sitwell
Die „Wegbereiterin des literarischen Modernismus“
Edit Södergran
Die bahnbrechende Lyrikerin
des Modernismus
Johanna Spyri
Die Autorin,
die „Heidi“ erdachte
Madame de Staël
Sie prägte
das Deutschlandbild
der Franzosen
Gertrude Stein
Die „Mutter der verlorenen
Generation“
Sigrid Undset
Die norwegische Literatur- nobelpreisträgerin
Anne Sexton Else Ury
Die geisteskranke Die Autorin
Dichterin von „Nesthäkchen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Weitere Schriftstellerinnen
Ilse Aichinger – Aspazija – Louise Aston – Jane Austen – Elisabeth Bekker-Wolff – Victoria Bendictsson – Marie Bregendahl – Fredrika
Bremer – Irja Agnes
Browallius – Friederike Brun – Minna Canth – Willa Sibert Cather – Alba de Céspedes – Mary Chase – Mary Ellen Chase – Helmina von Chézy – Ada Christen – Sidonie-Gabrielle Colette – Vittoria Colonna – Marceline Desbordes-Valmore – Ingeborg Drewitz – Annette von Droste-Hülshoff – Edna Ferber – Rachel Field – Marieluise Fleißer – Louise von François – Hrotsvith von Gandersheim – Hulda Garborg – Elisabeth Gaskell – Stéphanie Félicité Genlis – Marie Gevers – Ellen Glasgow – Catharina Regina von Greiffenberg – Karoline von Günderode – Ida von Hahn-Hahn – Enrica von Handel-Mazzetti – Thea von Harbou – Luise Hensel – Patricia Highsmith – Sophie
Hoechstetter – Klara Hofer – Ricarda Huch – Tove Marika Jansson – Thit Jensen – Juana Inés de la Cruz – Sarah Kirsch – Annette Kolb – Gertrud Kolmar – Anna von Krane – Marie Kuncewiczowa – Isolde Kurz – Carmen Laforet – Elisabeth Langgässer – Else Lasker-Schüler – Mary Lavater-Sloman – Anna Charlotte Leffler – Gertrud Le Fort – Rosamond (Nina) Lehmann – Doris Lessing – Fanny Lewald – Marie de France – Eugene Marlitt – Moa Martinson – Zenta Maurina – Sophie Mereau – Agnes
Miegel – Margaret Mitchell – Marianne (Graig) Moore – Anna-Elisabeth de Noailles – Betty Paoly – Christine de Pisan – Katherine Anne Porter – Alja Rachmanowa –Gabriele Reuter – Emmy von Rhoden – Barbra Ring – Luise Rinser – Elizabeth Madox Roberts – Mazo de La Roche – Nini Roll-Anker – Elizabeth Rowe – Victoria Sackville-West – François Sagan – Claire Sainte-Soline – Sally Salminen – Lou Andreas Salomé –
Dorothy Leigh Sayers – Ruth Schaumann – Murasaki Schibuku – Dorothee Schlegel – Olive Schreiner – Ina Seidel Marie de Rabutin-Chantal Sévigné – Amalie (Berthe) Skram – Marguerite Steen – Alfonsina Storni – Lulu von Strauß und Torney – Auguste Supper – Maila Talvio – Regina Ullmann – Maria Under – Astrid Vaering – Rahel Varnhagen – Dorothee von Velsen – Clara Viebig – Mary Gladys Webb – Christa Wolf
Literatur
Bildquellen
Der Autor
Bücher von Ernst Probst
Dank
Für Auskünfte, kritische Durchsicht von Texten
(Anmerkung: Etwaige Fehler gehen zu Lasten des Verfassers), mancherlei Anregung, Diskussion und andere Arten der Hilfe danke ich herzlich:
Tamara Aebischer, Diplom-Philologin, Frauenkappelen
Dr. Ángel Diaz Arenas, Bibliothekar, Institutio Cervantes,
München
Ingrid Arnhold, Abteilungsleiterin, Stiftung Weimarer Klassik,
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar
Ken Bastura, Library Consultant, Harriet Beecher Stowe Center,
Hartford, Connecticut
Werner Baumbauer, Mackenrodt
J. Beaumont, Hatfield, Herfordshire
Alexander von Behaim-Schwartzbach, Inzlingen
Rolf-Ingo Behnke, Diplom-Bibliothekar, Stadtbibliothek Salzgitter
Rainer Biermann, Universitet Bergen, Nor]wegen
Dr. Friedrich Block, Stiftung Brückner-Kühner, Kassel
Dipl.-Ing. Jan Bondy, Direktor, Tschechisches Zentrum,
Berlin
Rosamaria Brandt, Marburg
Marianne Brentzel, Dortmund
Peter Bromdsgaard, Presse & Kulturmitarbeiter, Königlich
Dänische Botschaft, Berlin
Konstanze Buchholz, Stadtarchiv Magdeburg
Dr. Manana Chelaia-Gabaschwili, Botschaft von Georgien
in der Bundesrepublik Deutschland
Eva Dambacher, Deutsches Literatur Archiv, Bibliothek,
Marbach
Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main
Dickinson Homestead, Amherst
Ann Dinsdale, The Brontë Society,
Brontë Parsonage Museum, Hayworth
Irmhild Eulenstein, Deutsch-Chilenischer Freundeskreis
e. V., Bonn
Jaap Ferwerda, Harlingen
Simone Finch, Archivist, Leisure & Community Services,
Bromley
Friedrich Wilhelm Fürst zu Wied, Neuwied/Rhein
Waldemar Gerr, Russisch.com – Lehrmittel und Medien für
russische Sprache
Isabel L. Gluschak, Kaarst
Nadine Gordimer, Literaturnobelpreisträgerin,
Johannesburg
Marco Guenther, Universität Kaiserslautern
Philip Harper, Webmaster
Hartford Public Library, Hartford
Hessische Allgemeine, Archiv, Kassel
Uwe Heye, Botschaftsrat, Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland, Pretoria
Ulrich Katte, Moskau
Frank-Roland Klaube, Stadtarchivar, Stadt Kassel
Dr. Elisabeth Lange, Bonn
Caroline Lüderssen, Redaktion Italienisch, Frankfurt am Main
Dr. Doris Maurer, Bonn
Ian Middleton, Senior Researcher, Reuters Ltd, London
Beate Mnich, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart
Michael Mühlenhort, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Deutsches Seminar I
Michel Müller, Universität Leipzig
Bernd Neu, Archivar, Ingelheim
Elzbieta Panitzek, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt
Mireille Pastoreau, Conservateur Général, Bibliothèque, Institut de
France, Paris
Piper Verlag GmbH, München
Karen Klitgaard Povlsen, University of Aarhus,
Scandinavian Cultural Studies
Doris Probst, Mainz-Kostheim
Stefan Probst, Mainz-Kostheim
Rex Pyle, New York Public Library
Dr. Pierre Radvanyi, Institut de Physique Nucleaire,
Universite Paris-Sud
Mag. Susanne Reichl, Universität Wien, Institut für Anglistik
und Amerikanistik
Rhein-Zeitung, Archiv, Koblenz
Robert Schindler, Mering
Dr. Hildegard Emilie Schmidt, Neuwied/Rhein
Schwedische Botschaft
Elizabeth Silverthorne, Archivist, Leisure & Community Services,
Bromley
Britta Söderlund, Svenska Institutet, Stockholm
Robert Stimpel, Lahr
Yt Stocker, Anne-Frank-Haus, Amsterdam
Silvia Stöcker-Ratzke, dpa-Dokumentation,
Ressort Ausländische Personen, Hamburg
Elvira J. Stoit, Darmstadt
Dr. Moritz Graf Strachwitz, Deutsches Adelsarchiv, Marburg
Ludwig Tessler, Bad Goisern
Dr. Ingo Toussaint, Universitätsbibliothek Bayreuth
Rosemarie Tschirky. Leiterin, Schweizerisches Jugendbuch-
Institut, Johanna Spyri-Stiftung, Zürich
Ilse Tschörnter, Neue Gesellschaft für Literatur, Berlin
Frank Wagner, stellvertretender Vorsitzender der Anna-Seghers-
Gesellschaft, Berlin
Treuhand G. Weidmann, Basel
University of Nottingham Library, Nottingham
Els Warris, Jorwerd, Niederlande
Esther Weiß, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Pretoria
Silke Weitendorf,
Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg
Mag. Maria Wilflinger, Österreichische Nationalbibliothek,
Abteilung Wissenschaftliche Information, Wien
Monika Wimschneider, München
Peter Wojtischek, Lauffen
Ingrid Wölbling, Leiterin, Hedwig Courths-Mahler-Archiv,
Nebra/Unstrut
Barbara Zenker, British Council Informations Centre, Köln
Vorwort
Schreibende Frauen
hatten es schwer
D
er Vater von Vicki Baum (1888–1960) betrachtete Bücher als Schmutz und Schund. Als seine Tochter für eine kleine Geschichte einen Preis gewann, forderte er ihr heiliges Ehrenwort, sie solle niemals mehr in ihrem Leben auch nur eine Zeile schreiben. Doch die 14-Jährige folgte ihm nicht, verließ die väterliche Wohnung und wurde später eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der 1940-er und 1950-er Jahre.
Verständnislos und ablehnend reagierte die Bevölkerung des Heimatdorfes von Grazia Deledda (1871–1936), der späteren ersten Nobelpreisträgerin Italiens für Literatur, auf deren frühe Abdruck-erfolge. Um weiteren negativen Reaktionen ihrer Nachbarn vorzu-beugen, wählte sie für einen Fortsetzungsroman in einer Tageszeitung ein Pseudonym.
Auch die Anfänge von Enid Blyton (1897–1968), die mit mehr als 700 Abenteuerbüchern als Großbritanniens fleißigste Kinder- und Jugendbuch- Autorin gilt, waren nicht ermutigend. Als sich zuhause Hunderte von abgewiesenen Manuskripten häuften, kritisierte ihre Mutter, dass sie so viel Geld für Papier, Umschläge und Porto ausgab und hielt die schriftstellerische Tätigkeit ihrer Tochter für Zeit-verschwendung.
Die Schicksale dieser drei weltberühmt gewordenen Autorinnen belegen, wie schwer es schreibende Frauen früher hatten, sich als Schriftstellerinnen durchzusetzen. Doch sie gingen trotz aller Widerstände ihren Weg und schafften irgendwann den Durchbruch.
Das vorliegende Taschenbuch „Superfrauen 8 – Literatur“ von Ernst Probst schildert das Leben und Werk von zahlreichen Schrift-stellerinnen und Lyrikerinnen in Wort und Bild. Es zeigt auf, wie sehr diese talentierten Frauen früher unter ihren verständnislosen Eltern, Ehemännern und Zeitgenossen litten. Leider gibt es solche Verhaltensweisen teilweise auch heute noch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anna Achmatowa
Die „tragische Muse der russischen Poesie“
A
ls Russlands größte Dichterin gilt die Lyrikerin Anna Achmatowa (1889–1966), geborene Anna Gorenko. Das Pseudonym „Ach-matowa“, unter dem sie ihre Werke veröffentlichte, wählte sie in Anlehnung an ihre tatarische Großmutter. Ihre in einfacher und prägnanter Sprache verfassten Gedichte waren in ihrer Heimat jahrelang verboten. Deswegen nannte man sie „tragische Muse der russischen Poesie“.
Anna Andrejewna Gorenko wurde am 23. Juni 1889 als Tochter eines Marineoffiziers in Bolschoi Fontan bei Odessa (Ukraine) geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Gegend von Sankt Petersburg (Russland). Dort lebte sie unter anderem in Zarskoje Selo (Puschkin), der Sommerresidenz des russischen Zarenhofs, wo sie die exklusivste Schule besuchte. Sie war eine schlechte Schülerin, verfasste aber bereits als Elfjährige ihre ersten Gedichte.
Die Familie von Anna Gorenko zog 1905 in die Stadt Evpatoria (Jewpatorija) am Ufer des Schwarzen Meeres auf der Halbinsel Krim, wo sie ein Jahr lang lebte und dann in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Nach dem Verlassen des Funduklejew-Gymnasiums studierte das Mädchen zunächst Jura an der Frauenhochschule in Kiew sowie später Geschichte und Literatur in Sankt Petersburg.
Seit 1907 druckten verschiedene Zeitschriften Anna Achmatowas Gedichte ab. 1910 schloss sie sich den Akmeisten an, einer Gruppe russischer Lyriker, die als Reaktion gegen die Symbolisten entstand. Die Akmeisten forderten – vor allem in ihrer Zeitschrift „Appolón“ (1909–1917) – eine klare, rationale dichterische Sprache. Damit setzten sie sich von der geschraubten, nebelhaften Diktion der Symbolisten und von dem grellen Erneuerungspathos vieler Futu-risten ab.
1910 heiratete Anna Achmatowa das geistige Haupt der Akmeisten, den russischen Dichter Nikolaj Gumiljow (1886–1921). Das Ja-Wort beendete eine Reihe von Selbstmordversuchen ihres Bewerbers, dem sie 1912 den Sohn Lew gebar. Der Ehemann unterschätzte ihre dichterische Begabung und beneidete sie zeitweise um ihre literarischen Erfolge. Es kam zur Trennung und 1918 zur offiziellen Scheidung. Gumiljow wurde im August 1921 während des Bür-gerkrieges wegen Verdachts der Teilnahme an „konterrevolutionären Aktionen“ von der Tscheka erschossen.
Als zweiter Ehemann Anna Achmatowas folgte von Dezember 1918 bis 1922 der Assyriologe und Poet Val’demar Kazimirovic Schileiko (1891–1930). Auch die Ehe mit ihm scheiterte.
Anna Achmatowas erster Sammelband mit Gedichten trug den Titel „Der Abend“ (1912). Es folgten die Gedichtsammlungen „Rosenkranz“ (1914) und „Weiße Schar“ (1917). Mit diesen Veröffent-lichungen gehörte sie vor der Oktoberrevolution 1917 zur Avantgarde der jungen russischen Dichtung. Doch dann warf man ihr Volks-fremdheit und Dekadenz vor, weil sie der bolschewistischen Revolution äußerst reserviert gegenüberstand.
Die nächsten Sammelbände Anna Achmatowas mit den Titeln „Wegerich“ und „Anno domini MCMXXI“ (beide 1921) erschienen in Berlin. Obwohl in der Sowjetunion von ihr nichts mehr veröffentlicht werden durfte, lehnte sie eine Emigration mit ihrem Sohn Lew ab, arbeitete in der Bibliothek eines Agronomischen Instituts und als Übersetzerin.
1923 vermählte sich Anna Achmatowa zum dritten Mal. Ihr Gatte war der Kunsthistoriker N. N. Punin (1888–1953). Die Ehe mit ihm dauerte 15 Jahre lang bis 1938.
Vor Mitte der 1920-er Jahre studierte Anna Achmatowa die Architektur von Alt-Petersburg. Außerdem befasste sie sich mit dem Leben und Werk des russischen Dichters Alexandr Sergejewitsch Puschkin (1799–1837). Hierüber schrieb sie Bücher, ihre Gedichte schwieg man weiter tot.
Die schwerste Zeit ihres Lebens kam für Anna Achmatowa in den 1930-er Jahren, als man ihren Sohn verhaftete. In eisiger Kälte verharrte sie nach dessen Festnahme vor der Leningrader Gefäng-nisverwaltung, um Informationen zu erhalten. Ihr Sohn wurde zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. In ihrem Gedichtzyklus „Requiem“ schilderte sie den Schmerz russischer Mütter und Frauen, die wie sie auf Lebenszeichen ihrer dem Stalinterror zum Opfer gefallenen Söhne und Ehemänner warteten.
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebte Anna Achmatowa in Leningrad (Sankt Petersburg), dann evakuierte man sie nach Moskau und später Taschkent. Erst in den 1940-er Jahren sind auf persönlichen Befehl des kommunistischen Diktators Josef Stalin (1879–1953) – vermutlich nach Fürsprache bedeutender Künstler – wieder Werke von Anna Achmatowa gedruckt worden. Damals erschienen die Bände „Aus sechs Büchern“ (1940), „Die Weide“ (1940) und „Der Schwur“ (1941), die teilweise patriotische Gefühle ausdrückten.
Nach Kriegsende fiel Anna Achmatowa bei den Kommunisten erneut in Ungnade. Der Leiter der Propagandaabteilung des Zentralkomitees (ZK), Andrei Schdanow (1896–1948), beschimpfte sie unflätig: „Eine Hure und eine Nonne, bei der Pornographie mit Gebet verflochten ist.“ Die Lyrikerin erhielt von 1946 bis 1950 Schreibverbot. Fortan wanderten ihre Manuskripte auf Vorrat in die Schublade. 1953 starb ihr dritter Mann in einem Lager.
Während der Phase des politischen „Tauwetters“ in der Sowjetunion sah man immer öfter Verse von Anna Achmatowa in Zeitschriften.
Bald erschienen auch wieder Sammelbände wie „Ruhm dem Frieden“ (1950), „Gedichte“ (1958), „Requiem“ (1963), „Poem ohne Helden“ (1960) und „Das Echo tönt“ (deutsch 1964).
1965 verlieh die Universität Oxford (Großbritannien) Anna Ach-matowa die Ehrendoktorwürde. Auch in der UdSSR respektierte man in den letzten Lebensjahren ihre literarische Leistung. Nach langer Krankheit starb sie am 5. März 1966 im Alter von 76 Jahren in Moskau. Die Moskauer Zeitungen rühmten sie in Nachrufen als überragende Schriftstellerin.
1987 wurde Anna Achmatowas bereits erwähnter Gedichtzyklus „Requiem“, der schon 1937 entstanden war und in dem sie das Grauen des Stalinterrors beschrieb, in ihrer Heimat publiziert. Die Einleitung begann mit den Worten: „Es war die Zeit, da nur der Tote lächelte, froh über die Ruhe“. Der Literaturwissenschaftler Efim Etkind meinte, so lange habe noch kaum ein literarisches Werk auf seine Ver-öffentlichung warten müssen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Isabell Allende
Die Bestsellerautorin aus Chile
C
hiles bekannteste Autorin ist die Schriftstellerin Isabel Allende. Aus ihrer Feder stammen die Romane „Das Geisterhaus“ und „Eva Luna“, die Weltbestseller wurden. Ihr Buch „Paula“ über das Schicksal ihrer in tiefes Koma gefallenen Tochter, das in Tagen und Wochen größter Verzweiflung entstand, berührte Leserinnen und Leserinnen in aller Welt. Isabels Onkel war der chilenische Staatspräsident Salvador Allende (1908–1973), der im Spätsommer 1973 bei einem Militärputsch sein Leben verlor.
Isabel Allende kam am 8. August 1942 als Tochter des Diplomaten Tomás Allende und seiner Frau Francisca Llona, genannt „Doña Panchita“, in der peruanischen Hauptstadt Lima zur Welt. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie erst drei Jahre alt war. Die Mutter kehrte mit ihren drei kleinen Kindern in ihr Elternhaus in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile zurück.
1953 heiratete die Mutter den Diplomaten Ramón Huidobro, mit dem sie und ihre Kinder zunächst in Bolivien und später im Libanon lebten. In Bolivien besuchte Isabel eine nordamerikanische Privatschule, im Libanon eine englische Privatschule. Im Jahr der Suezkanal-Krise 1958 kehrte sie nach Chile zurück und beendete dort ihre Studien. Damals begegnete sie dem Maschinenbau-Studenten Miguel Frías.
Von 1959 bis 1965 arbeitete Isabel Allende als Sekretärin für die „Food and Agriculture Organization“ der „Vereinigten Nationen“ (UN) in Santiago de Chile. 1962 heirateten Isabel Allende und Miguel Friás. 1963 kam die Tochter Paula zur Welt. 1964 und 1965 hielt sich die Familie in Europa auf. Sie lebte in der belgischen Hauptstadt Brüssel und in der Schweiz. 1966 schenkte Isabel nach der Rückkehr aus Europa in Chile dem Sohn Nicolás das Leben.
1967 gründeten Isabel Allende und andere Frauen die Frauen-zeitschrift „Paula“. 1970 wurde ihr Onkel als erster sozialistischer Präsident von Chile gewählt. Von 1970 bis 1975 arbeitete Isabel für die Fernsehsender „channels 13“ und „channels 7“ in Santiago de Chile. 1973/1974 wirkte sie an dem Magazin „Mompato“ mit.
Am 11. September 1973 wurde Staatspräsident Salvador Allende bei einem Militärputsch unter General Augusto Pinochet gestürzt und kam dabei ums Leben. Sein Tod ist ungeklärt: Einerseits vermutet man, er sei heimtückisch ermordet worden. Andererseits heißt es, ihm sei ein Angebot für freies Geleit aus dem Land angeboten worden, er aber habe dies abgelehnt und sich erschossen.
1975 ging Isabel Allende mit ihrer Familie nach Caracas (Venezuela) ins Exil. Dort arbeitete sie von 1976 bis 1983 als freie Journalistin bei der Tageszeitung „El Nacional“ und leitete von 1979 bis 1982 das Marrocco College. 1978 trennte sie sich zeitweise von Miguel Frías und lebte zwei Monate lang in Spanien.
Als Isabel Allende 1981 vom Tod ihres 99 Jahre alten Großvaters erfuhr, begann sie, ihm einen Brief zu schreiben. Daraus entstand das Manuskript für das Buch „La casa de los esprítus“ (1982 deutsch: „Das Geisterhaus“, 1984). Dieses Familienepos zeichnet fünf Jahrzehnte aus dem Leben des Esteban Trueba nach und handelt von Liebe und Hass sowie Rache und Tod. 1985 erschien der Roman unter dem englischen Titel „The House of the Spirits“.
Mit dieser chilenisch-südamerikanischen Familiensaga, die Millio-nenauflagen erreichte, gelangte Isabel Allende zu Weltruhm. Es folgten die Kindergeschichte „La gorda de porcelana“ (1984) und
der Roman „Tiempo de amor y de sombra“ („Von Liebe und Schatten“, 1986). Die erste Ehe mit Miguel Frías wurde 1987 geschieden.
Mehrfach lehrte Isabel Allende als Gastprofessorin an amerikanischen Universitäten. Bei einer Vortragsreise durch die USA lernte sie den amerikanischen Rechtsanwalt Willie Gordon, kennen, den sie am 17. Juli 1988 in San Francisco heiratete. 1986 siedelte sie nach Kalifornien über, wo ihr Erfolgsroman „Eva Luna“ (1987) entstand. 1988 besuchte sie erstmals nach 13 Jahren wieder Chile. 1990 verlieh man ihr in Chile den „Gabriela Mistral Award“.
Während Isabel Allende im Dezember 1991 in Barcelona (Spanien) ihren neuen Roman vorstellte, lieferte man ihre Tochter Paula, die an einer seltenen Stoffwechselkrankheit litt, in ein Krankenhaus ein, wo sie in ein tiefes Koma fiel. Um am Krankenbett nicht völlig zu verzweifeln, begann Isabel, einen Brief an ihre Tochter zu schreiben, der sich allmählich zu einer großen Familiengeschichte entwickelte. In einem langen Prozess musste Isabel Allende schließlich das Unausweichliche akzeptieren: Paula starb im Alter von 28 Jahren am 6. Dezember 1992. Am 22. Oktober 1993 wurde der auf Isabel Allendes gleichnamigem Buch fußende und von Bernd Eichinger (1949–2011) produzierte Film „Das Geisterhaus“ in München ur-aufgeführt.
Isabel versuchte, den frühen Tod ihrer 28-jährigen Tochter in dem Buch „Paula“ (1994) literarisch zu bewältigen. Nach dem Tod ihrer Tochter brauchte sie drei Jahre, um wieder Lebensmut und die Kraft zu einem neuen Buch mit dem Titel „Aphrodite“ (1997) zu finden. Isabel Allende hält alljährlich am 8. Januar – dem Tag, an dem sie „Das Geisterhaus“ begann – ein magisches Ritual ab. Sie horcht in ihrem Inneren auf den ersten Satz, mit dem sie ihr nächstes Werk einleiten will. „Der Satz muss aus dem Bauch kommen, nicht aus dem Kopf“, sagt sie. „Wenn es klappt, öffnet der erste Satz eine Tür zu einem Raum, der dunkel ist. Die Geschichte ist da drin, aber ich kenne sie noch nicht. Ich trete mit einer Laterne ein und leuchte langsam alles aus. Ein Buch zu schreiben, ist wie eine neue Liebe“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bettina von Arnim
Die große Frau
der jüngeren Romantik
A
ls bedeutendste deutsche Frauengestalt der jüngeren Romantik gilt Bettina von Arnim (1785–1859), eigentlich Catarina Elisabeth Ludovica Magdalena von Arnim, geborene Brentano. Mit viel Phantasie dichtete sie Originalbriefe um und schrieb engagiert über soziale und frauenrechtliche Probleme ihrer Zeit. Der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), den sie anhimmelte, verschmähte ihre Liebe.
Bettina Brentano wurde am 4. April 1785 in Frankfurt am Main als Tochter des aus Italien stammenden Kaufmanns Peter Anton Brentano (1735–1797) und seiner Frau Maximiliane (1756–1793) geboren. Sie war das 13. Kind ihres Vaters und das siebte aus dessen zweiter Ehe mit Maximiliane. Früh verlor Bettina beide Elternteile: Sie war erst acht Jahre alt, als die Mutter starb und zwölf, als man auch den Vater begrub.
Nach dem Tod der Mutter wurde Bettina zusammen mit vier Schwestern ab 1794 im Pensionat des Ursulinenklosters in Fritzlar erzogen. Mit zwölf Jahren kam sie 1797 zu ihrer Großmutter, der Schriftstellerin Sophie von La Roche (1731–1807), nach Offenbach, wo sie fünf Jahre lang lebte. Erst damals lernte sie ihren sieben Jahre älteren Bruder Clemens (1778–1842) kennen.
Bei ihrem Schwager, dem Juristen Friedrich Karl von Savigny (1779–1861), begegnete die 14-jährige Bettina Brentano 1799 erstmals der 19-jährigen Dichterin Karoline von Günderode (1780– 1806). Zwischen beiden jungen Frauen entwickelte sich eine roman-tische Freundschaft, die wegen der Intensität der Gefühle und des geistigen Austausches in zahlreichen Briefen in die Literaturge-schichte einging.
Ab 1802 lebte Bettina Brentano überwiegend in Frankfurt am Main und erhielt dort unter anderem Privatunterricht in Kompositionslehre und im Zeichnen. In jenem Jahr sah Bettina erstmals dem Dichter Achim von Arnim (1781–1831), als dieser ihren Bruder, den Poeten Clemens Brentano, besuchte. 1806 lernte sie Katharina Elisabeth Goethe (1731–1808), genannt „Frau Aja“, die Mutter des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, kennen. Jene gestand ihr, sie habe sich als Mädchen in Kaiser Karl VII. (1697–1745) verliebt, der zu seiner Krönung nach Frankfurt am Main gekommen war.
1807 zerbrach die Freundschaft zwischen Bettina und Karoline von Günderode. Ursache dafür war, dass sich Bettina und der Geliebte von Karoline, der Heidelberger Philologe und Mythenforscher Georg Friedrich Creuzer (1771–1858), nicht ausstehen konnten. Später wurde Karoline durch ihre unglückliche Liebe zum Selbstmord getrieben: Sie stürzte sich in Winkel (Rheingau) in den Rhein.
Die 22-jährige Bettina traf 1807 in Weimar erstmals den 57 Jahre alten Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, mit dem sie bereits Briefe gewechselt hatte. Sie verliebte sich in ihn, obwohl der deutsche Dichterfürst gerade Christine Vulpius (1765–1816) geheiratet hatte. 1808 und 1809 lebte Bettina Brentano in München, wo man sie dem bayerischen Kronprinzen Ludwig I. (1786–1868) vorstellte, dessen Gedichte ihr „ungehobelt, aber voll Feuer“ erschienen. Ludwig I. war von 1825 bis 1848 König von Bayern. Nach ihrem Aufenthalt in München wohnte Bettina in Landshut, Wien und Berlin.
Bettina Brentano vergötterte weiterhin Johann Wolfgang von Goethe, besuchte ihn 1810 und 1811, doch dieser erwiderte ihre Gefühle nicht.
Bei einem Streit beschimpfte Bettina die Frau Goethes als „wahn-sinnige Blutwurst“ und erhielt daraufhin Hausverbot.
1811 heiratete Bettina Brentano den Dichter Achim von Arnim. dem sie im Laufe ihrer Ehe sieben Kinder gebar. Nach ihrer Heirat lebte sie mit ihrem Mann bis 1817 auf dessen märkischem Gut in Wiepersdorf bei Jüterbog (Brandenburg), später meistens getrennt von ihrem Gatten bis zu dessen Ableben 1831 in Berlin.
Zum Missfallen ihrer Frankfurter Verwandten wurde Bettina nach dem Tod ihres Ehegatten literarisch aktiv. Ihre Briefsammlungen, die sie mit eigenwilliger Phantasie umdichtete, spiegeln ihre ent-husiastische Liebe zu Goethe, der Schriftstellerin Karoline von Günderode und zu ihrem Bruder Clemens Brentano wider. Als eines ihrer bekanntesten Werke gilt „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“ (1835). Bei dessen Erscheinen war das „Kind“ Bettina bereits 50 Jahre alt.
Die durch das Goethe-Buch schnell berühmt gewordene Bettina von Arnim setzte sich für die Wiedereinstellung der 1837 in Göttingen entlassenen Brüder Jakob Grimm (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) ein. Die Brüder Grimm gehörten zu sieben Göttinger Professoren („Göttinger Sieben“), die gegen die Aufhebung des Staatsgrundgesetzes des Königsreichs Hannover von 1833 durch König Ernst August (1771–1851) protestierten und daraufhin des Amtes enthoben wurden. Bettina erreichte, dass der preußische König Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) die Brüder Grimm 1840 – unmittelbar nach seiner Inthronisation – nach Berlin rief. In jenem Jahr erschien auch Bettinas Werk „Die Günderode“ (1840).
1842 soll sich Bettina von Arnim mit dem deutschen Philosophen und Politiker Karl Marx (1818–1883) getroffen haben. Einerseits stand sie den Ideen der Frühsozialisten zwar nahe, andererseits aber hielt sie an der Idee eines „Volkskönigs“ fest.
Die fiktiven Gespräche zwischen der Mutter Goethes und der Mutter des Königs, die Bettina von Arnim in dem Buch „Dies Buch gehört dem König“ (1843) herausgab, enthalten viele sozialkritische Ansätze.
Darin geißelte sie die unmöglichen Sozial- und Wohnungsverhältnisse in der werdenden Fabrikstadt Berlin. Das Werk wurde in Bayern, eine verkürzte Fassung auch in Preußen, verboten.
1844 kündigte Bettina in Zeitungen die Veröffentlichung ihres Werkes über die Lage der Armen an. Doch dazu kam es nicht, als der Weberaufstand in Schlesien ausbrach. Sie ließ den Druck stoppen, weil sie befürchtete, als Verschwörerin verurteilt zu werden.
Bettina von Arnim kannte auch die Not der Weberinnen im Vogtland (Sachsen). Darüber schrieb sie im Juni 1844 dem Naturforscher und Geographen Alexander von Humboldt (1769–1859): „Die Frucht verkam vor Mangel an Nahrung im Mutterleib, die Kinder wurden als Skelette geboren!“. 1844 kam auch der Band „Clemens Brentanos Frühlingskranz auf Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte“ heraus.
Die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848 erlebte Bettina von Arnim in Berlin. Anonym veröffentlichte sie damals eine Polen-Denkschrift unter dem Titel „An die aufgelöste Preußische National-Ver-sammlung“. Vier Jahre später folgte ihr Märchenbuch „Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns“ (1852).
Am 20. Januar 1859 starb Bettina von Arnim im Alter von 73 Jahren in Berlin. Im Gegensatz zu ihr gilt Karoline Schlegel (1763–1809) als bedeutendste deutsche Frauengestalt der älteren Romantik. Ihr war Bettina an Genialität und Ursprünglichkeit verwandt, an Reichtum und Beweglichkeit der poetischen Phantasie jedoch überlegen.
sterreichs berühmteste Schriftstellerin war Ingeborg Bachmann (1926–1973). Ihre literarischen Werke sind mit hohen Aus-zeichnungen bedacht worden. Von ihr stammt der Ausspruch: „Ich glaube, dass bei keiner schriftstellerischen Hervorbringung soviel nachgedacht wird wie beim Gedichteschreiben“. Die renommierte Autorin galt als Grenzgängerin, die Grenzen überwinden wollte. Sie starb unter tragischen Umständen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Grenzgängerin aus Kärnten
OSIngeborg Bachmann kam am 25. Juni 1926 als ältestes von drei Kindern des Lehrers Mathias Bachmann und der Hausfrau Ingeborg Bachmann, geborene Haas, in Klagenfurt (Kärnten) zur Welt. Ihre Mutter hätte gerne studiert, doch dieser Wunsch blieb ihr versagt. Die Familie Bachmann zeigte sich anderen Kulturen gegenüber sehr aufgeschlossen und stand damit stark im Gegensatz zur Ras-senideologie der Nationalsozialisten, die 1938 Klagenfurt besetz-ten.
Bereits während ihrer Schulzeit verfasste Ingeborg Bachmann Gedichte und Prosastücke. Durch das Lesen und Schreiben verar-beitete sie den Schmerz, das Leid und die Trauer, die durch Ereignisse im Zweiten Weltkrieg entstanden. Nach dem Abitur wollte sie anfangs Musikerin werden und schuf verschiedene Kompositionen, studierte dann aber zunächst Philosophie in Innsbruck, dann Jura in Klagenfurt und schließlich Philosophie in Wien, wo sie Germanistik und Psychologie als Nebenfächer belegte.
In Wien begegnete Ingeborg Bachmann 1948 dem österreichischen Lyriker Paul Celan (1920–1970), mit dem sie ihr Leben lang befreundet blieb. 1950 beendete sie ihr Studium mit einer Dissertation über „Die kritische Aufnahme der Existentialphilosphie Martin Heideggers“. Damit promovierte sie zum „Doktor der Philosphie“. Nach der Auseinandersetzung mit den Werken des deutschen Philosophen Martin Heidegger (1889–1976) und des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889–1951) wandte sich Ingeborg Bachmann der Dichtung als ihrem eigentlichen Ausdrucksmittel zu. Ihre Hauptthemen waren die Klage über den Zustand des Menschen in einer gewalttätigen Umwelt und Visionen von einer besseren Gegenwelt.
Ab 1950 lebte Ingeborg Bachmann ein Jahr lang in Paris. Von 1951 bis 1953 arbeitete sie als Redakteurin und Lektorin am Wiener Rundfunksender „Rot-Weiß-Rot“. Damals traf sie die österreichische Schriftstellerin Ilse Aichinger und den deutschen Schriftsteller Hans Werner Richter (1908–1993), die bald ihre wichtigsten Förderer wurden.
Obwohl der stillen und scheuen Lyrikerin 1953 bei der Lesung der „Gruppe 47“ in Niendorf die Stimme versagte, schaffte Ingeborg Bachmann dort den literarischen Durchbruch. Danach gab sie ihren Beruf in Wien auf, zog auf Einladung des Komponisten Hans Werner Henze nach Ischia und Rom, lebte mit ihm drei Jahre wie Bruder und Schwester zusammen und wurde freie Schriftstellerin. Von Italien aus reiste sie in die USA, nach Afrika und Polen.
1953 erschien Ingeborg Bachmanns erster Gedichtband „Die gestundete Zeit“. In der Folgezeit produzierte sie für Rundfundsender Essays und Hörspiele, die oft mit Musik von Henze vertont wurden. Das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ bescheinigte ihr 1954 in einer Titelgeschichte, sie sei die erste deutschsprachige Lyrikerin der Nachkriegsgeneration, die an die große Tradition der literarischen Moderne anzuknüpfen vermochte. 1954/1955 schrieb sie unter dem Pseudonym „Ruth Keller“ „Römische Reportagen“ und telefonierte sie an „Radio Bremen“ durch.
1956 erschien Ingeborg Bachmanns Gedichtband „Anrufung des Großen Bären“. Ihre Gedichte mit meistens reimlosen Zeilen handelten von Hoffnung, Resignation und Trauer über die Sinnlosigkeit der Welt. 1957 wurde sie „Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung“ sowie Dramaturgin beim „Bayerischen Fernsehen“ und zog nach München.
Für ihr Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“, das 1958 in München seine Uraufführung erlebte, wurde Ingeborg Bachmann im selben Jahr mit dem „Hörspielpreis der Kriegsblinden“ ausgezeichnet. In diesem Hörspiel geht es um den zentralen Ort des Glücks: um die Liebe eines Paares, die durch ständige Intensivierung zur Gefahr für das Funktionieren der Gesellschaft und deswegen vom Guten Gott verfolgt wird.
Im Wintersemester 1959/1960 lehrte Ingeborg Bachmann als erste Gastdozentin über Poetik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Im Sommer 1961 erschien ihr erster Erzählband „Das dreißigste Jahr“, in dem das Gefangensein des Individuums in den verschiedenen Formen menschlicher Beziehungen dargestellt wird. Hierfür erhielt sie im November 1961 den „Preis des Verbandes der deutschen Kritiker“.
Von 1959 bis 1963 lebte Ingeborg Bachmann in Uetikon am See mit dem 15 Jahre älteren Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911–1991) zusammen. Beide galten als Traumpaar der deutschen Literatur: Sie verkörperte die Magische, er den Kritischen. Beide wollten heiraten, aber ihre Beziehung war chaotisch: Ingeborg reagierte neidisch auf seine literarische Produktivität, Max war eifersüchtig bis zur Hörigkeit, verließ sie schließlich aber wegen einer anderen Frau. Nach der Trennung wurde Ingeborg krank, hatte eine Schaffenskrise und lebte ein Jahr in Berlin.
1964 hatte die als scheu geltende 37 Jahre alte Ingeborg Bachmann eine Affäre mit dem 28-jährigen Wiener Publizisten und Filmautor Adolf von Opel, der bereits beim zweiten Besuch in Berlin über Nacht blieb. Der Liebhaber berichtete in seinem Buch „Ingeborg Bachmann in Ägypten“ (1996) über eine gemeinsame Ägyptenreise im Mai 1964. Dabei soll es im Hotel zu einer Liebesnacht von Ingeborg Bachmann mit Opel und zwei anderen Männern gekommen sein.
Im Herbst 1964 erhielt Ingeborg Bachmann den Georg-Büchner-Preis, der nach dem deutschen Dichter Georg Büchner (1813–1837) benannt ist. Aus Berlin zog sie 1965 nach Rom, wo sie zunehmend ein zurückgezogenes und einsames Leben führte. 1968 wurde sie mit dem „Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur“ ausge-zeichnet.
Im April 1971 kam Ingeborg Bachmanns erster Roman „Malina“ heraus, der als Ouvertüre zu ihrem Zyklus Todesarten angekündigt wurde. Dabei handelt es sich um die Geschichte einer Schriftstellerin zwischen zwei Männern und die unausweichlich zum Tod führende Verstrickung in der Liebe. 1972 folgte der Erzählband „Simultan“, in dem die Frauen eine Strategie entwickelt haben, mit der sie sich gegen die Schmerzen, die ihnen das Zusammenleben mit den Männern zufügt, unempfindlich machen.
Anfang Oktober 1973 wurde Ingeborg Bachmann mit folgenschweren Brandverletzungen in eine römische Klinik eingeliefert. Sie war beim Rauchen im Bett eingeschlafen, was ein Feuer verursacht hatte. Am 17. Oktober 1973 erlag sie im Alter von 47 Jahren ihren Verletzungen. Sie wurde in ihrem Geburtsort Klagenfurt begraben.
Freunde der Verstorbenen vertraten in einem Fernsehfilm des Südwestfunks die These, Inge Bachmann sei ermordet worden. Doch die Autorinnen Christine Koschel und Inge von Weidenbaum deckten in der „Süddeutschen Zeitung“ auf, die Ärzte hätten erst während der Behandlung der Dichterin im Krankenhaus nach „Konvulsionen, die epileptischen Anfällen glichen“, von der Drogenabhängigkeit der Lyrikerin erfahren: Die Bachmann nahm – meistens zusammen mit Alkohol – ein Schlafmittel. Die Krämpfe waren – letztendlich tödliche – Entzugserscheinungen. Zu spät erfuhren die behandelnden Ärzte auch, dass Ingeborg Bachmann ein Medikament eingenommen habe, das bei Missbrauch zum Verlust der Tast-, Temperatur- und Schmerzempfindungen sowie zu zerebralen Krämpfen führt.
1976 stifteten die Stadt Klagenfurt und der „Österreichische Rundfunk“ (ORF) den „Ingeborg-Bachmann-Preis“ für deutsch-sprachige erzählende Prosa. Bei diesem alljährlich im Juni statt-findenden Literaturwettbewerb werden unveröffentlichte Texte live vor Publikum und laufender Kamera von den Autorinnen und Autoren gelesen, von einer fachkundigen Jury analysiert und bewertet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vicki Baum
Die vielgelesene Autorin
E
ine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der 1940-er und 1950-er Jahre war die aus Österreich stammende Autorin Vicki Baum (1888–1960). Ihre Bücher gehörten zu den am meisten gelesenen und übersetzten in ihrer Zeit. Das Geheimnis ihres Erfolges beschrieb sie so: „Mein Ausgangspunkt ist eine Frage. Die gleiche Frage, die ich mir seit meinem zwölften Lebensjahr immer wieder stelle: Ich betrachte eine Person, und ich frage mich, was der Kern ihres Lebens ist.“
Vicki Baum kam am 24. Januar 1888 als Tochter eines jüdischen Beamten in der österreichischen Hauptstadt Wien zur Welt. Dort besuchte sie das Pädagogium und die Hochschule für Musik und begann eine musikalische Laufbahn als Harfenistin. Bereits als Achtjährige fragte sie alle möglichen Leute, ob sie gerne Briefe bekämen. Wenn sie bejahten, erhielten sie am nächsten Tag von ihr ein Schreiben.
Als Zwölfjährige trat Vicki Baum erstmals in einem Konzert als Harfenistin auf. Mit 14 Jahren erlebte sie den ersten Abdruck einer Geschichte in der satirischen Zeitschrift „Die Muskete“, wofür sie 50 Kronen erhielt, die sie vor ihren Eltern verheimlichte. Außerdem gewann sie eine Tafel Schokolade, weil sie mit dem 17-jährigen Sohn eines Redakteurs gewettet hatte, sie könne etwas schreiben, das gedruckt werde.
In ihren Erinnerungen „Es war alles ganz anders“ (1962), die erst nach ihrem Tod erschienen, schilderte Vicki Baum ungeschminkt ihre schwierige Kindheit. Ihr Vater erschien ihr als der einzige Feind, den sie je hatte, und als die unbeholfenste Person, die sie kannte. Ihre Mutter litt ab 1902 an einer Geisteskrankheit und später an einer unheilbaren Krebsgeschwulst.
Vickis Vater war ein Hypochonder, er verabscheute Blumen als Kuhfutter, betrachtete Bücher als Schund und Schmutz, wertete Musik als unangenehmen Lärm und verbot seiner Tochter jegliche Freundschaften. Außerdem ließ er sich die Socken anziehen, sein Hemd zuknöpfen und die Schnürsenkel binden. An seinem Platz am Esstisch trug das weiße Tischtuch zahlreiche Flecken von Suppen, Soßen und Gemüsen.
Einmal erfuhr Vickis Vater, dass seine Tochter für eine kleine Geschichte in einer Münchener Zeitschrift den ersten Preis erhalten hatte. Nach einer erregten Auseinandersetzung forderte er ihr heiliges Ehrenwort, niemals mehr in ihrem Leben auch nur eine Zeile zu schreiben. Nach dieser Auseinandersetzung verließ sie die väterliche Wohnung.
1908 schloss Vicki Baum ihre erste Ehe mit dem Wiener Journalisten Max Prels (1878–1926). Er hatte sich ihrem Vater und ihren Verwandten als gutbezahlter Herausgeber einer Abendzeitung vorgestellt, war jedoch in Wirklichkeit nur freier Mitarbeiter ohne festes Gehalt mit bescheidenen Einkünften. Als ihr Gatte von einer deutschen Monatszeitschrift den Auftrag für sechs Kurzgeschichten erhielt und ihm partout nichts einfiel, schrieb Vicki die Texte, die unter dem Namen ihres Mannes erschienen.
Bald darauf gab Vickis Mann eine Zeitschrift heraus, die sein Freund Gotfried finanzierte. Als das Geld hierfür fast aufgebraucht war, schrieb Vicki Baum unter zahlreichen Pseudonymen fast alle Beiträge allein. Bei der Zusammenarbeit des Trios entwickelte sich eine Affäre zwischen Vicki und Gotfried. 1910 willigte Vickis Gatte in die Scheidung ein. Weniger als ein Jahr danach kühlten jedoch Vickis Gefühle für Gotfried ab.
Im August 1912 siedelte Vicki Baum nach Darmstadt (Hessen) über, wo sie einen Vertrag als Großherzogliche Hof- und Kammermusikerin unterschrieben hatte. Dort ermunterte sie ein Schauspieler, sie solle die Geschichten, die sie ihm erzähle, aufschreiben. Daraufhin gab sie ihm das bereits fertige Manuskript über ihre frühe Kindheit, das sie nach einer Krankheit zu Papier gebracht hatte, zum Lesen.
Der Schauspielerkollege schickte das Manuskript ohne Wissen Vicki Baums an den Verleger Erich Reiß, der sich bereit erklärte, den Text zu drucken, wenn die österreichische Mundart darin ausgemerzt würde. Daraus entstand Vickis erstes Buch „Frühe Schatten. Die Geschichte einer Kindheit“ (1914). Der Verleger sandte ihr nach dem Erscheinen ein Exemplar und schrieb, im Krieg ließe sich ein solches Buch kaum verkaufen, sie solle sich mit dem Honorar bis zu Friedenszeiten gedulden.
1916 heiratete Vicki Baum in zweiter Ehe den österreichischen Dirigenten Richard Lert (1885–1980), den sie in Darmstadt kennen gelernt hatte und mit dem sie damals nach Kiel ging. Fortan verzichtete sie auf öffentliche Auftritte als Musikerin. Aus der Ehe gingen die zwei Söhne Wolfgang und Peter hervor. Vicky begleitete ihren Mann auf beruflichen Reisen durch Deutschland, bis sie 1926 nach Berlin zog, wo sie Redakteurin im Ullstein-Verlag wurde und dies bis 1931 blieb.
Vicki Baum fesselte in ihren Werken durch eine packende Handlung, eine lebhafte Erzählweise und einen flüssigen Stil ihre Leser. Ihre Romane und Novellen sind häufig vor der Buchveröffentlichung in Ullstein-Blättern abgedruckt worden.
Besonders erfolgreich waren unter anderem die Romane „Frühe Schatten“ (1919), „Der Eingang zur Bühne“ (1920), „Die Tänze der Ina Raffay“ (1921), „Welt ohne Sünde“ (1922), „Ulle, der Zwerg“ (1924), „Ferne“ (1926), „Hell in Frauensee“ (1927), „Zwischenfall in Lohwinkel“ (1930), „Leben ohne Geheimnis“ (1932) sowie die Novellen „Schlosstheater“ (1920), „Die andern Tage“ (1922), „Bubenreise“ (1923), „Der Weg“ (1925), „Tanzpause“ (1926) und „Miniaturen“ (1926).
Über Nacht berühmt wurde sie mit dem Roman „stud. chem. Helene Willführ“ (1929), den sie danach für einen Film umschrieb. Bevor sie ihren Roman „Menschen im Hotel“ (1929) zu Papier brachte, arbeitete sie vier Wochen lang als Stubenmädchen und betrieb Milieustudien über die Gäste, das Personal und die Atmosphäre eines internationalen Hotels. Letzterer Stoff diente später als Handlung für ein Theaterstück, einen Film mit Greta Garbo (1905–1990) und ein Musical.
1931 wanderte Vicki Baum in die USA aus, wo sie 1938 eingebürgert wurde. Von dort aus unternahm sie Reisen nach Japan, China, Indochina und auf die Inseln im Stillen Ozean. In den Vereinigten Staaten entwickelte sie sich zu einer der führenden Dreh-buchautorinnen und feierte weiterhin Erfolge als Romanautorin.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen weitere Romane wie „Schicksalsflug“ (1947), „Clarinda“ (1949), „Grand Opéra“ (1950), „Cahuchu“ (1952), „Vor Rehen wird gewarnt“ (1952), „Kristall im Lehm, „Flut und Flamme“ (1956), „Einsamer Weg“ 1958), „Die goldenen Schuhe“ (1958) und die Novelle „Die Strandwache“ (1953). Vicki Baum starb am 29. August 1960 im Alter von 72 Jahren in Hollywood (Kalifornien). Kurz vor ihrem Tod verbrannte sie sich in der Küche am Arm, wodurch ihre schleichende Leukämie in ein akutes Stadium überging. Wegen dieser Krankheit hatte sie schon 1945 einen Brief an ihre Kinder mit ihren „Letzten Wünschen“ geschrieben. Sie wollte kein Begräbnis, keine Blumen, keine Gedächtnisreden und keine öffentlichen Tränen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Harriet
Beecher-Stowe
Die Frau, von der „Onkel Toms Hütte“ stammt
A
ls Autorin des Bestsellers „Onkel Toms Hütte“ gelangte die amerikanische Schriftstellerin Harriet Beecher-Stowe (1811– 1896), geborene Beecher, zu Weltruhm. Das Buch war ein couragierter Angriff gegen die Sklaverei, erregte weltweit Aufsehen und wurde bis heute in 65 Sprachen übersetzt. Das Motto der Autorin lautete: „Ich werde schreiben, wie ein Maler malt, denn gegen Bilder kann man nicht argumentieren“.
Harriet Beecher wurde am 14. Juni 1811 als Tochter einer kal-vinistischen Predigerfamilie in Litchfield (Connecticut) geboren. Die Eltern haben sie streng puritanisch erzogen. Ungeachtet dessen war Harriet nach Aussagen von Zeitgenossen nicht nur fromm, sondern auch fröhlich und spontan.
Ab 1824 besuchte Harriet Beecher die von ihrer Schwester mitbe-gründete Mädchenschule in Hartford (Connecticut). Es handelte es sich um ein Mehrzweckgebäude, in dessen Erdgeschoss eine Satt-lerwerkstatt und ein Laden für Kutschengeschirr lagen, im Ober-geschoss befand sich die Schule. Während der Schulstunden entzückte sie oft ein Geselle, wenn er mit seiner schönen Tenorstimme sang. Harriets Briefe aus jener Zeit sind von religiösen Schwärmereien geprägt. Ihrem Vater erklärte sie einmal, sie habe sich Jesus hingegeben, und er habe sie angenommen. An der Schule, in der sie einst selbst die Bank gedrückte hatte, unterrichtete sie später zeitweise. Seit 1832 arbeitete Harriet Beecher als Lehrerin in Cincinnati (Ohio). Bei einem Ausflug auf die andere Seite des Ohio-Flusses, der von Connecticut nach Kentucky führte, wurde sie 1833 erstmals mit der Sklaverei konfrontiert. Im Alter von 23 Jahren gab sie ein neues Erdkundebuch für Schulen heraus.
Nachdem Harriet Beechers Schule 1836 geschlossen wurde, heiratete sie noch im selben Jahr den Professor für Bibelkunde, Calvin Ellis Stowe (1802–1886). Ihr Gatte ermunterte sie, die Schriftstellerei fortzusetzen und lobte ihre Bescheidenheit. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor, darunter ein Zwillingspaar. 1843 gewann Harriet bei einem Erzählwettbewerb mit ihrer Geschichte „Onkel Lot“ den ersten Preis.
Mitunter erlebte Harriet Beecher-Stowe die unmenschlichen Folgen der Sklaverei aus unmittelbarer Nähe. Sie bekam mit, wie sich bei ihrem Bruder in Boston (Massachusetts) freigelassene Sklaven versteckten und sich nun nirgends mehr sicher fühlten. Sogar ihre eigene Köchin Eliza musste wegen der Rückforderung ihres früheren Herrn auf einem entlegenen Gut versteckt werden. Denn das 1850 erlassene „Fugitive Slave Law“ bestimmte, alle entlaufenen Sklaven seien an ihre Herren zurückzugeben.
Als Harriets Mann einen Ruf als Professor an das Bowdoin College erhielt, zog die Familie Stowe nach Brunswick in Maine. Während des Abendmahls in der Kirche hatte Harriet – eigenen Angaben zufolge – angeblich die Vision, sie solle das Manuskript „Uncle Tom’s cabin or Life among the lowly“ („Onkel Toms Hütte oder Negerleben in den Sklavenstaaten Amerikas“) zu Papier bringen. Anfang April 1851 erschien das erste Kapitel in der Washingtoner Zeitung „National Era“, im Frühjahr 1852 folgte das Buch.
Von „Onkel Toms Hütte“ wurden bereits in den ersten acht Wochen nach dem Erscheinen etwa 50.000 Exemplare verkauft. Nach kaum einem Jahr waren schon mehr als 300.000 Stück abgesetzt. Zu den Rezensenten gehörte die französische Schriftstellerin George Sand (1804–1876), welche die Autorin als „Genie der Herzensgüte“ lobte. Im Süden der USA dagegen schmähte man dasselbe Werk als unsittlich und unevangelisch. Im August 1852 wurde der Roman in den Vereinigten Staaten für die Bühne dramatisiert, im September in London.
Die Aussagen ihres Werkes von 1852 untermauerte Harriet Beecher-Stowe durch die Veröffentlichung der umfangreichen Quellen-sammlung „A key to uncle Tom’s cabin“ („Schlüssel zu Onkel Tom’s Hütte“, 1853). 1853 unternahm sie eine Europareise, bei der sie in London als Heldin gefeiert wurde. Zu jener Zeit beschrieb sie sich selbst mit den Worten: „Ich bin von winziger Statur, etwas über 40, dürr und mager wie ein Stecken; selbst in meinen besten Tagen ohne äußeren Reiz“.
In einem weiteren Roman mit dem Titel „A tale of the great dismal swamp“ („Dred. Eine Erzählung aus den amerikanischen Sümpfen“, 1856) schilderte Harriet Beecher-Stowe den moralisch korrum-pierenden Einfluss der Sklaverei auf die Sklavenhalter. Damit zog sie sich noch mehr den Hass der Sklavenhalter in Virginia, Carolina und Mississippi zu.
Mitunter hat man später behauptet, Harriet Beecher-Stowe habe mit dem Buch „Onkel Toms Hütte“ entscheidend zum Ausbruch des „Amerikanischen Bürgerkrieges“ (1861–1865) beigetragen. Doch damit wurde der gesellschaftspolitische Einfluss ihres Werkes stark überschätzt. Unzutreffend ist auch, der amerikanische Präsident Abraham Lincoln (1809–1865) habe über die Schriftstellerin gesagt: „Dies ist also die kleine Dame, die diesen großen Krieg geführt hat.“
Harriet Beecher-Stowe schrieb auch religiös engagierte Romane hauptsächlich über das puritanische Neuengland – wie „The ministers wooing“ („Des Predigers Brautwerbung“, vier Teile, 1859) und „Oldtown folks“ (1869), Kinderbücher, Gedichte, theologische Schriften („Woman in cacred history“, 1873), Abhandlungen überdie Stellung der Frau und den autobiographischen Roman „Palmettoleaves“ (1873).
[...]
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2001, Superfrauen 8 - Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133505