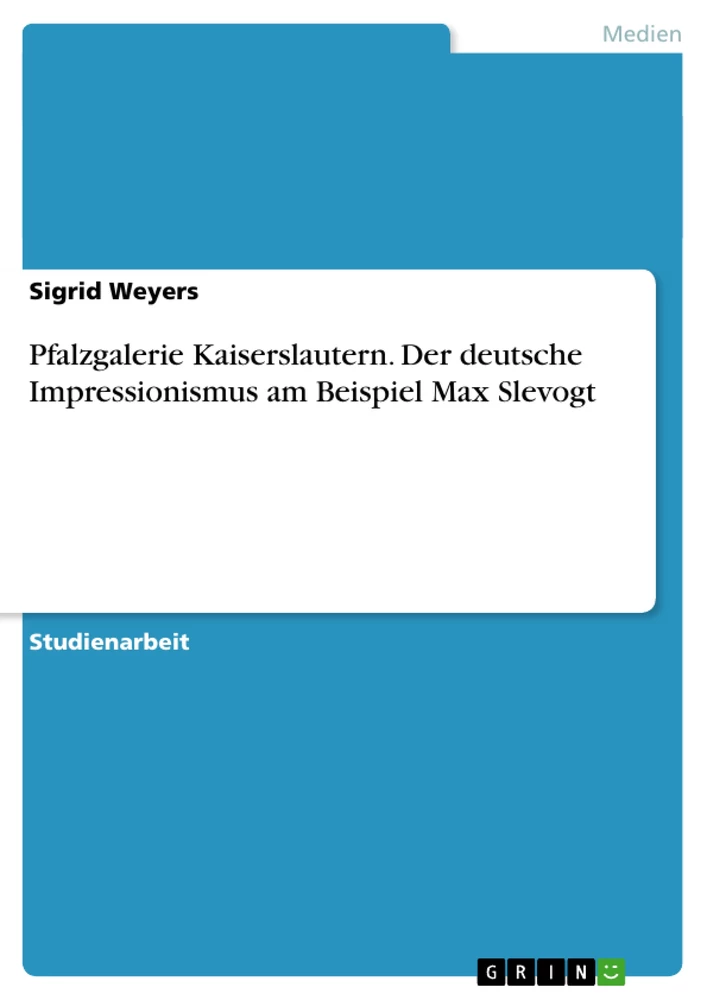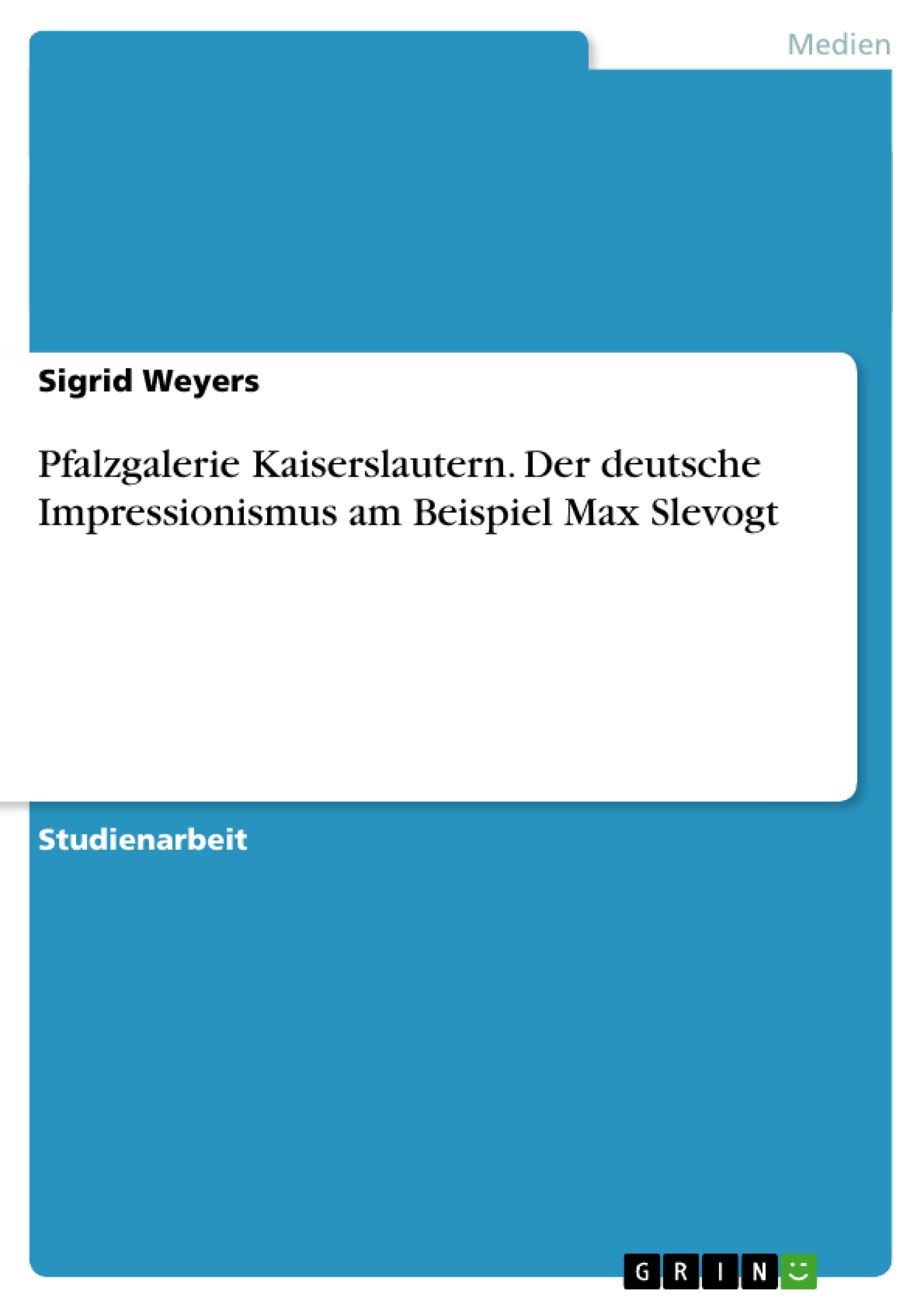Max Slevogt hat für die Pfalz eine besondere Bedeutung, deren Ursprung in seiner familiären Verbindung zur Region liegt: Als Kind und junger Mann verbringt er die Ferien häufig bei Verwandten in der Pfalz, später richtet er sich einen Sommersitz auf dem Gutshof Neukastel bei Leinsweiler ein.
Jenseits der räumlichen Bezüge hat die Südpfalz das künstlerische Schaffen Slevogts sowohl in der Wahl der Sujets beeinflusst als auch in deren gestalterischer Umsetzung.
Nicht zuletzt aus diesem biografischen Kontext heraus findet sich in der Pfalz ein reicher Bestand aus dem Werk des Malers. Dieser ist in Rheinland-Pfalz schwerpunktmäßig auf Neukastel, auf Schloss „Villa Ludwigshöhe“ und in der Pfalzgalerie Kaiserslautern zu finden. Damit bieten sich ideale Möglichkeiten, den deutschen Impressionismus in der Pfalz an zahlreichen Originalen seines exponierten Vertreters zu studieren.
Die vorliegende Arbeit umreißt die Charakteristika des deutschen Impressionismus beispielhaft am Werk von Max Slevogt. Die Autorin berücksichtigt dabei speziell Exponate aus der Pfalzgalerie Kaiserslautern und zeigt darüber hinaus Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum französischen Impressionismus auf.
Inhaltsverzeichnis
1 Max Slevogt und die Pfalz
2 Max Slevogt: Leben und Werk
2.1 Zur Biografie des Künstlers
2.2 Studium und künstlerischer Werdegang
2.3 Künstlerische Gestaltungsprinzipien
2.4 Max Slevogt in Bildbeispielen aus der Pfalzgalerie Kaiserslautern
2.4.1 Max Liebermann, 1901
2.4.2 Familienbild Slevogt im Garten von Godramstein, 1911/1912
2.4.3 Blühende Kakteen mit Katze, 1928
3 Impressionismus
3.1 Entwicklung in Frankreich
3.2 Die Entwicklung in Deutschland
3.3 Impressionismus: Deutschland, Frankreich –Unterschiede und Gemeinsamkeiten
4 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde darauf verzichtet, die zu Grunde gelegten Werke Slevogts dem Text als Abbildungen beizufügen. Die Autorin verweist an gegebener Stelle jeweils auf eine Quelle in der Literatur bzw. im Internet, wo das betreffende Werk eingesehen werden kann.
1 Max Slevogt und die Pfalz
Max Slevogt hat für die Pfalz eine besondere Bedeutung, deren Ursprung in seiner familiären Verbindung zur Region liegt: Als Kind und junger Mann verbringt er die Ferien häufig bei Verwandten in der Pfalz, später richtet er sich einen Sommersitz auf dem Gutshof Neukastel bei Leinsweiler ein. Das schlossähnliche Gebäude-ensemble an exponierter Hanglage oberhalb des Ortes trägt heute im Volksmund den Namen Slevogthof – Reminiszenz an seinen prominenten Bewohner.
Jenseits der räumlichen Bezüge hat die Südpfalz das künstlerische Schaffen Slevogts sowohl in der Wahl der Sujets beeinflusst als auch in deren gestalte-rischer Umsetzung. Die Landschaft bietet mit ihren vielfältigen Formen und dem sonnenreichen Klima ideale Möglichkeiten, den Einfall des Lichts und seine Wirkung auf die Wahrnehmung zu studieren.
Nicht zuletzt aus diesem biografischen Kontext heraus findet sich in der Pfalz ein reicher Bestand aus dem Werk des Malers. Dieser verteilt sich in Rheinland-Pfalz neben Privatsammlungen und den Beständen des Landesmuseums Mainz sowie des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen schwerpunktmäßig auf Neukastel[1], Schloss „Villa Ludwigshöhe“[2] und die Pfalzgalerie Kaiserslautern[3]. Damit bieten sich ideale Möglichkeiten, den deutschen Impressionismus in der Pfalz an zahl-reichen Originalen seines exponierten Vertreters zu studieren.
2 Max Slevogt: Leben und Werk
2.1 Zur Biografie des Künstlers
Max Slevogt wird am 8. Oktober 1868 als Sohn des bayrischen Hauptmanns Friedrich Ritter von Slevogt in Landshut geboren. Sein Vater stirbt bereits 1870, und die Mutter zieht mit ihm und seinem Bruder[4] nach Würzburg, wo er seine Schulzeit verbringt. Als Kind und später als Student hält er sich in den Ferien häufig bei Verwandten in Godramstein bei Landau auf. Dort lernt er auch Dr. Peter Finkler und dessen Familie kennen, deren Tochter Antonie[5], genannt Nini, er 1898 heiratet. 1914 erwirbt er bei einer Versteigerung das ehemalige Landgut seines Schwiegervaters, Neukastel bei Leinsweiler, um es für sich, seine Frau und die beiden Kinder Nina[6] und Wolfgang[7] als Sommersitz zu nutzen. Als die Pfalz 1918 nach Beendigung des 1. Weltkrieges von den französischen Truppen besetzt wird und Slevogt vorerst die Rückkehr nach Berlin verwehrt wird[8], richtet sich die Familie hier dauerhaft ein. Max Slevogt stirbt am 20. September 1932 auf Neu-kastel und wird wenige Tage später auf dem Familienfriedhof[9] umweit des Hauses in Leinsweiler beigesetzt.
Von 1885 bis 1890 studiert Slevogt an der Kunstakademie in München[10], zu seinen Lehrern zählen Wilhelm von Diez[11] und Gabriel von Hackl[12]. Während seines Studiums reist er nach Italien und nach Paris, wo er im Louvre die alten Meister studiert und am Unterricht der Académie Julian[13] teilnimmt. Nach Ab-schluss seiner künstlerischen Ausbildung lässt er sich als freier Maler in München nieder und wird Mitglied der Münchner Secession[14]. 1893 beteiligt er sich an ihrer ersten Ausstellung mit der „Ringerschule“, einer Arbeit, die zuerst von der Jury als unsittlich abgelehnt wird.
Bildbeispiel 1
Max Slevogt: Ringerschule (1893)[15]
137 x 140 cm, Öl auf Leinwand, Slevogt Galerie Schloss „Villa Ludwigshöhe“, Edenkoben
In den 1890er Jahren beschäftigt sich Slevogt intensiv mit grafischen Techniken und mit der Gattung der Illustration, fertigt Lithografien, später Radierungen an. Zeitweilig arbeitet er als Illustrator für die Zeitschriften „Jugend“ und „Simplicissi-mus“. Der befreundete Kunsthistoriker Karl Voll[16] bestärkt ihn in seinem Interesse an der niederländischen Malerei, studiert Rembrandt und dessen Werk, reist 1898 sogar zum Besuch der großen Rembrandt-Ausstellung nach Amsterdam.[17]
Bildbeispiel 2
Max Slevogt: Danaë (1895)[18]
92,5 x 81,5 cm, Öl auf Leinwand, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München
1897 präsentiert Max Slevogt seine Arbeiten in Wien zum ersten Mal in einer Einzelausstellung. Seine Teilnahme an der Schau der Münchner Secession 1899 mit dem Gemälde „Danaë“ gerät zum Skandal; das Bild wird als obszön aus der Schau entfernt. Dagegen feiert er mit dem Triptychon „Der verlorene Sohn“ auf der ersten Ausstellung der Berliner Sezession einen überragenden Erfolg, in dessen Folge er als einer der offiziellen Vertreter der Kunst des Deutschen Reiches auf der Weltausstellung von 1900 in Paris vertreten ist.[19]
Bildbeispiel 3
Max Slevogt: Der verlorene Sohn, 1898/1899[20]
110,5 x 98 cm (Mittelteil), 110,5 x 50 cm (je Seitenflügel), Staatsgalerie Stuttgart Aus diesem Anlass reist er zum zweiten Mal nach Paris, wo er sich nun verstärkt mit der Malerei des französischen Impressionismus auseinandersetzt. Im Zentrum seines Interesses steht das Werk von Edouard Manet[21] ; ausgestattet mit einer Empfehlung seines Freundes Paul Cassirer[22] hat er Zugang zu privaten Samm-lungen und kann so auch Werke des französischen Künstlers studieren, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
1901 wird Slevogt auf Veranlassung des bayrischen Prinzregenten Luitpold[23] als Professor an die Münchner Akademie berufen. Ermutigt von seinen Erfolgen an-lässlich der Berliner Ausstellung übersiedelt er, nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt, wie Lovis Corinth[24] nach Berlin, wo er Mitglied der dortigen Sezession wird.[25] 1914 wird er an die königliche Akademie der Künste berufen, wo er ab 1917 ein Meisteratelier für Malerei leitet. Bei seinem Tod 1932 hinterlässt er ein umfang-reiches und vielfältiges Oeuvre. Es umfasst neben zahlreichen Gemälden, darunter viele Porträts und Auftragsarbeiten wie z. B. für Prinzregent Luitpold, mehrere grafische Zyklen, so zu Mozarts Oper „Die Zauberflöte“, Illustrationen zu Märchenstoffen wie „Ali Baba und die vierzig Räuber“ und Romanen wie James Fenimore Coopers „Lederstrumpf“, Bühnenbilder für Max Reinhardt am Deutschen Theater Berlin und für die Dresdner Oper, Wandbilder in seinen Arbeitsräumen auf Neukastel und für die Friedenskirche in Ludwigshafen.[26]
Bildbeispiel 4
Max Slevogt: Randzeichnung zu Mozarts Handschrift der „Zauberflöte“[27]
Aus dem Bestand der Slevogt-Galerie Schloss „Villa Ludwigshöhe“, Edenkoben
2.2 Studium und künstlerischer Werdegang
Max Slevogt studiert an der Akademie der Künste in München; dort wird die Tradition des Historienbildes gepflegt, geprägt von Künstlern wie Moritz von Schwind[28], Wilhelm von Kaulbach[29], Franz von Lenbach[30] und Karl von Piloty[31]. Mit der Romantik gewinnt die Landschaftsmalerei[32] an Bedeutung, angeregt durch die Schule von Barbizon[33] orientiert sie sich vor allem an der Pleinairmalerei.
Unter den impressionistischen Malern Deutschlands ist Max Slevogt der große Erzähler, geprägt von der Tradition der Historienmalerei. Mythen und Legenden, biblische Stoffe und Märchen regen ihn auch nach seiner akademischen Aus-bildung zu vielfältigen bildnerischen Arbeiten an. Sein Interesse gilt dem Menschen, dessen Ausdrucksmöglichkeiten er in zahlreichen Werken auslotet, vom klassischen Porträt über Künstler- und Bühnenstudien am Beispiel des Sängers Francisco d´Andrade[34] und Familienbildnisse bis hin zu einer großen Zahl von Selbstdarstellungen aus allen Schaffensperioden. Leitbilder sind für ihn Edouard Manet und Rembrandt, mit deren Schaffen er sich intensiv auseinander setzt. So nutzt er Reise]n, um Werke der Künstler vor Ort, in Paris und Amsterdam, zu studieren, nicht zuletzt angeregt durch seinen Freundeskreis, zu dem der Kunsthistoriker Karl Voll und Sammler und Galeristen wie die beiden Cousins Cassirer gehören. Die Landschaftsdarstellung gewinnt in seinem Werk mit den Aufenthalten in der Pfalz und letztlich mit dem Erwerb des Sommersitzes Neukastel[35] an Bedeutung. Hier entstehen viele Landschaftsbilder, die den Wechsel der Tages- und Jahreszeiten und die mit ihnen einhergehende Wahrnehmung der Natur reflektieren.
Ausgangspunkt für Max Slevogts Arbeiten sind in vielen Fällen umfangreiche Skizzen und Vorstudien in Aquarell, Kohl, Kreide und Tusche, aber auch Fotos. Er ist unter den impressionistischen Künstlern der Grafiker. Die Faszination der Farbe und des Lichts steht bei ihm gleichberechtigt neben der Begeisterung für die Dynamik der Linie und die Klarheit grafischer Gestaltung. So finden sich in seinem Oeuvre neben vielen Einzelarbeiten mehrere bedeutende grafische Zyklen, mit denen Slevogt zumeist als Illustrator literarischer Vorlagen in Erscheinung tritt. In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts arbeitet er für die Zeitschriften „Jugend“ und „Simplicissimus“, später gestaltet er grafische Folgen, die ihre Motive aus Märchen wie denen der Gebrüder Grimm oder den Erzählungen aus tausendundeiner Nacht, aus Coopers „Lederstrumpf“ oder Goethes „Faust“ schöpfen.
Neben seinem Engagement als Maler und Grafiker ist Max Slevogt nicht nur ein profunder Kenner, sondern auch ein großer Liebhaber der klassischen Literatur und Musik, er verehrt Wolfgang Amadeus Mozart ebenso wie Richard Wagner.
[...]
[1] Hier befindet sich ein Archiv, das allerdings der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die ehemaligen Privaträume des Malers können jedoch im Rahmen einer Führung besichtigt werden, dazu ge-hören das ehemalige Atelier und das Musikzimmer des Künstlers mit Wandmalereien von seiner Hand.
[2] Das Schloss beherbergt in der Slevogtgalerie eine große Auswahl an Werken Slevogts, darunter viele Arbeiten aus der Frühphase seines Schaffens.
[3] Die Pfalzgalerie würdigt die Bedeutung des Malers innerhalb der Kunstgeschichte und für die Region mit einem eigenen Slevogtsaal.
[4] Hugo Slevogt, der später zu einem bedeutenden Karlsruher Architekten der Gründerzeit wird. (u. a. Rathaus Bulach)
[5] Für die künstlerische Aufgeschlossenheit der Familie spricht die Tatsache, dass eine weitere Tochter, Johanna, als Malerin in Erscheinung tritt, auch wenn ihre Bekanntschaft die Grenzen der Region kaum überschreitet. Arbeiten von ihr sind z. B. im Städtischen Museum Strieffler-Haus in Landau zu sehen.
[6] Nina Slevogt, später Lehmann-Slevogt, geboren 1907
[7] Wolfgang Slevogt, geboren 1908
[8] Nach dem Waffenstillstandsabkommen von Compiègne (1917) wurden die linksrheinischen Ge-biete des Deutschen Reiches unter die Verwaltung der Alliierten gestellt. Die Pfalz, seit 1816 Teil des Königreichs Bayern, wurde von französischen Truppen besetzt und blieb bis 1930 unter fran-zösischer Verwaltung. Die Rückkehr nach Berlin, in sein dortiges Atelier und an die Akademie wird ihm erst 1920 genehmigt.
[9] Hier liegen neben Max Slevogt auch seine im November 1932 verstorbene Ehefrau Antonie, seine Mutter Caroline von Slevogt und seine Schwiegereltern begraben.
[10] Die Residenzstadt München verfügt mit der Königlichen Kunstakademie, einer Neugründung unter König Maximilian I. (von Pfalz-Zweibrücken), über eine Akademie von Weltruf. Dieser be-gründet sich vor allem auf dem Ansehen ihrer Lehrer und der in ihrem Umkreis entstandenen Münchner Schule.
[11] Albrecht Christoph Wilhelm von Diez (17. Januar 1839, Bayreuth – 25. Februar 1907, München), 1872 – 1907 Professor für Historienmalerei an der Münchner Kunstakademie
[12] Gabriel von Hackl (1843, Marburg an der Drau – 1926, München), seit 1878 Hilfslehrer, 1880 – 1919 Professor in der Antikenklasse der Münchner Akademie
[13] Die Académie Julian wird 1868 von Rodolphe Julian als freie Kunstschule gegründet. Im Gegen-satz zur offiziellen Ècole des Beaux Arts sind hier Frauen zugelassen und können an allen Kur-sen teilnehmen, dabei orientiert sich ihr Ausbildungsangebot am akademischen Kanon. Die liberale Grundhaltung in Verbindung mit einem qualifizierten Unterricht führt rasch zu großer Be-liebtheit des Instituts bei französischen wie ausländischen Studierenden.
[14] Siehe dazu auch Kapitel 3.2 dieser Arbeit.
[15] Abbildung im Internet verfügbar unter dem Link http://fryemuseum.org/images/exhibition_images/munich1.jpg
[16] Karl Voll (1867 – 1917), Kunstkritiker der „Allgemeinen Zeitung“, Dozent für Kunstgeschichte an der Universität München und Konservator an der Alten Pinakothek
[17] Diese Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam im ersten Jahr der Regentschaft von Königin Wilhelmina (1898–1948) begründet eine neue Entwicklung. Zum ersten Mal findet begleitend ein kunsthistorischer Fachkongress statt.
[18] Abbildung im Internet verfügbar unter dem Link http://www.reproarte.com/files/images/S/slevogt_max/danae.jpg
[19] Gezeigt wird bei dieser Gelegenheit seine Arbeit „Scheherazade“ aus dem Jahr 1899.
[20] Abbildung des Mittelteils im Internet verfügbar unter dem Link http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Der_verlorene_Sohn_Max_Slevogt.jpg
[21] Edouard Manet (23. Januar 1832, Paris – 30. April 1883, ebenda)
[22] Paul Cassirer (1871, Görlitz – 1926, Berlin), Studium der Kunstgeschichte in München, Mitarbei-ter der Zeitschrift „Simplicissimus“, Übersiedlung nach Berlin. Dort gründet er gemeinsam mit seinem Cousin Bruno Cassirer (1872, Breslau – 1941, Oxford) eine Galerie samt angeschlosse-ner Verlagsbuchhandlung. Paul und Bruno C. werden bei der Gründung der Sezession zu deren Sekretären berufen, sie fördern die Künstler der Sezession und später auch des Expressionis-mus. 1901 trennen sie ihre Geschäfte, Bruno führt den Verlag, Paul Cassirer die Galerie und die Kunsthandlung. Er gibt ab 1910 zusätzlich die neu gegründete Kunstzeitschrift „PAN“ heraus. Slevogt lernt Paul Cassirer anlässlich der ersten Ausstellung der Berliner Sezession kennen und bleibt ihm bis zu dessen Freitod freundschaftlich verbunden.
[23] Prinzregent Luitpold von Bayern (1821 – 1912) übernimmt nach der Enthüllung seines Neffen Ludwig II. ab 1886 die Regentschaft, nach dessen Tod auch für dessen geisteskranken Bruder Otto I.
[24] Lovis Corinth (21. Juli 1858, Tapiau/Ostpreußen – 17. Juli 1925, Zandvoort/Niederlande)
[25] 1902 wird Slevogt Mitglied der Berliner Sezession, bis 1910 gehört er ihrem Vorstand an. 1914 tritt er der u. a. von Max Liebermann mitbegründeten „Freien Sezession“ bei, wird auch hier Mitglied des Vorstands.
[26] Dieses Wandbild gehörte zu den herausragenden Beispielen sakraler Kunst des 20. Jahr-hunderts; es wurde bei den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg zerstört.
[27] Eine Abbildung dazu ist im Internet unter folgendem Link verfügbar:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.rhein-lahn-info.de/pressedienst-2001/112-slevogt-1-400.jpg imgrefurl=http://www.rhein-lahn-info.de/pressedienst-2001/112.htm usg=__ r3dLugblNr5rrmOWr3VN-GgD6so= h=507 w=400 sz=71 hl=de start=3 tbnid=_-ZC7drs UGU2gM: tbnh=131 tbnw=103 prev=/images%3Fq%3Dslevogt,%2Bgrafik%26gbv%3D2%26hl %3Dde
[28] Moritz von Schwind (21. Januar 1804, Wien – 8. Februar 1871, Niederpöcking/Starnberger See), 1847 bis 1870 Professor für Historienmalerei an der Akademie in München
[29] Wilhelm von Kaulbach (15. Oktober 1804, Arolsen – 7. April 1874, München), 1849 bis 1874 Professor für Malerei an der Akademie München
[30] Franz von Lenbach (eigentlich Franz Seraph Lenbach, geadelt 1882, 13. Dezember 1836, Schrobenhausen/ Oberbayern – 6. Mai 1904, München)
[31] Karl von Piloty (eigentlich Carl Theodor von Piloty, 1. Oktober 1826, München – 21. Juli 1886, Ambach/Starnberger See), 1856 bis 1886 Professor für Historienmalerei an der Akademie München
[32] Auch sie ist an der Münchner Akademie mit bedeutenden Lehrern vertreten, so Johann Georg Dillis (zwischen 1808 und 1814) und Wilhelm von Kobell (zwischen 1814 und 1826).
[33] „Schule von Barbizon“ bezeichnet eine Strömung der französischen Landschaftsmalerei, be-nannt nach dem gleichnamigen Dorf im Wald von Fontainebleau, wo zwischen 1840 und 1870 eine Malerkolonie ansässig war.
[34] Francisco d´Andrade (11. Januar 1859, Lissabon – 8. Februar 1921, Berlin), portugiesischer Bariton, der von Berlin aus große Bekanntheit erlangte, vor allem durch seine Darstellung des Don Giovanni in der gleichnamigen Mozart-Oper. In dieser Rolle wurde er von Max Slevogt mehrfach porträtiert.
[35] Ursprünglich bezeichnet dies eine pfalzgräfliche Burg aus dem 12. Jahrhundert, oberhalb des heutigen Gutshofes gelegen und zeitweilig im Besitz der Grafen von Pfalz-Zweibrücken. Von dieser Anlage zeugen heute nur noch wenige Reste; sie wurde 1689 durch französische Truppen zerstört. Der heutige Gutshof wird 1828 auf den Fundamenten des ehemaligen Wirtschaftshofes der Burg errichtet und gehört ab 1884 Dr. Peter Finkler aus Godramstein bei Landau. Als die Familie Finkler in finanzielle Bedrängnis gerät und der Hof versteigert wird, erwirbt Slevogt das Gut und baut es für seine Zwecke aus.
- Quote paper
- M. A. Sigrid Weyers (Author), 2007, Pfalzgalerie Kaiserslautern. Der deutsche Impressionismus am Beispiel Max Slevogt, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133429