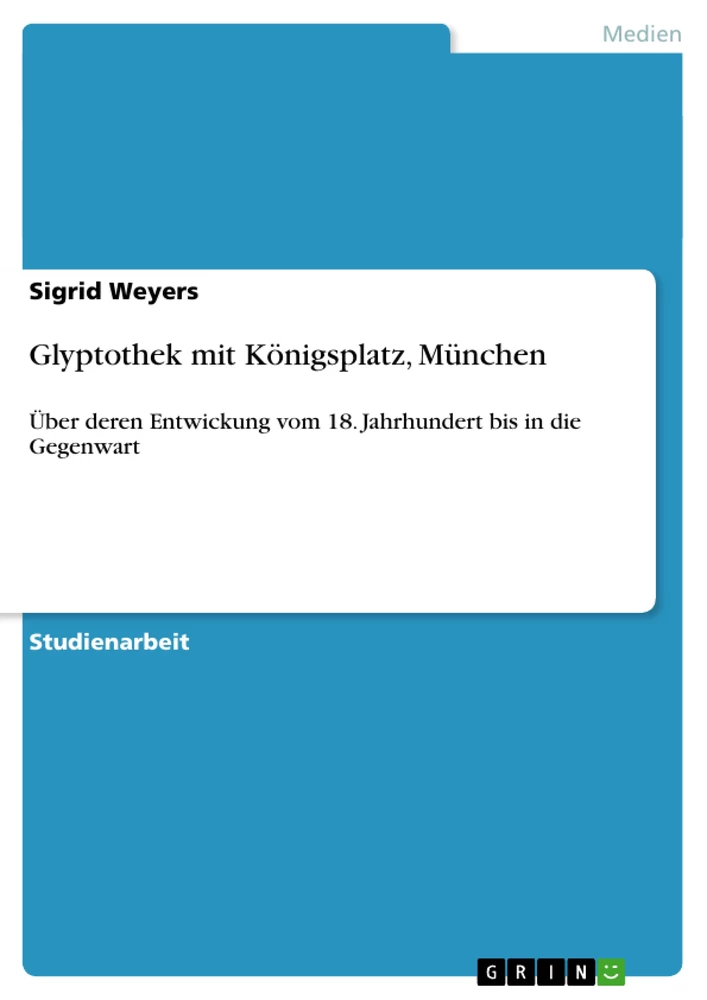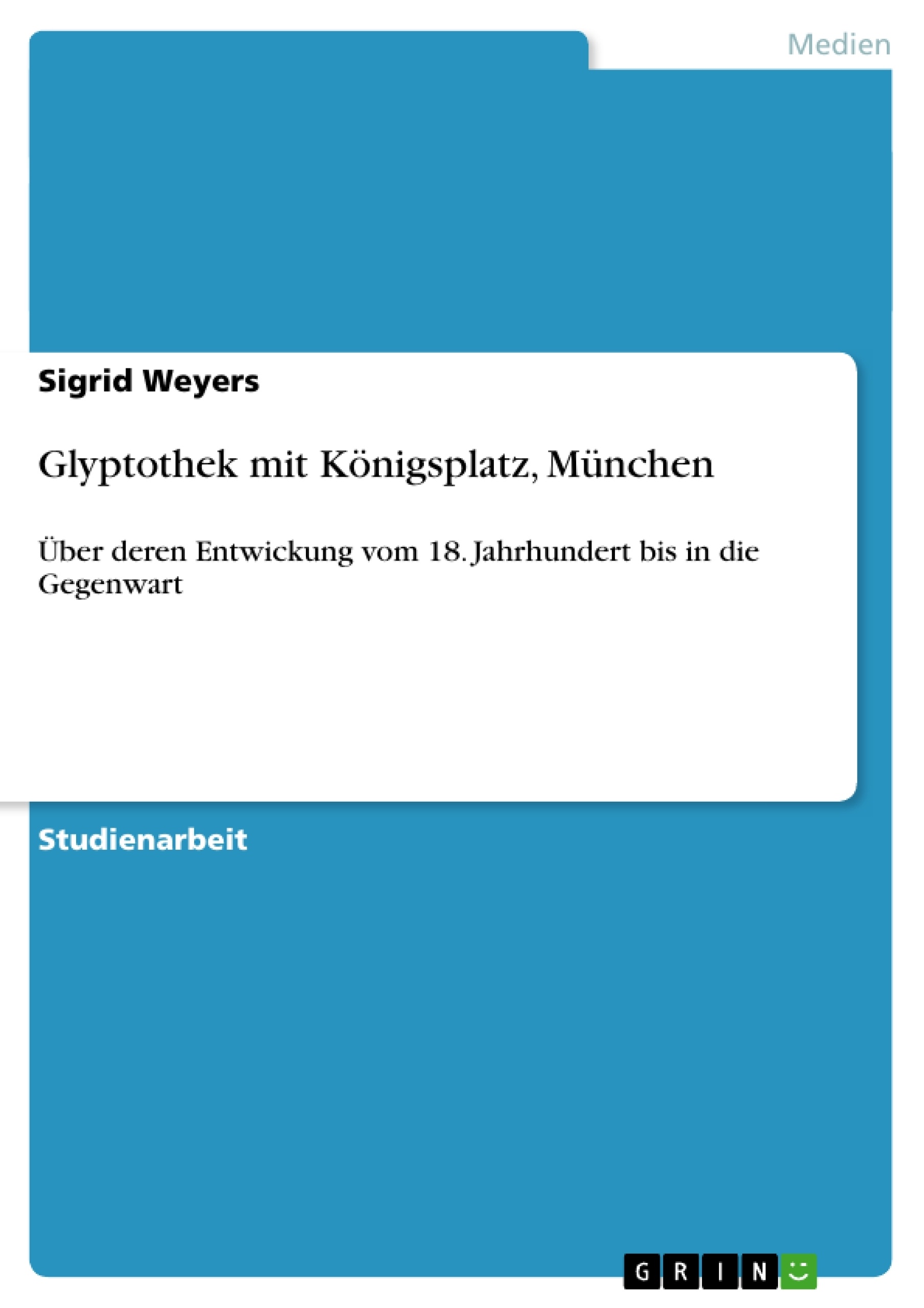1799 stirbt Kurfürst Karl Theodor von Bayern kinderlos, damit endet die bayrische Linie des Hauses Wittelsbach; Erbe und Nachfolger wird Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken. Nach der Vertreibung der Franzosen wird Kronprinz Ludwig zur treibenden Kraft im Königreich; unter seiner Ägide wandelt sich die Residenzstadt München in eine "königswürdige Kapitale". Ludwig orientiert sich dabei für die Maxvorstadt konzeptionell an den Plänen des Hofarchitekten Carl von Fischer und des Hofgartenintendanten Friedrich Ludwig von Sckell. Er lehnt jedoch ihre vom französischen Klassizismus geprägten Einzelentwürfe ab, er will eine authentischere griechische Architektur in Anlehnung an das von Johann Jakob Winckelmann geprägte Bild der Antike.
Seit 1805 bereist Ludwig jährlich Italien, er hält sich bevorzugt in Rom auf. Systematisch sammelt er antike Skulpturen, wichtigstes Kriterium ist ihm deren historische Authentizität, ganz im Sinne seiner Begeisterung für die griechische Antike. Die Sammlung wächst stetig und Ludwig wünscht sich einen angemessenen Ort, um sie aufzustellen und zu präsentieren.
Seine städtebaulichen Wünsche und Vorstellungen bündelt der Thronfolger 1813 in der Ausschreibung zu einem von ihm initiierten Architekturwettbewerb zur Gestaltung des Königsplatzes, der den glanzvollen Endpunkt der über den Karolinenplatz hinausführenden Briennerstraße bilden soll. Offiziell wird der Wettbewerb von der Königlich-Baierischen Akademie der Künste ausgelobt, die auch das Preisgericht stellt. Allerdings setzt sich Ludwig über die Entscheidung der Jury hinweg, als er nach Monaten den Entwurf Leo Klenzes zur Ausführung bestimmt.Im Frühjahr 1816 erfolgt die Grundsteinlegung für die Glyptothek, ihre Fertigstellung ist für 1823 geplant, erfolgt jedoch erst 1830. Die vorliegende Arbeit erläutert sowohl die Konzeption des Bau als auch die Baugeschichte der Glyptothek einschließlich ihres Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entwurf und Bau der Glyptothek (1816-1834)
- 1.1 Zur Vorgeschichte
- 1.2 Die Ausführung der Bauarbeiten
- 1.3 Die Eröffnung der Glyptothek
- 1.4 Der Assyrische Annex
- 2 Zerstörung und Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1 Die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges
- 2.2 Die Rekonstruktion bis 1964
- 2.3 Die Aegineten und ihre Bedeutung
- 2.4 Die Rekonstruktion unter Wiedemann
- 3 Die Glyptothek - Baubeschreibung (aktueller Zustand)
- 3.1 Südfassade
- 3.2 Ost- und Westfassade
- 3.3 Nordfassade
- 3.4 Innenhof
- 3.5 Die ursprüngliche Ausgestaltung der Innenräume
- 3.6 Äußerer Skulpturenschmuck
- 4 Der Königsplatz
- 4.1 Die Münchner Stadtentwicklung
- 4.2 Das Ensemble am Königsplatz
- 5 Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Glyptothek in München, von ihrem Entwurf und Bau im frühen 19. Jahrhundert bis zu ihrem heutigen Zustand. Der Fokus liegt auf der Rolle der Glyptothek im Kontext der Münchner Stadtentwicklung und der kulturellen Politik König Ludwigs I. Die Arbeit beleuchtet die architektonischen und künstlerischen Entscheidungen, die zum Bau und zur Gestaltung des Gebäudes führten, sowie die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des anschließenden Wiederaufbaus.
- Die Entstehung der Glyptothek unter König Ludwig I.
- Der architektonische Entwurf und die Baugeschichte des Gebäudes.
- Die Rolle der Glyptothek im Kontext der Münchner Stadtplanung.
- Die Zerstörung und der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Bedeutung der Glyptothek als Museum für antike Skulpturen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Entwurf und Bau der Glyptothek (1816-1834): Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Glyptothek im Kontext der politischen und kulturellen Entwicklung Münchens unter König Ludwig I. Es beleuchtet die Vorgeschichte, beginnend mit dem Erwerb antiker Skulpturen durch Ludwig I. und seinen Wunsch nach einem geeigneten Ausstellungsort. Die Ausführung der Bauarbeiten, die Herausforderungen bei der Materialbeschaffung und die konzeptionellen Auseinandersetzungen zwischen Ludwig I., Martin von Wagner und Leo von Klenze werden detailliert dargestellt. Die Eröffnung der Glyptothek und der spätere Anbau des Assyrischen Annexes bilden den Abschluss dieses Kapitels. Die Kapitel beschreibt den Einfluss des neu entstehenden Nationalbewusstseins auf die Architektur und die Bedeutung der Glyptothek als Ausdruck des Königlichen Selbstverständnisses und der Verbundenheit mit der Antike. Die Herausforderungen bei der Realisierung der Vision Ludwigs I. werden ebenso behandelt wie der Kompromiss zwischen der Vision von einem authentischen griechischen Stil und den technischen und finanziellen Möglichkeiten der Zeit.
2 Zerstörung und Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel behandelt die Zerstörung der Glyptothek während des Zweiten Weltkriegs und den anschließenden Wiederaufbau. Es dokumentiert die Schäden, die das Gebäude erlitt und den Prozess der Rekonstruktion bis 1964, wobei die Herausforderungen hinsichtlich der Aufarbeitung der Schäden und der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes im Fokus stehen. Die Bedeutung der Aegineten und ihre Rolle im Wiederaufbauprozess werden ausführlich diskutiert, ebenso wie die Arbeit des Architekten Wiedemann. Der Wiederaufbau der Glyptothek zeigt die schwierige Aufgabe des Umgangs mit der Vergangenheit, sowohl im Hinblick auf die Rekonstruktion eines geschichtsträchtigen Gebäudes als auch im Umgang mit der Geschichte der NS-Zeit.
3 Die Glyptothek - Baubeschreibung (aktueller Zustand): Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung der Glyptothek in ihrem heutigen Zustand. Die Südfassade, die Ost- und Westfassade, die Nordfassade und der Innenhof werden jeweils separat behandelt, einschließlich der ursprünglichen Ausgestaltung der Innenräume und des äußeren Skulpturenschmucks. Die Beschreibung der verschiedenen Fassaden erlaubt ein tieferes Verständnis für die Architektur und das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum. Die Beschreibung der Innenräume verdeutlicht die Konzeption der Ausstellung und die Bedeutung des Lichts und der Raumabfolge. Das Kapitel dient als detaillierter architektonischer Führer durch das Gebäude.
4 Der Königsplatz: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Königsplatzes in München und seine Bedeutung im Kontext der Münchner Stadtentwicklung. Es setzt die Glyptothek in das Gesamtbild des Ensembles am Königsplatz. Die Entwicklung des Platzes wird in Verbindung mit der Stadtentwicklung Münchens betrachtet. Die Positionierung der Glyptothek innerhalb dieses Ensembles wird detailliert untersucht, um ihre städtebauliche Funktion zu verdeutlichen und die Gesamtkomposition zu verstehen.
Schlüsselwörter
Glyptothek, München, König Ludwig I., Leo von Klenze, Antike, Architektur, Stadtentwicklung, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, Klassizismus, Museumsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Glyptothek in München
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Glyptothek in München. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entstehung, Zerstörung und dem Wiederaufbau des Gebäudes sowie seiner Rolle in der Münchner Stadtentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 behandelt Entwurf und Bau der Glyptothek (1816-1834), Kapitel 2 die Zerstörung und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Kapitel 3 bietet eine Baubeschreibung des aktuellen Zustands, Kapitel 4 beleuchtet den Königsplatz und seine Bedeutung, und Kapitel 5 beinhaltet eine Würdigung.
Welche Themen werden in Kapitel 1 behandelt?
Kapitel 1 beschreibt die Entstehung der Glyptothek unter König Ludwig I., den Erwerb antiker Skulpturen, die Ausführung der Bauarbeiten, die Herausforderungen bei der Realisierung, die Eröffnung und den Assyrischen Annex. Es werden die konzeptionellen Auseinandersetzungen zwischen Ludwig I., Martin von Wagner und Leo von Klenze sowie der Einfluss des neu entstehenden Nationalbewusstseins auf die Architektur beleuchtet.
Was wird in Kapitel 2 über die Zerstörung und den Wiederaufbau beschrieben?
Kapitel 2 dokumentiert die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und den anschließenden Wiederaufbau bis 1964. Es behandelt die Schäden am Gebäude, die Herausforderungen bei der Rekonstruktion, die Bedeutung der Aegineten und die Rolle des Architekten Wiedemann. Der Umgang mit der Vergangenheit im Hinblick auf den Wiederaufbau und die NS-Zeit wird thematisiert.
Worauf konzentriert sich Kapitel 3?
Kapitel 3 liefert eine detaillierte Baubeschreibung der Glyptothek im aktuellen Zustand. Es beschreibt die Südfassade, die Ost- und Westfassade, die Nordfassade, den Innenhof, die ursprüngliche Innenausgestaltung und den äußeren Skulpturenschmuck. Es dient als architektonischer Führer durch das Gebäude.
Welchen Aspekt beleuchtet Kapitel 4?
Kapitel 4 untersucht die Entwicklung des Königsplatzes in München und die Bedeutung der Glyptothek innerhalb des Ensembles am Königsplatz im Kontext der Münchner Stadtentwicklung. Die städtebauliche Funktion der Glyptothek wird detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Glyptothek, München, König Ludwig I., Leo von Klenze, Antike, Architektur, Stadtentwicklung, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, Klassizismus, Museumsgeschichte.
Wer waren die wichtigsten Akteure im Bau der Glyptothek?
Die wichtigsten Akteure waren König Ludwig I. als Auftraggeber, Leo von Klenze als Architekt und Martin von Wagner als Berater für die Kunstwerke.
Welche Bedeutung hat die Glyptothek im Kontext der Münchner Stadtentwicklung?
Die Glyptothek ist ein zentraler Bestandteil des Ensembles am Königsplatz und repräsentiert einen wichtigen Aspekt der Münchner Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert und darüber hinaus. Sie zeigt das königliche Selbstverständnis und die Verbundenheit mit der Antike.
Wie wurde die Glyptothek nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut?
Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war ein langwieriger und komplexer Prozess, der die Herausforderungen der Rekonstruktion eines geschichtsträchtigen Gebäudes mit den Schwierigkeiten des Umgangs mit der Vergangenheit verband. Die Arbeit des Architekten Wiedemann spielte dabei eine zentrale Rolle.
- Quote paper
- M. A. Sigrid Weyers (Author), 2005, Glyptothek mit Königsplatz, München, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/133154