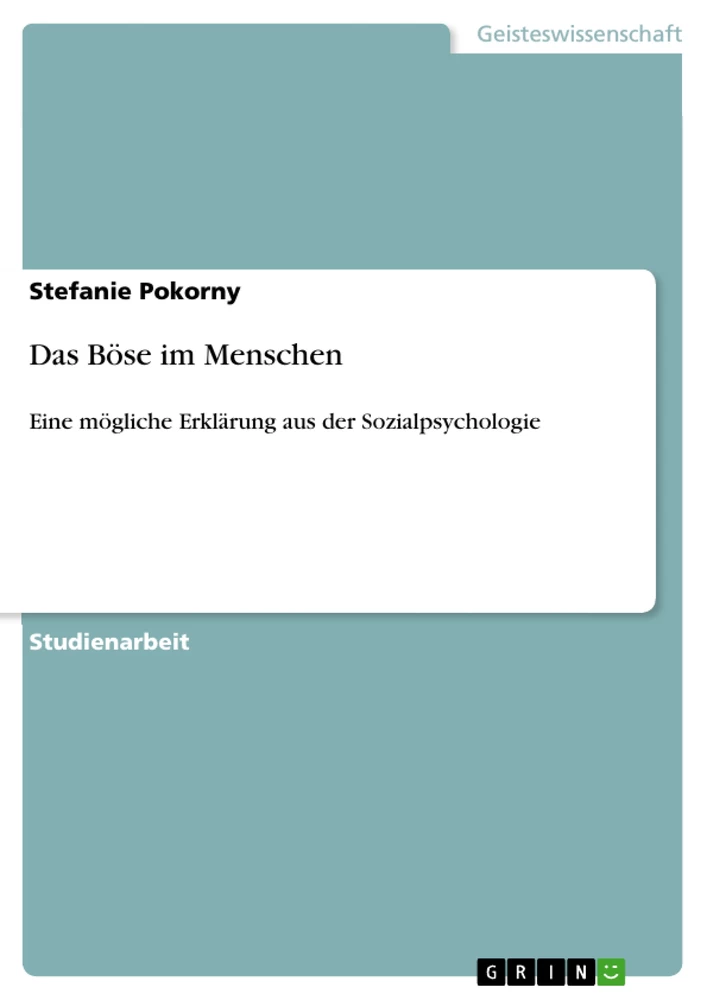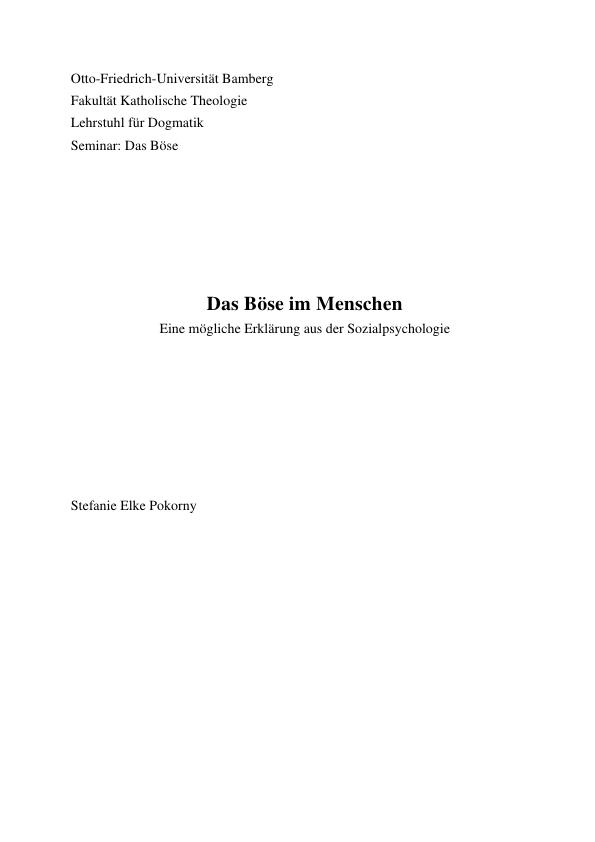Tag für Tag sieht und hört man in den Medien von Gewalt, Brutalität, Mord. Die wenigen Meldungen, die über erfreuliche Dinge berichten, bleiben selten lange im Gedächtnis, doch an die bösen Geschehnisse erinnert man sich. Mit einer Mischung aus Ekel, völligem Unverständnis aber auch Faszination verfolgt man beispielsweise Bilder vom 11. September, Bilder aus Abu Ghraib und Bilder vom Irak Krieg. Das Böse scheint alltäglich und allgegenwärtig zu sein und man fragt sich, welche Menschen das sind, die solche grauenhaften Taten vollbringen können. Ganz automatisch ist man dazu geneigt, diesen Tätern gewisse Attribute zuzuschreiben, wie zum Beispiel mangelndes Unrechtbewusstsein, fehlende soziale Kompetenzen, hohe Gewaltbereitschaft, schlechtes Elternhaus oder sogar genetische Dispositionen. Die Ursache für böses Verhalten wird meist in der Persönlichkeit und im persönlichen Umfeld des Täters gesucht; doch was, wenn diese Erklärungen unzureichend sind? Was macht dann Menschen tatsächlich böse?
Dieser Frage hat sich ein Mann namens Philip George Zimbardo angenommen, der versucht, die Wurzeln des Bösen zu erklären. Zimbardo ist emeritierter Professor der Psychologie an der Stanford Universität in Kalifornien. Geboren 1933 in der Bronx, New York City kam er bereits als Kind mit viel Armut und Verbrechen in Berührung, was ihn schon damals dazu veranlasste, über die Ursache von Gewalt nachzudenken. Seinen Durchbruch erreichte Professor Zimbardo mit dem sogenannten Stanford Prison Experiment , das er 1971 an der Stanford Universität initiierte und durchführte. Mit diesem Versuch wollte er beweisen, dass Menschen, die böse handeln, nicht von Grund auf böse sind, sondern, dass der Ort, die Situation oder das System, in dem sie sich befinden, für böse Taten verantwortlich ist. Ganz konkret befasst er sich mit diesem Thema in seinem Buch „Der Luzifer-Effekt“. Da dieses Werk erst kürzlich erschienen, und die Forschungsliteratur zu diesem Thema daher sehr gering ist, ist „Der Luzifer-Effekt“ die Grundlage dieser Arbeit. In diesem Buch geht es vorrangig um eine detaillierte Beschreibung des SPEs, um die Analyse und Auswertung des daraus entstandenen Forschungsmaterials und ganz aktuell um etwaige Parallelen zum Folterskandal in Abu Ghraib.
Inhaltsverzeichnis
- DIE FASZINATION DES BÖSEN
- STANFORD PRISON EXPERIMENT
- DIE IDEE DAHINTER
- VORBEREITUNGEN
- DURCHFÜHRUNG DES EXPERIMENTS
- Ankunft
- Erster Aufstand
- Entlassung von #8612
- Besuchsnachmittag
- Entlassung von #819
- Ein neuer Häftling kommt
- Vorzeitiger Abbruch
- PSYCHOLOGISCHE TAKTIKEN
- WAS IST DER LUZIFER-EFFEKT?
- PARALLELEN ZU WILLIAM GOLDINGS „HERR DER FLIEGEN“
- HANDLUNG
- UNTERSUCHUNG EINIGER TEXTSTELLEN
- DIE FRAGE NACH DEN TÄTERN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, was Menschen tatsächlich böse macht. Sie untersucht das Stanford Prison Experiment (SPE) von Philip Zimbardo, das die Auswirkungen des Systems auf das Verhalten von Gefangenen und Wärtern erforscht. Ziel ist es, zu zeigen, dass Menschen, die böse handeln, nicht von Grund auf böse sind, sondern dass der Ort, die Situation oder das System, in dem sie sich befinden, für böse Taten verantwortlich ist. Die Arbeit analysiert die psychologischen Taktiken, die im SPE angewandt wurden, und erläutert den Luzifer-Effekt, der die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen beschreibt. Darüber hinaus werden Parallelen zu William Goldings „Herr der Fliegen“ gezogen, um die Anwendbarkeit von Zimbardos Theorien auf literarische Werke zu untersuchen.
- Das Stanford Prison Experiment als Modell für die Untersuchung der Psychologie des Bösen
- Der Einfluss von Macht und Autorität auf menschliches Verhalten
- Die Rolle von Situation und System in der Entstehung von Gewalt und Brutalität
- Der Luzifer-Effekt als Erklärung für die Transformation von Menschen zu Tätern
- Parallelen zwischen dem SPE und literarischen Werken wie „Herr der Fliegen“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Faszination des Bösen und stellt die Frage nach den Ursachen für böses Verhalten. Es wird deutlich, dass die Suche nach Erklärungen oft auf die Persönlichkeit und das Umfeld des Täters fokussiert, jedoch unzureichend sein kann. Philip Zimbardo, der sich mit der Frage nach den Wurzeln des Bösen auseinandersetzt, entwickelte das Stanford Prison Experiment (SPE) als Versuch, die Macht der Situation und des Systems auf menschliches Verhalten zu untersuchen.
Das zweite Kapitel beschreibt das SPE im Detail. Es geht auf die Idee hinter dem Experiment, die Vorbereitungen und die Durchführung ein. Die Auswahl der Probanden, die Rollenverteilung und die Gestaltung des Gefängnisses werden erläutert. Die zentralen Fragen des Experiments, wie die Reaktion der Gefangenen auf die eingeschränkte Freiheit und die Auswirkungen des Systems auf ihr Handeln, werden hervorgehoben.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den psychologischen Taktiken, die im SPE angewandt wurden. Es werden die Methoden der Wärter zur Erzeugung von Langeweile, Frustration und Unterwürfigkeit bei den Gefangenen beschrieben. Die Auswirkungen dieser Taktiken auf das Verhalten der Probanden werden analysiert.
Das vierte Kapitel erläutert den Luzifer-Effekt, der die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen beschreibt. Es wird gezeigt, wie Menschen durch die Situation und das System zu Tätern werden können, selbst wenn sie im Vorfeld keine bösen Absichten hatten.
Das fünfte Kapitel untersucht Parallelen zwischen dem SPE und William Goldings „Herr der Fliegen“. Es werden Textstellen aus dem Roman analysiert, um zu zeigen, wie die Theorien von Zimbardo auf literarische Werke anwendbar sind. Die Handlung des Romans und die Charakterentwicklung der Jungen werden im Kontext des SPE betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Stanford Prison Experiment, die Psychologie des Bösen, der Luzifer-Effekt, die Macht der Situation, die Rolle des Systems, Gewalt, Brutalität, Macht und Autorität, Unterwürfigkeit, Selbstbestimmung, „Herr der Fliegen“ und William Golding.
- Quote paper
- Stefanie Pokorny (Author), 2008, Das Böse im Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/132918