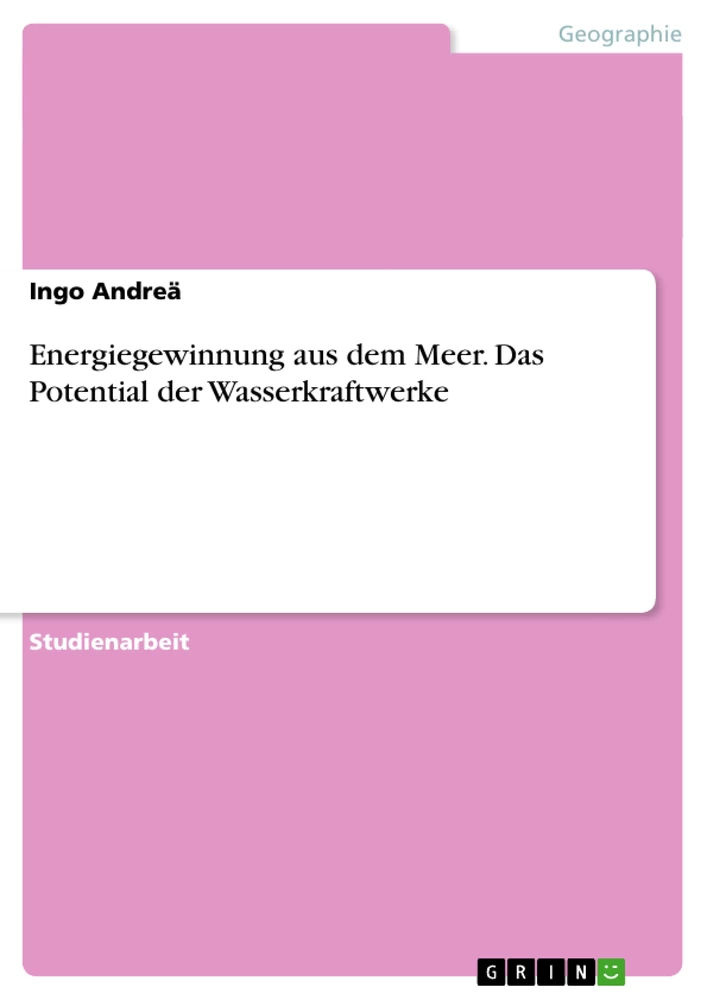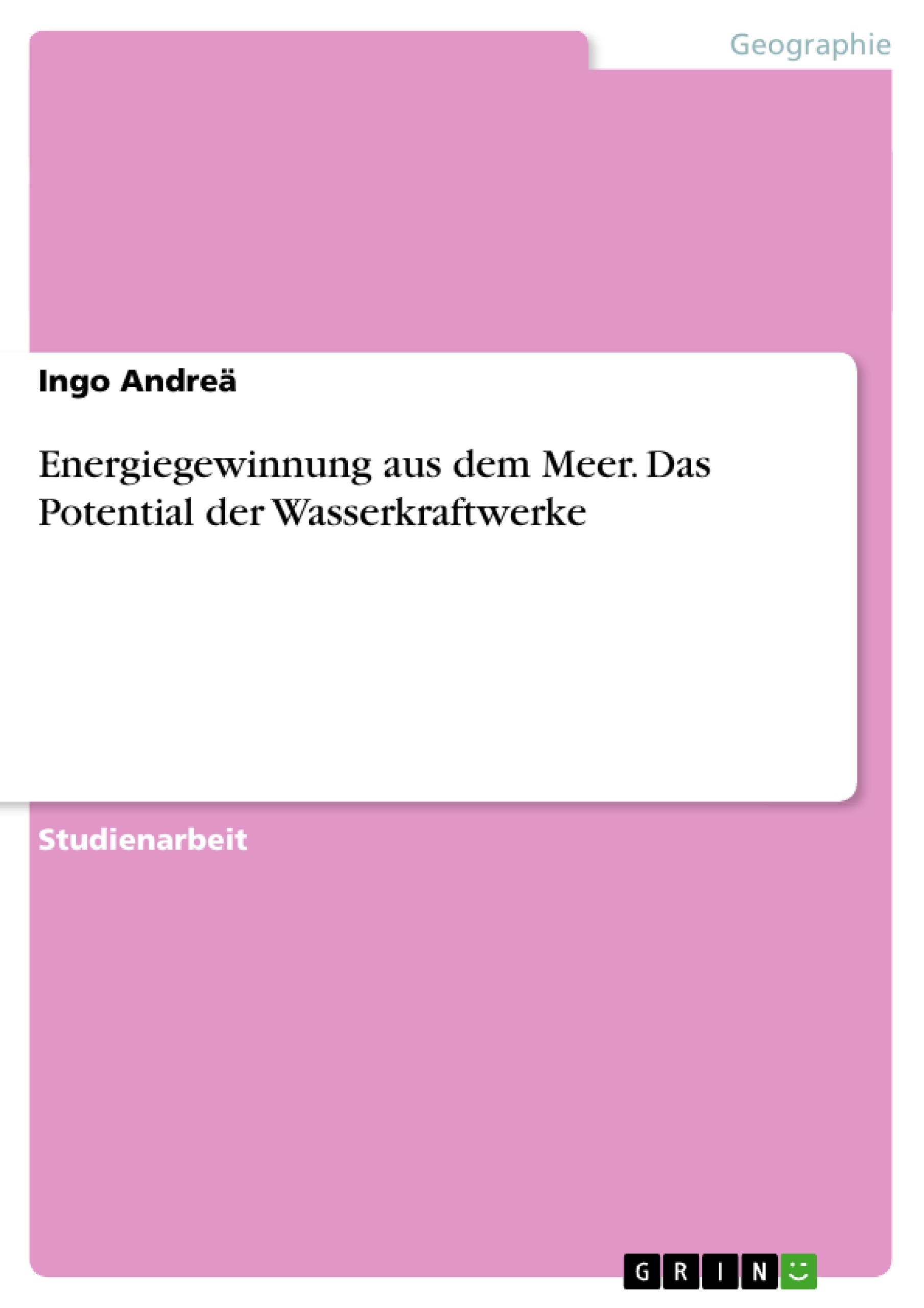Die Diskussion um die Energieversorgung der Zukunft, ist seit dem Preisanstieg bei den PKW- Kraftstoffen und Heizöl in der breiten Öffentlichkeit ein aktuelles Thema. Jeden Tag erreichen uns aus dem Medien neue Artikel zum Thema Energie, so dass die Gesellschaft seit kurzem mit dem Umgang von endlichen Rohstoffen, durch den starken Preisanstieg, sensibler geworden ist.
Auf der Suche nach Möglichkeiten aus der Energiekrise ist der Mensch auf kreative Ideen zur Gewinnung von Energie angewiesen. Die größten Potenziale zur Krafterzeugung sind in Form von natürlichen und unendlichen Ressourcen in Wind, Sonne, Boden und Wasser vorhanden. Seit Jahrhunderten wird die mechanische Energie des Wassers in Mühlen oder Hammerwerke genutzt. Mit der Zunahme am Strombedarf im 20. Jahrhundert gibt es Anlagen zur Stromgewinnung aus Wasserkraft. Insbesondere an Flüssen wurden Anlagen zur Stromerzeugung gebaut.
Die Energiegewinnung aus dem Meer dient der Verwirklichung ökologischer und auch ökonomischer Ziele. Sie dient dem Schutz und der Erforschung der Meere, einem besseren Verständnis unsere Umwelt, einer Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit auch ein Schutz gegen geopolitische Interessenkonflikte. Es sollte also im Interesse aller beteiligten Länder liegen, das Thema Meeresenergie weiter zu entwickeln und zu erforschen.
Diese Arbeit beschäftigt sich im primär mit den Möglichkeiten und schon realisierten Kraftwerken bzw. die mit denen die sich in einem Projektstadion befinden.
Diese Arbeit spannt einen Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart hinüber zu Zukunftsvisionen der Gewinnung aus der Bewegungskraft der Ozeane und Meere.
Den Anfang macht eine kurze Einführung der Möglichkeiten zur Wasserkraftgewinnung. Der darauf folgendem Abschnitt beschäftigt sich dann mit den Nutzungsmöglichkeiten der Kraftgewinnung aus dem Meer.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung - Die Wasserkraft als unerschöpfliche Energiequelle
- 2 Wasserkraft an Land und Meer
- 3 Wasserkraftwerke – Nutzung der Meeresenergie
- 3.1 Gezeitenkraftwerke
- 3.1.1 Historischer Überblick - Traditionelle Nutzung von Gezeitenmühlen
- 3.1.2 La Rance – Das Tidenkraftwerk in Frankreich
- 3.2 Wellenkraftwerke
- 3.3 Strömungskraftwerke
- 3.3.1 Projektstudie Seaflow und SeaGen
- 3.4 Meereswärmekraftwerke
- 3.5 Osmose-Kraftwerke
- 3.1 Gezeitenkraftwerke
- 4 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Energiegewinnung aus dem Meer, beleuchtet bestehende Anlagen und Projekte und gibt einen Überblick über historische und zukünftige Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Nutzung verschiedener Formen der Meeresenergie, ihren Vor- und Nachteilen im Vergleich zur konventionellen Wasserkraft an Land.
- Wasserkraft als unerschöpfliche Energiequelle
- Vergleich von Wasserkraft an Land und Meer
- verschiedene Technologien zur Meeresenergiegewinnung (Gezeiten-, Wellen-, Strömungs-, Meereswärme- und Osmosekraftwerke)
- Ökologische und ökonomische Aspekte der Meeresenergiegewinnung
- Bewertung des Potenzials der Meeresenergie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung - Die Wasserkraft als unerschöpfliche Energiequelle: Die Einleitung betont die steigende Bedeutung der Suche nach alternativen Energiequellen angesichts knapper werdender fossiler Brennstoffe. Sie führt in die Thematik der Wasserkraft ein, die seit Jahrhunderten genutzt wird, und hebt die Bedeutung der Meeresenergie als großes, noch weitgehend ungenutztes Potential hervor. Die Einleitung stellt den Kontext für die Arbeit dar und verweist auf die Notwendigkeit der Entwicklung und Erforschung der Meeresenergie zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und zur Vermeidung geopolitischer Konflikte. Der Text unterstreicht den Unterschied zwischen dem hohen Anteil der Wasserkraft an der weltweiten Stromversorgung (18%) und dem niedrigen Anteil in Deutschland (4%), was den Bedarf an alternativen Strategien verdeutlicht.
2 Wasserkraft an Land und Meer: Dieses Kapitel vergleicht die konventionelle Wasserkraft an Land mit der Meeresenergie. Es beschreibt die Funktionsweise von Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerken und nennt den Drei-Schluchten-Staudamm in China als Beispiel für ein großes Wasserkraftwerk mit ökologischen Nachteilen (Überflutung von Land, Vernichtung von Flora und Fauna). Die Vorteile der Wasserkraft an Land (hohe Zuverlässigkeit, geringe Betriebskosten, lange Lebensdauer) werden den Nachteilen (ökologische Folgen für Flussläufe, Infrastrukturveränderungen) gegenübergestellt. Der Abschnitt argumentiert, dass die Potenziale der Wasserkraft an Land weitgehend ausgeschöpft sind, während die Meeresenergie ein enormes, bisher kaum genutztes Potenzial bietet. Die verschiedenen Möglichkeiten der Energiegewinnung aus dem Meer (mechanische Energie aus Wellen, Gezeiten und Strömungen, thermische und osmotische Energie) werden kurz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Wasserkraft, Meeresenergie, Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Strömungskraftwerke, Meereswärmekraftwerke, Osmosekraftwerke, erneuerbare Energien, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Aspekte, Energieversorgung, Drei-Schluchten-Staudamm.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Wasserkraft an Land und Meer: Nutzung der Meeresenergie"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Energiegewinnung aus dem Meer, beleuchtet bestehende Anlagen und Projekte und gibt einen Überblick über historische und zukünftige Entwicklungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der Nutzung verschiedener Formen der Meeresenergie mit der konventionellen Wasserkraft an Land, inklusive deren Vor- und Nachteile.
Welche Arten der Meeresenergiegewinnung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Technologien zur Meeresenergiegewinnung, darunter Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Strömungskraftwerke, Meereswärmekraftwerke und Osmosekraftwerke. Für jede Technologie werden jeweils Beispiele und/oder Projekte genannt (z.B. La Rance Gezeitenkraftwerk, Projekt Seaflow und SeaGen).
Wie wird die konventionelle Wasserkraft an Land behandelt?
Die Arbeit vergleicht die konventionelle Wasserkraft an Land mit der Meeresenergiegewinnung. Sie beschreibt die Funktionsweise von Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerken und nennt den Drei-Schluchten-Staudamm als Beispiel für ein großes Wasserkraftwerk mit seinen ökologischen Nachteilen. Die Vor- und Nachteile der Wasserkraft an Land werden detailliert gegenübergestellt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Wasserkraft als unerschöpfliche Energiequelle), Wasserkraft an Land und Meer, Wasserkraftwerke – Nutzung der Meeresenergie (inkl. Unterkapitel zu Gezeiten-, Wellen-, Strömungs-, Meereswärme- und Osmosekraftwerken) und Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wasserkraft, Meeresenergie, Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Strömungskraftwerke, Meereswärmekraftwerke, Osmosekraftwerke, erneuerbare Energien, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Aspekte, Energieversorgung, Drei-Schluchten-Staudamm.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten der Meeresenergiegewinnung umfassend darzustellen und deren Potenzial im Vergleich zur konventionellen Wasserkraft zu bewerten. Sie beleuchtet ökologische und ökonomische Aspekte und gibt einen Überblick über historische und zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Konkrete Beispiele umfassen das Gezeitenkraftwerk La Rance in Frankreich, sowie die Projektstudien Seaflow und SeaGen im Bereich der Strömungskraftwerke. Der Drei-Schluchten-Staudamm dient als Beispiel für ein großes Wasserkraftwerk an Land mit seinen ökologischen Auswirkungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit betont das große, noch weitgehend ungenutzte Potenzial der Meeresenergie als alternative Energiequelle angesichts knapper werdender fossiler Brennstoffe. Der Vergleich mit der Wasserkraft an Land zeigt sowohl die Vorteile als auch die Limitationen beider Ansätze auf.
- Quote paper
- Ingo Andreä (Author), 2006, Energiegewinnung aus dem Meer. Das Potential der Wasserkraftwerke, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/132313