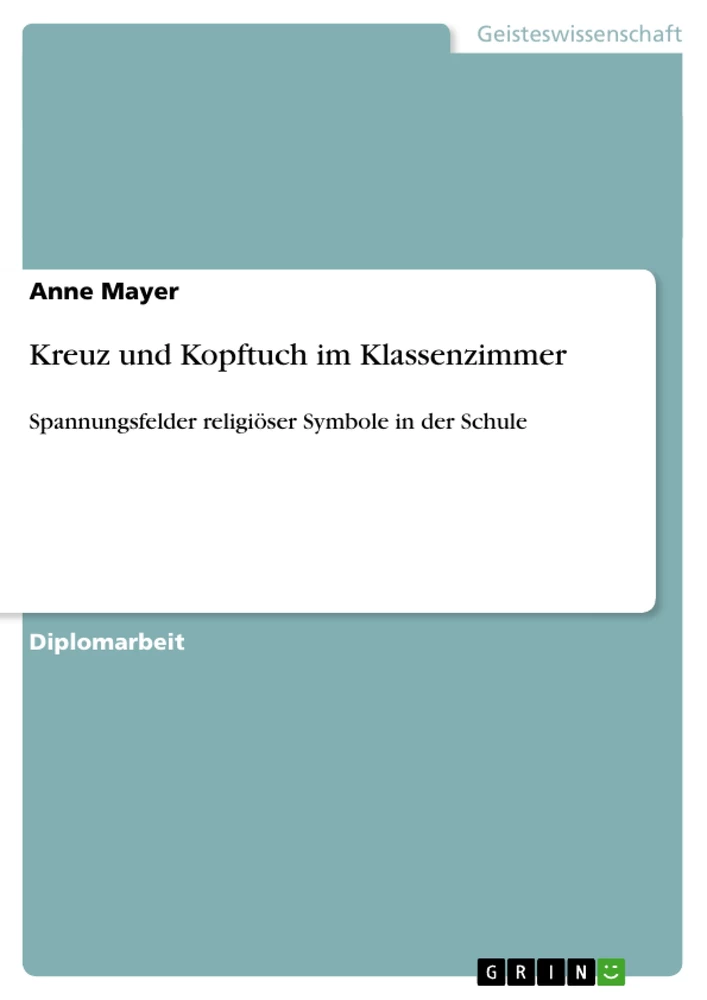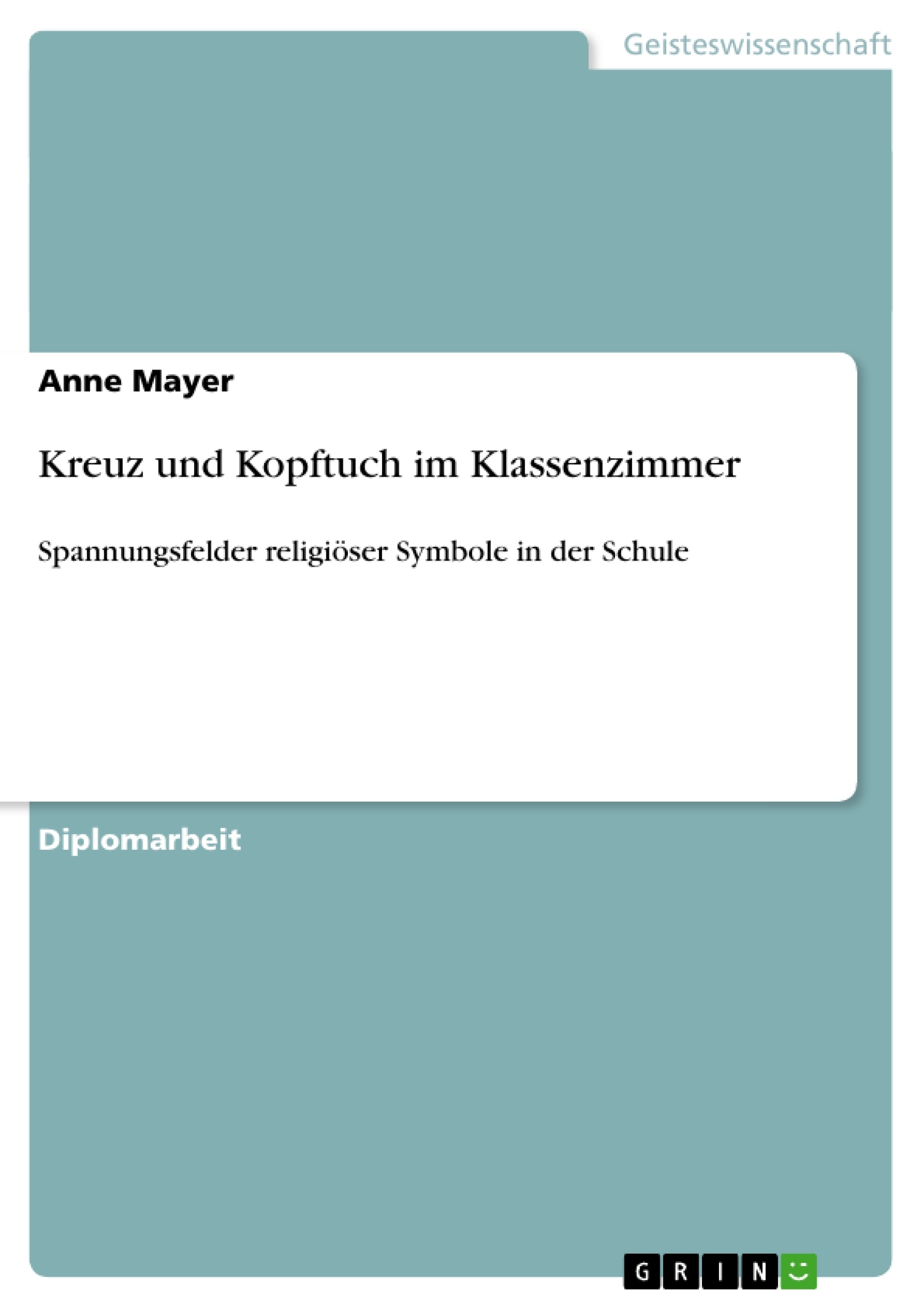In vielen Ländern Mittel- und Westeuropas gibt es in den letzten Jahren im verstärkten Maße gesellschaftliche Grundsatzdiskussionen über religiöse Symbole in öffentlichen Schulen. Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen dabei vor allem das Schulkreuz und das Kopftuch der muslimischen Lehrerin. Die Diskussionen beschäftigen sich unter anderem mit den zentralen Fragen,ob das Aufhängen von Kreuzen in Klassenzimmern erlaubt, verboten oder gar verpflichtend sein soll und ob Kopftuch tragende Musliminnen als Lehrerinnen in öffentlichen Schulen
unterrichten dürfen oder nicht. In einigen europäischen Ländern wie beispielsweise in Deutschland führten diese Kontroversen
in den letzten Jahren zu juristischen Auseinandersetzungen und in weiterer Folge zur Neuformulierung der diesbezüglichen gesetzlichen Normen. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurden in Deutschland sowohl das Symbol des Kreuzes als auch das Symbol des Kopftuchs aus der öffentlichen Sphäre der Schule zurückgedrängt.
Obwohl auch in Österreich über dieses Thema diskutiert wurde und wird, sind Schulkreuze in Klassenzimmern ebenso wie auch das Tragen des Kopftuchs durch Lehrerinnen im öffentlichen
Schuldienst zulässig.
Der Hauptteil der Arbeit ist einer fundierten Auseinandersetzung mit den Symbolen des Kreuzes und des Kopftuchs gewidmet. In diesen beiden Kapiteln werden neben der Frage nach der Bedeutung der Symbole auch gesellschaftliche Aspekte, die gesetzliche
Situation in anderen Ländern und vor allem die auch in Österreich aufsehenerregenden
grundrechtlichen Debatten in Deutschland durchleuchtet.
Auf dieser Grundlage wird im Anschluss jeweils die österreichische Gesetzeslage erläutert und
mit den deutschen Regelungen verglichen.
In Kapitel 7 zum Symbol des Kopftuches schien es darüber hinaus sinnvoll, dem Thema die
wesentlichen Grundzüge des Islams, seines Frauenbildes und seiner religiösen Vorschriften
bezüglich des Kopftuchs voranzustellen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die beiden Symbole des Schulkreuzes und des Kopftuchs muslimischer Lehrerinnen im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Rechtspositionen zu analysieren und religiöse, gesellschaftliche und verfassungsrechtliche Aspekte aufzuarbeiten. Es soll aufgezeigt werden, warum der Umgang mit diesen beiden Symbolen zum Paradigma für grundsätzliche
verfassungstheoretische Konzepte in der Schulpolitik werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Meinungsstudie
- 3. Verhältnis zwischen Staat und Religion
- 3.1. Modelle des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in Europa
- 3.1.1. Strikte Trennung von Staat und Kirche
- 3.1.2. Staatskirchentum
- 3.1.3. Kooperationssysteme
- 3.2. Ausformungen des Neutralitätsprinzips in Staaten mit Kooperationssystemen
- 3.2.1. Distanzierende Neutralität
- 3.2.2. Offene Neutralität
- 3.3. Verhältnis von Staat und Religion in Österreich
- 3.1. Modelle des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in Europa
- 4. Grundrechte
- 4.1. Grundrechte in Österreich
- 4.1.1. Definition
- 4.1.2. Historische Entwicklung der Grundrechte in Österreich
- 4.1.3. Bindungswirkung der Grundrechte
- 4.2. Die Anerkennung von Religionsgesellschaften in Österreich
- 4.3. Grundrechte in der Europäischen Union
- 4.4. Grundrechte im religionsrechtlichen Kontext
- 4.4.1. Ausprägungen der Religions- und Weltanschauungsfreiheit
- 4.4.2. Religions- und Weltanschauungsfreiheit in Österreich
- 4.4.2.1. Staatsgrundgesetz
- 4.4.2.2. Staatsvertrag von St. Germain
- 4.4.2.3. Europäische Menschenrechtskonvention
- 4.4.3. Positive und negative Religionsfreiheit
- 4.4.4. Religionsfreiheit und Bildung
- 4.5. Schranken der Religionsfreiheit
- 4.6. Das Recht auf religiöse Kindererziehung
- 4.1. Grundrechte in Österreich
- 5. Symbole
- 5.1. Zum Symbolbegriff aus religionswissenschaftlicher Sicht
- 5.2. Die Merkmale des Symbols nach Paul Tillich
- 6. Das Kreuz im Klassenzimmer
- 6.1. Zur Bedeutung des Kreuzsymbols
- 6.1.1. Zur allgemeinen Bedeutung des Kreuzsymbols
- 6.1.1.1. Das Kreuz als reines Glaubenssymbol
- 6.1.1.2. Das Kreuz als kulturelles Symbol
- 6.1.1.3. Das Kreuz als christliches und kulturelles Symbol
- 6.1.1.4. Das Kreuz - ein positiv oder negativ besetztes Symbol?
- 6.1.2. Die spezifische Bedeutung des Schulkreuzes
- 6.1.3. Bedeutung des Kreuzes in der Meinungsstudie
- 6.1.1. Zur allgemeinen Bedeutung des Kreuzsymbols
- 6.2. Das Christentum und die kulturelle Identität Europas
- 6.3. Zur Gesetzeslage in anderen europäischen Staaten
- 6.4. Der Schulkreuz-Streit in Deutschland und seine Auswirkungen
- 6.4.1. Der Kruzifix-Beschluss des deutschen Verfassungsgerichtshofs
- 6.4.2. Wichtige religionsrechtliche Aussagen des Kruzifix-Beschlusses von 1995
- 6.4.2.1. Verstoß gegen die Glaubensfreiheit
- 6.4.2.2. Unvereinbarkeit mit dem Neutralitätsgebot des Staates
- 6.4.2.3. Die Deutung des Kreuzes als religiöses Symbol
- 6.4.3. Argumentation der Kritiker des Kruzifix-Beschlusses
- 6.4.3.1. Vereinbarkeit von Schulkreuzen mit der Religionsfreiheit
- 6.4.3.2. Vereinbarkeit von Schulkreuzen mit dem Neutralitätsprinzip
- 6.4.3.3. Betonung der säkularen Bedeutung des Schulkreuzes
- 6.5. Die bayerische Kruzifix-Regelung
- 6.6. Die österreichische Gesetzeslage im Bezug auf das Schulkreuz
- 6.6.1. Die Schulkreuzregelung des § 2b Religionsunterrichtsgesetz
- 6.6.2. Die Bestimmungen im Schulvertrag 1962 zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl
- 6.6.3. Zur Verfassungsmäßigkeit der österreichischen Schulkreuzregelung
- 6.6.4. Beseitigung der Schulkreuze in Österreich im geschichtlichen Rückblick
- 6.7. Andere Lösungsansätze im Kruzifixstreit
- 6.7.1. Mehrere Symbole in der Schulklasse als Alternative
- 6.7.2. Kreuze statt Kruzifixe
- 6.1. Zur Bedeutung des Kreuzsymbols
- 7. Das Kopftuch der muslimischen Lehrerin
- 7.1. Richtungen des Islam
- 7.2. Der Islam in Österreich
- 7.3. Zum Geschlechterverständnis im Islam
- 7.4. Das Kopftuch - ein Symbol?
- 7.5. Formen der Verschleierung
- 7.6. Islamische Vorschriften zum Kopftuch
- 7.7. Bedeutung des Kopftuchs
- 7.7.1. Kopftuch als religiöses Symbol bzw. als religiöse Vorschrift
- 7.7.2. Das Kopftuch als Zeichen der Würde und Sittsamkeit
- 7.7.3. Das Kopftuch als Zeichen der Zugehörigkeit
- 7.7.4. Das Kopftuch als politisches Symbol
- 7.7.5. Bedeutung des Kopftuchs in der Meinungsstudie
- 7.8. Zur Freiwilligkeit des Kopftuchs
- 7.9. Das Kopftuch und die säkulare Verfassung
- 7.9.1. Das deutsche Kopftuch-Urteil
- 7.10. Zentrale Aspekte der Auseinandersetzung um das Kopftuch
- 7.10.1. Das Kopftuch und die Glaubensfreiheit
- 7.10.2. Das Kopftuch und die staatliche Neutralität
- 7.10.3. Kopftuch und Integration
- 7.11. Das Kopftuch und die Gesetzeslage in Österreich
- 8. Schulkreuze und das Kopftuch der muslimischen Lehrerin im systematischen Vergleich
- 8.1. Gemeinsamkeiten der beiden Symbole
- 8.1.1. Grundsätzliches
- 8.1.2. Bedeutung des Symbols
- 8.1.3. Grundrechte
- 8.1.4. Staatliches Neutralitätsgebot
- 8.1.5. Ähnlichkeiten bei den konkreten rechtlichen Bestimmungen
- 8.2. Unterschiede zwischen den beiden Symbolen
- 8.2.1. Grundsätzliches
- 8.2.2. Bedeutung der Symbole
- 8.2.3. Grundrechte
- 8.2.4. Staatliches Neutralitätsgebot
- 8.2.5. Unterschiede bei den konkreten gesetzlichen Bestimmungen
- 8.2.5.1. Aussagen des deutschen Verfassungsgerichtshofs
- 8.2.5.2. Die spezifischen bayerischen Regelungen
- 8.2.5.3. Regelung in Österreich
- 8.1. Gemeinsamkeiten der beiden Symbole
- 9. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Spannungsfelder religiöser Symbole, insbesondere des Kreuzes und des Kopftuchs, im Kontext des österreichischen Schulsystems. Ziel ist es, die rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu analysieren, die mit der Präsenz dieser Symbole in der Schule verbunden sind.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Religionsfreiheit in Österreich und Europa
- Symbolische Bedeutung von Kreuz und Kopftuch
- Neutralitätsprinzip des Staates im Bildungssystem
- Konflikt zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität
- Integration und gesellschaftliche Akzeptanz religiöser Diversität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik der religiösen Symbole im Klassenzimmer ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie benennt die Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden religiösen Pluralität in der österreichischen Gesellschaft und zeigt den Forschungsansatz auf. Das Kapitel legt den Fokus auf die spezifischen Herausforderungen, die sich aus dem Zusammentreffen von religiösen Symbolen und der staatlichen Neutralität im Bildungssystem ergeben.
2. Meinungsstudie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Meinungsstudie zu den Einstellungen und Perspektiven verschiedener Akteure (Schüler, Lehrer, Eltern) hinsichtlich der Präsenz religiöser Symbole in der Schule. Es analysiert die unterschiedlichen Positionen und identifiziert mögliche Konfliktlinien. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit den rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten des Themas.
3. Verhältnis zwischen Staat und Religion: Dieses Kapitel analysiert unterschiedliche Modelle des Verhältnisses zwischen Staat und Religion in Europa, wobei die Schwerpunkte auf strikter Trennung, Staatskirchentum und Kooperationssystemen liegen. Es untersucht die verschiedenen Ausprägungen des Neutralitätsprinzips in Staaten mit Kooperationssystemen und beleuchtet das Verhältnis von Staat und Religion in Österreich im Detail. Die Darstellung verschiedener Modelle dient als Grundlage für das Verständnis der rechtlichen Herausforderungen, die mit der Präsenz religiöser Symbole in der Schule verbunden sind.
4. Grundrechte: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundrechten in Österreich, insbesondere mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Es analysiert die historische Entwicklung, die Bindungswirkung der Grundrechte und deren Ausprägungen im religionsrechtlichen Kontext. Der Fokus liegt auf der positiven und negativen Religionsfreiheit und deren Relevanz für den Umgang mit religiösen Symbolen im Bildungsbereich. Die Darstellung von Grundrechten bildet die Rechtsgrundlage für die weiteren Analysen der Arbeit.
5. Symbole: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem religionswissenschaftlichen Symbolbegriff und den Merkmalen von Symbolen nach Paul Tillich. Es legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der Bedeutung von Kreuz und Kopftuch als religiöse Symbole im Kontext des Schulalltags. Die Kapitel dient der Erläuterung der Komplexität der Symbolik und ihrer Bedeutung in der gesellschaftlichen Interaktion.
6. Das Kreuz im Klassenzimmer: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die Bedeutung des Kreuzsymbols im Allgemeinen und im spezifischen Kontext der Schule. Es untersucht die verschiedenen Interpretationen des Kreuzes – als reines Glaubenssymbol, kulturelles Symbol oder christlich-kulturelles Symbol – und beleuchtet die damit verbundenen kontroversen Diskussionen. Der Kapitel analysiert die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere den Kruzifix-Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts, und vergleicht die deutsche und österreichische Rechtslage im Hinblick auf Schulkreuze. Die Diskussion der verschiedenen rechtlichen und gesellschaftlichen Positionen bietet einen umfassenden Überblick über den komplexen Schulkreuz-Streit.
7. Das Kopftuch der muslimischen Lehrerin: Analog zum Kapitel über das Kreuz, analysiert dieses Kapitel das Kopftuch als religiöses Symbol. Es beleuchtet die verschiedenen Bedeutungen des Kopftuchs im Islam und geht auf die damit verbundenen gesellschaftlichen Debatten ein. Das Kapitel setzt sich mit der Rechtsprechung in Deutschland und Österreich im Zusammenhang mit dem Kopftuch auseinander und erörtert die zentralen Aspekte der Auseinandersetzung um das Kopftuch, insbesondere im Hinblick auf die Glaubensfreiheit und die staatliche Neutralität.
8. Schulkreuze und das Kopftuch der muslimischen Lehrerin im systematischen Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht systematisch die beiden Symbole, das Kreuz und das Kopftuch, hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Kontext des österreichischen Schulsystems. Es analysiert die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen und beleuchtet die implizierten Spannungsfelder zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität. Die vergleichende Analyse ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit den komplexen Herausforderungen der religiösen Diversität im Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Religionsfreiheit, Staatliche Neutralität, Schulkreuz, Kopftuch, Symbol, Integration, Grundrechte, Österreich, Deutschland, Religionsrecht, Kulturelle Identität, Meinungsstudie, Verfassungsgerichtshof.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Religiöse Symbole im österreichischen Schulsystem
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Spannungsfelder religiöser Symbole, insbesondere des Kreuzes und des Kopftuchs, im österreichischen Schulsystem. Sie analysiert die damit verbundenen rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse der rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit der Präsenz von Kreuz und Kopftuch in der Schule verbunden sind. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die symbolische Bedeutung der Objekte, das Neutralitätsprinzip des Staates und der Konflikt zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Religionsfreiheit in Österreich und Europa, die symbolische Bedeutung von Kreuz und Kopftuch, das Neutralitätsprinzip des Staates im Bildungssystem, den Konflikt zwischen Religionsfreiheit und staatlicher Neutralität sowie die Integration und gesellschaftliche Akzeptanz religiöser Diversität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) führt in die Thematik ein. Kapitel 2 (Meinungsstudie) präsentiert Ergebnisse einer Meinungsstudie zu den Einstellungen verschiedener Akteure. Kapitel 3 (Verhältnis Staat und Religion) analysiert verschiedene Modelle des Verhältnisses von Staat und Religion in Europa. Kapitel 4 (Grundrechte) befasst sich mit den Grundrechten in Österreich, insbesondere der Religionsfreiheit. Kapitel 5 (Symbole) erörtert den religionswissenschaftlichen Symbolbegriff. Kapitel 6 (Das Kreuz im Klassenzimmer) analysiert die Bedeutung des Kreuzes und die Rechtslage. Kapitel 7 (Das Kopftuch der muslimischen Lehrerin) behandelt die Bedeutung und die Rechtslage zum Kopftuch. Kapitel 8 (Systematischer Vergleich) vergleicht Kreuz und Kopftuch. Kapitel 9 (Resümee) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rechtsprechungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die relevante Rechtsprechung, insbesondere den Kruzifix-Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts und die österreichische Rechtslage bezüglich Schulkreuze und Kopftuch.
Welche Meinungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Meinungen verschiedener Akteure (Schüler, Lehrer, Eltern) anhand der Ergebnisse einer eigens durchgeführten Meinungsstudie.
Welche Modelle des Verhältnisses zwischen Staat und Religion werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Modelle der strikten Trennung, des Staatskirchentums und der Kooperationssysteme zwischen Staat und Religion.
Wie wird das Neutralitätsprinzip des Staates behandelt?
Die Arbeit untersucht das Neutralitätsprinzip des Staates im Bildungssystem und dessen Konfliktpotential mit der Religionsfreiheit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Religionsfreiheit, Staatliche Neutralität, Schulkreuz, Kopftuch, Symbol, Integration, Grundrechte, Österreich, Deutschland, Religionsrecht, Kulturelle Identität, Meinungsstudie, Verfassungsgerichtshof.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Detaillierte Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel finden sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Diplomarbeit.
- Quote paper
- Mag. iur. Anne Mayer (Author), 2009, Kreuz und Kopftuch im Klassenzimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/131850