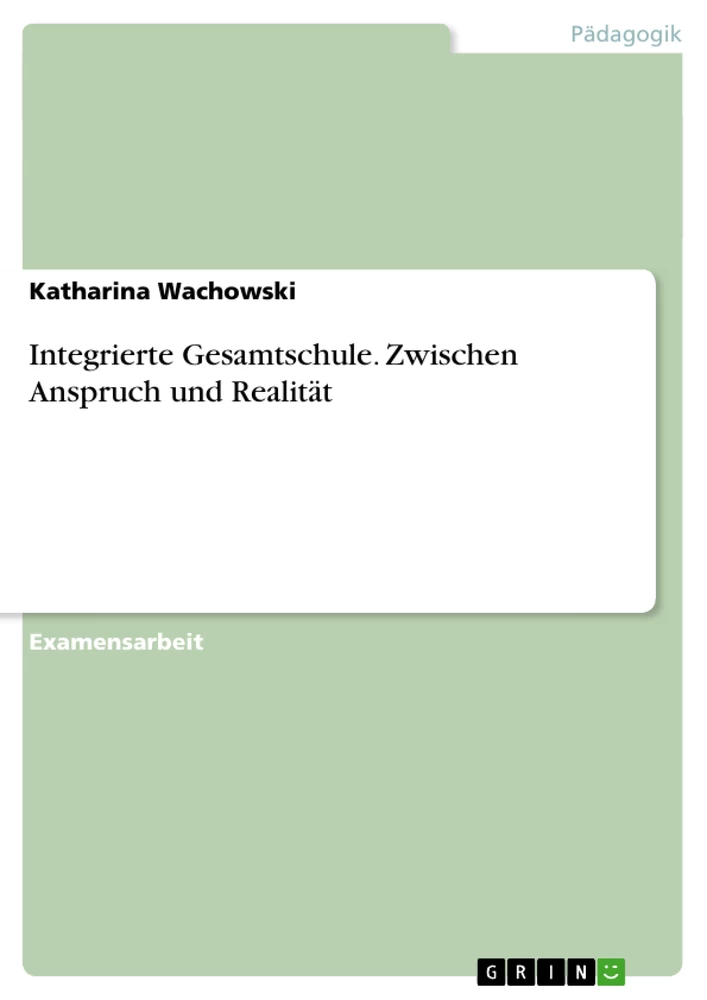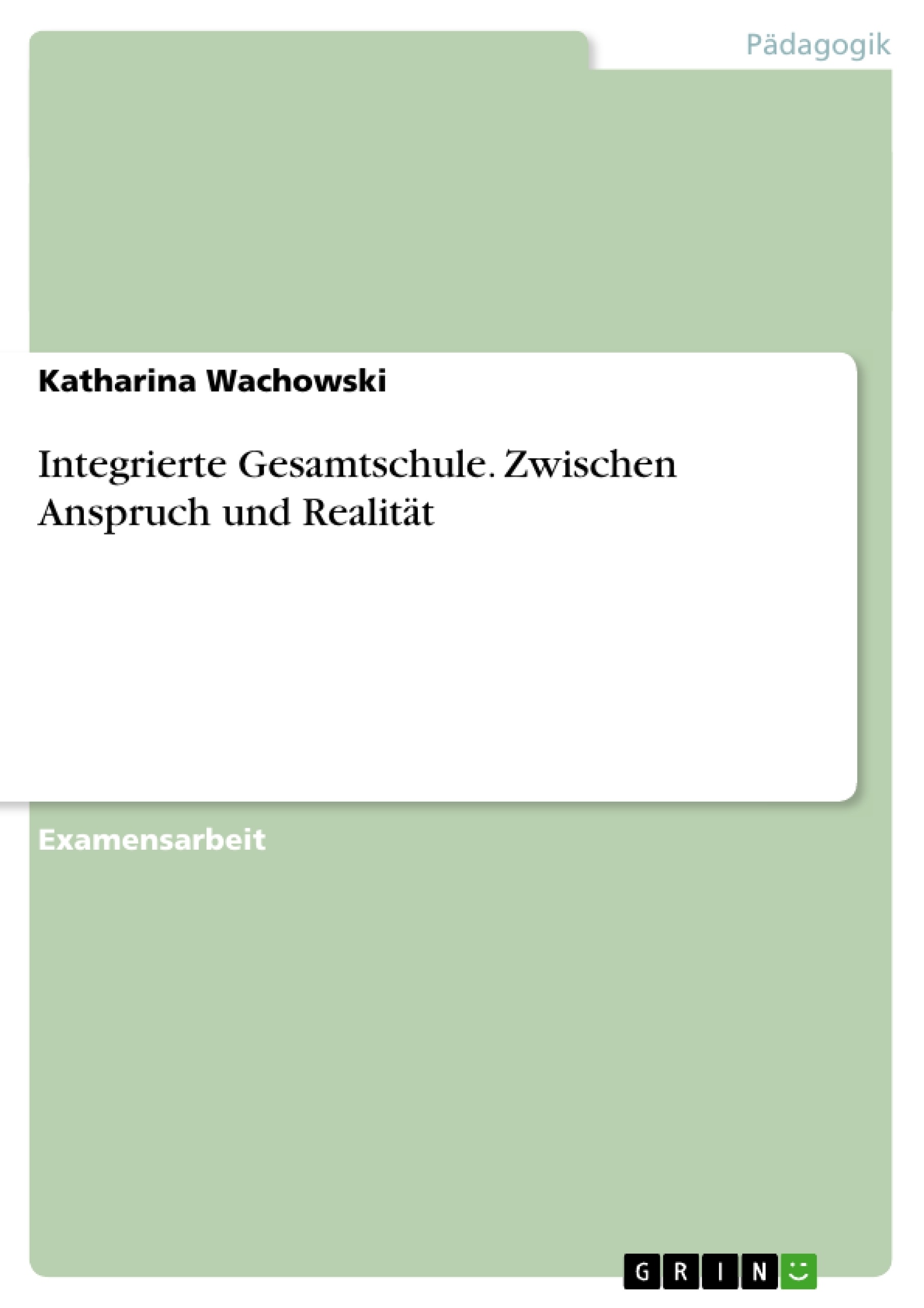Gib es wirklich eine Durchlässigkeit und Chancengleichheit im gegliederten Schulsystem?
Auf Grund dieser und anderer Fragen wurde seit vielen Jahren immer wieder die Einführung einer Gemeinschaftsschule gefordert, in der alle Kinder gemeinsam lernen können, egal welchen Standes sie sind. Jeder sollte individuell gefördert werden.
Im Jahr 1968 kam es schließlich zur Gründung der ersten Gesamtschulen. Doch schon mit dem Zeitpunkt der Gründung startete eine Bildungsdiskussion von immensem Ausmaß, die bis heute anhält. Es wurden zahlreiche Stimmen laut, die einer radikalen Umstellung des Schulsystems sehr skeptisch gegenüberstanden.
Nun stellt sich die Frage, ob die Kritik an der Gesamtschule – damals wie heute – berechtigt war und ist.
Ist das Konzept der Gesamtschule nicht annehmbar? Ist vielleicht die Umsetzung des Konzeptes fehlerhaft? Oder entsteht die Kritik allein aus Vorurteilen gegenüber einer komplett anderen Schulform?
Aufgrund der aktuellen Umstrukturierung des Schulsystems, beispielsweise in Schleswig-Holstein, soll in dieser Arbeit dargestellt werden, wie sich der Gesamtschulgedanke durch die deutsche Geschichte bis heute gehalten und entwickelt hat und wie er heute und in Zukunft umgesetzt werden soll.
Dazu soll zunächst einmal die Geschichte der Gesamtschule bis heute und dann die Entstehung der Grundidee aufgezeigt werden, um zu verdeutlichen, wie lange es diese schon gibt. Im Anschluss daran werden die Ziele und das Konzept der Gesamtschule ausführlich dargestellt, um zu überprüfen, welche Ansprüche die Gesamtschule an sich selbst stellt. Daraufhin soll anhand von Beispielen erörtert werden, wie das theoretische Konzept an einzelnen Schulen umgesetzt wird. So soll aufgezeigt werden, ob die Gesamtschule ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden kann.
Man wird nicht umhinkommen, bei einer Arbeit über den Anspruch und die Praxis der Gesamtschule einen Vergleich zwischen dem traditionellen Schulsystem und der Gesamtschule anzustellen. Dieser wird anhand von empirischen Untersuchungsergebnissen durchgeführt. In diesem Kapitel wird geklärt, welcher Anspruch von außen an die Gesamtschule gestellt wird und ob die Befürchtungen der Kritiker berechtigt sind oder eben nicht.
Anschließend soll die Zukunftschance der Gesamtschule erörtert und als mögliche Alternative zur Gesamtschule die Gemeinschaftsschule vorgestellt werden.
In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Gesamtschule
- 2.1 Begründung der Gesamtschulkonzeption
- 2.2 Von der Grundidee der Gesamtschule bis zum Gesamtschulsystem der Gegenwart
- 2.2.1 Der Schulgedanke Comenius'
- 2.2.2 Schule zur Zeit der Französischen Revolution
- 2.2.3 Humboldt (1767 - 1835) und Süvern (1775 - 1829)
- 2.2.4 Sozialdemokratie und Einheitsschule (1911)
- 2.2.5 Das Mannheimer Schulsystem (Sickinger, 1858-1930)
- 2.2.6 Die Zeit der Weimarer Republik
- 2.2.7 Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2.8 Die 60er und die Jahre danach - Zeit der ersten Gesamtschulen und der ersten Probleme
- 2.3 Gesamtschule in der Gegenwart - schultheoretische Betrachtungen
- 2.3.1 Schulsystem der Gegenwart
- 2.3.2 PISA und LAU – Ergebnisse und Konsequenzen
- 2.3.2.1 Ergebnisse der Studien - Feststellung des "Istzustands"
- 2.3.2.2 Konsequenzen, um den "Sollzustand" zu erreichen
- 2.3.3 Kurze Vorstellung von Gesamtschulmodellen
- 2.3.3.1 Struktur der integrierten Gesamtschule
- 2.3.3.2 Struktur der kooperativen Gesamtschule
- 2.3.3.3 Grundkonstruktionen der integrierten Gesamtschule und der kooperativen Gesamtschule im Überblick
- 3. Integrierte Gesamtschule – Konzept und Umsetzung
- 3.1 Zielvorstellungen der Integrierten Gesamtschule
- 3.2 Das Konzept der integrierten Gesamtschule
- 3.2.1 Zwischenmenschliche Kultur und demokratische Teilhabe
- 3.2.1.1 Identität
- 3.2.1.2 Kommunikative Didaktik
- 3.2.1.3 Beziehungsdidaktik
- 3.2.1.4 Konfliktdidaktik
- 3.2.1.5 Demokratie an der Schule
- 3.2.2 Curriculare Strukturen
- 3.2.3 Pädagogik der Heterogenität (Möglichkeiten der Differenzierung)
- 3.2.4 Methodenvielfalt
- 3.2.5 Qualitätssteigerung
- 3.3 Praktische Umsetzung des Konzeptes IGS
- 3.3.1 Wilhelm-Leuschner-Schule, Wiesbaden
- 3.3.2 Integrierte Gesamtschule Halle/Saale
- 3.3.3 Die Geschwister-Prenski-Schule - Integrierte Gesamtschule Lübeck
- 3.4 Bilanz - wird die Gesamtschule ihrem Anspruch gerecht?
- 4. Gesamtschule im Vergleich
- 4.1 Kritik an dem System Gesamtschule
- 4.1.1 Historische Kritik an der Gesamtschule
- 4.1.2 Systematische und vergleichende Kritik an der Gesamtschule
- 4.1.2.1 Die IGS als Mammutschule
- 4.1.2.2 Die fortschreitende Auflösung der Klassengemeinschaft
- 4.1.2.3 Die Kritik an den Leistungen in der Gesamtschule
- 4.2 Vergleich: Gegliedertes Schulsystem - Integrierte Gesamtschule
- 4.2.1 Methoden empirischer Forschung
- 4.2.1.1 Was wird gemessen?
- 4.2.1.2 Problematik der empirischen Forschung
- 4.2.1.3 Grenzen des Messbaren und daraus folgende Konsequenzen
- 4.2.2 Ergebnisse der empirischen Forschung
- 4.2.2.1 Unterschiede zwischen traditionellem Schulsystem und der IGS
- 4.2.2.2 Bilanz der Untersuchungen: Welches Schulsystem ist das bessere?
- 4.2.3 Kriterien für eine gute Schule
- 4.3 Bilanz des Vergleichs Gesamtschule - Gegliedertes Schulsystem
- 5. Konsequenzen für die IGS und das Schulsystem selbst
- 5.1 Hat die IGS eine Zukunft?
- 5.1.1 Chancen der IGS
- 5.1.2 Warum wird die Gesamtschule nicht Regelschule?
- 5.1.3 Alternative zur IGS: Chancen der kooperativen Gesamtschule
- 5.1.4 Was muss sich am Konzept und der Praxis der IGS ändern?
- 5.1.5 Was könnte sich bei den Ansichten der Kritiker ändern?
- 5.2 Sinnvolle Alternative zur IGS → Die Gemeinschaftsschule?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung und den aktuellen Stand der Gesamtschule in Deutschland. Ziel ist es, die Geschichte des Gesamtschulgedankens nachzuzeichnen, das Konzept der integrierten Gesamtschule zu analysieren und diese mit gegliederten Schulsystemen zu vergleichen. Dabei wird auch die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Gesamtschule beleuchtet.
- Entwicklung des Gesamtschulgedankens in der deutschen Geschichte
- Konzept und Umsetzung der integrierten Gesamtschule
- Vergleich zwischen Gesamtschule und gegliedertem Schulsystem
- Kritik an der Gesamtschule und mögliche Verbesserungen
- Zukunftsperspektiven der Gesamtschule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Berechtigung der Kritik an der Gesamtschule in den Mittelpunkt. Ausgehend von einer Aussage von Karl Lauterbach über die Ungerechtigkeit und Ineffizienz des dreigliedrigen Schulsystems, wird die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung des Gesamtschulkonzepts begründet. Die Arbeit zielt darauf ab, die historische Entwicklung des Gesamtschulgedankens darzustellen und seine heutige Umsetzung zu analysieren, um die Zukunftsfähigkeit des Modells zu beurteilen.
2. Geschichte der Gesamtschule: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Gesamtschulgedankens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Es werden verschiedene historische Konzepte und Schulreformen beschrieben, die den Grundstein für die heutige Gesamtschule gelegt haben. Dabei werden die Einflüsse von Persönlichkeiten wie Comenius und Humboldt sowie die sozialen und politischen Kontexte hervorgehoben, die die Entwicklung des Gesamtschulgedankens beeinflusst haben. Die Kapitel erläutern zudem die Herausforderungen, die sich im Laufe der Geschichte gestellt haben und analysieren die Entwicklung verschiedener Gesamtschulmodelle. Besonderes Augenmerk wird auf die Auswirkungen von Studien wie PISA gelegt und wie diese die Debatte um die Gesamtschule beeinflusst haben.
3. Integrierte Gesamtschule – Konzept und Umsetzung: Kapitel 3 fokussiert auf das Konzept und die praktische Umsetzung der integrierten Gesamtschule (IGS). Es beschreibt detailliert die Zielvorstellungen der IGS, die pädagogischen Grundlagen (Kommunikative Didaktik, Beziehungsdidaktik, Konfliktdidaktik) und die curricularen Strukturen. Die Kapitel analysiert verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung und Methodenvielfalt um der Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden. Abschließend werden exemplarische Beispiele für die praktische Umsetzung an verschiedenen Schulen vorgestellt und eine erste Bilanz gezogen, ob die IGS ihrem Anspruch gerecht wird.
4. Gesamtschule im Vergleich: Dieses Kapitel widmet sich einem Vergleich der Gesamtschule mit dem gegliederten Schulsystem. Es werden verschiedene kritische Punkte der Gesamtschule beleuchtet, sowohl historische als auch systematische Kritikpunkte. Der Vergleich basiert auf empirischen Forschungsmethoden und analysiert die Ergebnisse verschiedener Studien, um die Vor- und Nachteile beider Schulsysteme abzuwägen. Schließlich werden Kriterien für eine gute Schule definiert und im Lichte dieser Kriterien, die beiden Schulsysteme erneut gegenübergestellt.
5. Konsequenzen für die IGS und das Schulsystem selbst: Kapitel 5 befasst sich mit den Konsequenzen, die sich aus der Analyse der vorherigen Kapitel ergeben. Es diskutiert die Zukunftsfähigkeit der IGS, beleuchtet Chancen und Herausforderungen und untersucht mögliche Alternativen wie die Gemeinschaftsschule. Es werden konkrete Vorschläge für Verbesserungen des Konzepts und der Praxis der IGS gemacht und mögliche Veränderungen in der Wahrnehmung der Kritiker erörtert.
Schlüsselwörter
Integrierte Gesamtschule, gegliedertes Schulsystem, Chancengleichheit, Inklusion, Heterogenität, PISA, empirische Forschung, Schulreformen, Bildungsdiskussion, Gemeinschaftsschule, demokratische Teilhabe, Kommunikative Didaktik, Beziehungsdidaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Gesamtschule - Konzept, Umsetzung und Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung und den aktuellen Stand der Gesamtschule in Deutschland. Sie beleuchtet die Geschichte des Gesamtschulgedankens, analysiert das Konzept der integrierten Gesamtschule (IGS) und vergleicht sie mit gegliederten Schulsystemen. Ein zentrales Thema ist die Zukunftsfähigkeit der Gesamtschule.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des Gesamtschulgedankens, das Konzept und die praktische Umsetzung der IGS (inklusive pädagogischer Grundlagen wie kommunikative und Beziehungsdidaktik), einen Vergleich zwischen Gesamtschule und gegliedertem Schulsystem (unter Einbezug empirischer Forschung und Kritikpunkte), sowie die Zukunftsperspektiven der Gesamtschule und möglicher Alternativen wie der Gemeinschaftsschule.
Welche historischen Entwicklungen werden dargestellt?
Die Hausarbeit zeichnet die Geschichte des Gesamtschulgedankens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart nach. Sie betrachtet Einflüsse von Persönlichkeiten wie Comenius und Humboldt, die sozialen und politischen Kontexte der Entwicklung und die Herausforderungen, die sich im Laufe der Geschichte gestellt haben. Die Auswirkungen von Studien wie PISA auf die Gesamtschuldebatte werden ebenfalls analysiert.
Wie wird das Konzept der integrierten Gesamtschule (IGS) beschrieben?
Das Kapitel zur IGS beschreibt detailliert deren Zielvorstellungen, pädagogische Grundlagen (Kommunikative Didaktik, Beziehungsdidaktik, Konfliktdidaktik), curriculare Strukturen, Möglichkeiten der Differenzierung und Methodenvielfalt. Es werden auch Beispiele für die praktische Umsetzung an verschiedenen Schulen vorgestellt.
Wie wird die IGS mit gegliederten Schulsystemen verglichen?
Der Vergleich zwischen IGS und gegliederten Schulsystemen basiert auf empirischen Forschungsmethoden. Die Arbeit beleuchtet sowohl historische als auch systematische Kritikpunkte an der Gesamtschule und analysiert die Ergebnisse verschiedener Studien, um Vor- und Nachteile beider Schulsysteme abzuwägen. Kriterien für eine gute Schule werden definiert und zur Beurteilung beider Systeme herangezogen.
Welche Kritikpunkte an der Gesamtschule werden behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet verschiedene Kritikpunkte an der Gesamtschule, sowohl historische als auch systematische. Dazu gehören beispielsweise Kritik an der Größe der Schulen ("Mammutschule"), die Auflösung der Klassengemeinschaft und die Leistungen der Schüler im Vergleich zu gegliederten Systemen.
Welche Zukunftsperspektiven für die Gesamtschule werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Zukunftsfähigkeit der IGS, beleuchtet Chancen und Herausforderungen und untersucht mögliche Alternativen wie die Gemeinschaftsschule. Konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Konzepts und der Praxis der IGS werden gemacht, und mögliche Veränderungen in der Wahrnehmung der Kritiker werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Integrierte Gesamtschule, gegliedertes Schulsystem, Chancengleichheit, Inklusion, Heterogenität, PISA, empirische Forschung, Schulreformen, Bildungsdiskussion, Gemeinschaftsschule, demokratische Teilhabe, Kommunikative Didaktik, Beziehungsdidaktik.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Hausarbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Geschichte der Gesamtschule, IGS - Konzept und Umsetzung, Gesamtschule im Vergleich, Konsequenzen für die IGS und das Schulsystem, Fazit).
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das ausführliche Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und gliedert die Hausarbeit in Kapitel und Unterkapitel.
- Arbeit zitieren
- Katharina Wachowski (Autor:in), 2007, Integrierte Gesamtschule. Zwischen Anspruch und Realität, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/130512