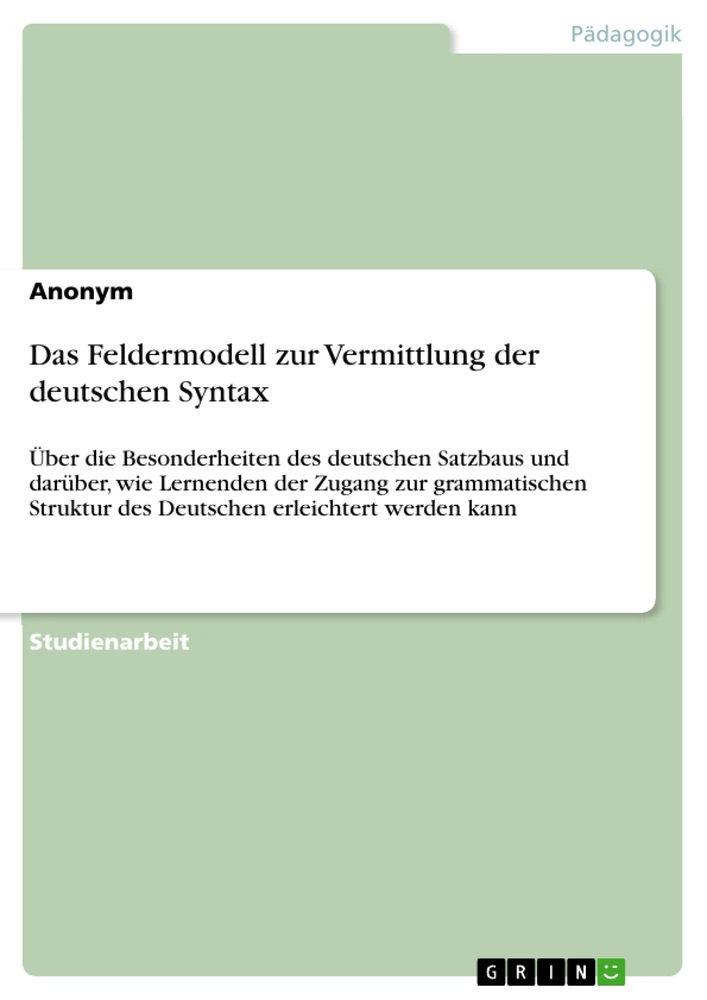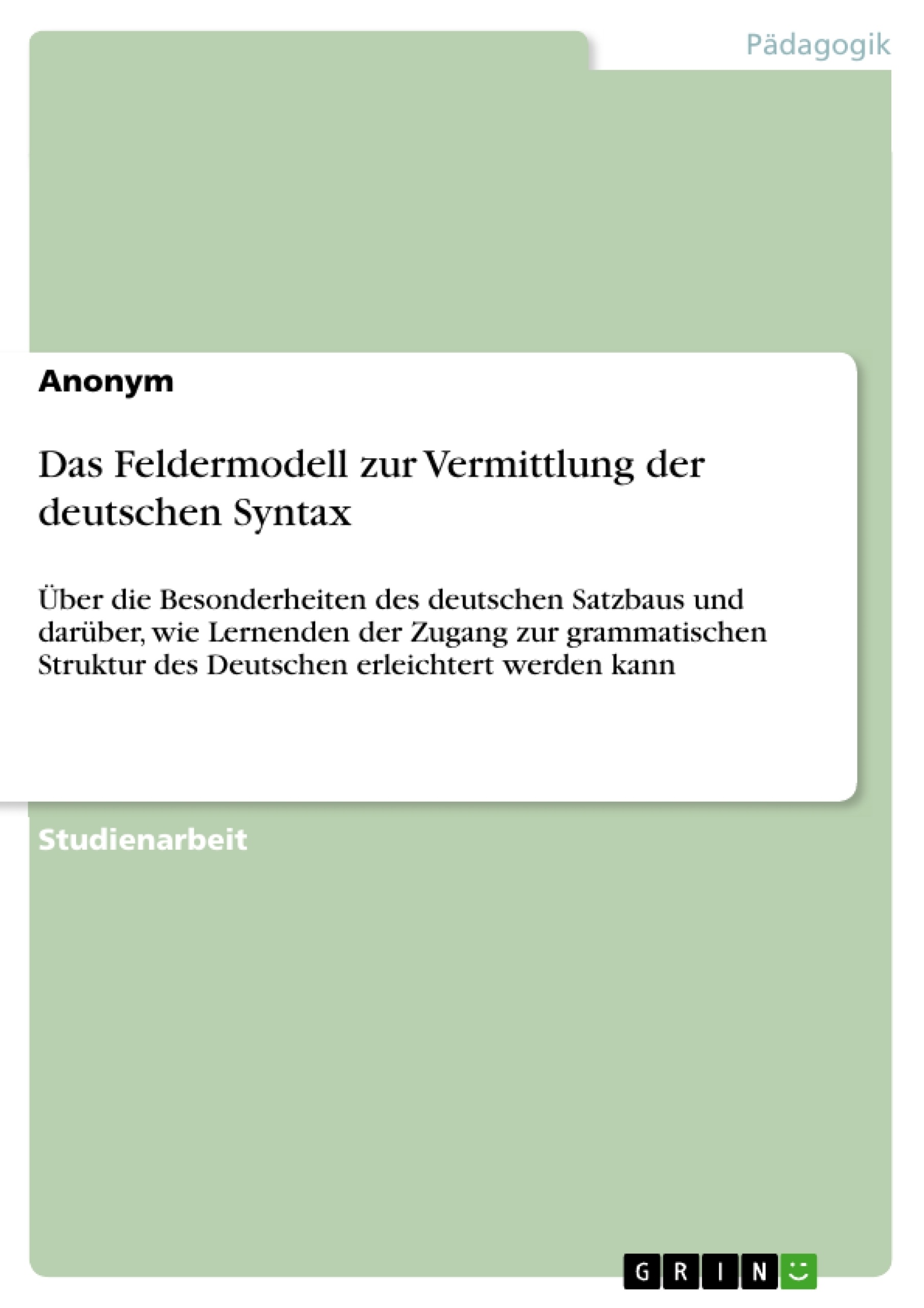Vor allem unter Anbetracht der zunehmenden Heterogenität in den deutschen Klassenzimmern will sich diese Hausarbeit mit den Spezifitäten der deutschen Syntax befassen. Zentrales Ziel ist es, besagte Eigenarten aufzudecken und ein geeignetes didaktisches Werkzeug zu finden, durch welches der Verwirrung Einhalt geboten werden kann. Als wissenschaftliche Grundlage dient das topologische Modell nach Erich Drach (1937). Es wurde als grammatisches Spezialmodell des Deutschen explizit dafür entwickelt, um die Stellungsbesonderheiten des deutschen Satzbaus herauszustellen. Das, sowie die Tatsache, dass sich dieser Ansatz inzwischen über den Fremdsprachenunterricht hinaus auch im Grammatikunterricht hat etablieren können, macht es zum zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Seminararbeit.
Im Folgenden sollen die Grundlagen des deskriptiven Grammatikmodells aus fachwissenschaftlicher Perspektive erläutert werden. Dafür werden zunächst sprachtypologische Parameter des Deutschen herangezogen werden und das Verb als zentrales Element des Satzes identifiziert. Es folgt eine Klassifikation der verschiedenen Satzstellungstypen des Deutschen, woraufhin die primären Stellungfelder des Feldermodells erläutert werden, mit welchen auch im Grammatikunterricht gearbeitet wird. Der inhaltlich zweite Teil birgt didaktische Überlegungen zum Gegenstand. Zu Beginn sollen die Vorzüge des Modells hinsichtlich seines Einsatzes in der unterrichtlichen Praxis skizziert werden. Daraufhin wird ein Blick in das verbindliche Kerncurriculum (KC) Aufschluss darüber liefern, welchen Beitrag es im Rahmen der Kompetenzentwicklung von Schüler:innen im Fach Deutsch leisten kann. Es folgt Input über didaktische Reduktion des Gegenstandes bei seiner Implementierung in der Orientierungsstufe. In Rahmen der Schulbuchanalyse werden schließlich zwei ausgewählte Lehrwerke der 5. Jahrgangsstufe unter Referenz auf das Feldermodell untersucht werden. Das Fazit beinhaltet eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie eine abschließende Bewertung des Feldermodells hinsichtlich seines Nutzens für einen nachhaltigen Grammatikunterricht. Die zugrundeliegende Literatur lässt sich im Literaturverzeichnis nachvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Felderlehre
- 2.1. Satzstellungstypen des Deutschen
- 2.1.1. Der Verbzweitsatz (V2)
- 2.1.2. Der Verberstsatz (V1)
- 2.1.3. Der Verbletztsatz (VL)
- 2.2. Das allgemeine Grundmuster des Feldermodells
- 2.2.1. Die Satzklammer
- 2.2.2. Das Vorfeld
- 2.2.3. Das Mittelfeld
- 2.2.4. Das Nachfeld
- 3. Eine fachdidaktische Betrachtung des Gegenstandes
- 3.1. Vorzüge des Feldermodells
- 3.2. Sprache (im Ansatz) als Ordnung und System verstehen lernen
- 3.3. Reduktionen in der unterrichtlichen Vermittlung
- 4. Lehrwerkanalyse
- 4.1. D. Eins (2017)
- 4.2. Deutschbuch Gymnasium 5 (2019)
- 4.3. Resümee der Lehrwerkanalyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Spezifitäten der deutschen Syntax, insbesondere die Herausforderungen, die der deutsche Satzbau für Nicht-Muttersprachler darstellt. Ziel ist es, die Eigenarten des deutschen Satzbaus aufzudecken und ein geeignetes didaktisches Werkzeug, das Feldermodell, vorzustellen und zu evaluieren, um das Verständnis des Satzbaus zu verbessern.
- Das Feldermodell als didaktisches Werkzeug zur Erklärung des deutschen Satzbaus
- Analyse der Satzstellungstypen im Deutschen (V1, V2, VL)
- Die Struktur und Funktion der Satzklammer und weiterer Satzfelder
- Didaktische Implikationen und Reduktionen des Feldermodells für den Unterricht
- Anwendung des Feldermodells in der Analyse von Schulbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des deutschen Satzbaus und seiner Herausforderungen für Nicht-Muttersprachler ein. Sie benennt Mark Twain als Beispiel für die Schwierigkeiten, die die deutsche Satzstellung verursachen kann. Das zentrale Ziel der Arbeit wird formuliert: die Aufdeckung der Eigenarten des deutschen Satzbaus und die Präsentation eines geeigneten didaktischen Werkzeugs – das Feldermodell – zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die wissenschaftliche Grundlage, das topologische Modell nach Erich Drach, wird eingeführt und seine Relevanz für den Grammatikunterricht begründet.
2. Grundlagen der Felderlehre: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen des Feldermodells. Es beginnt mit dem Verb als zentralem Element des Satzes und dessen Valenz und Rektion. Die besondere, oft zweigeteilte Struktur des Verbs im Deutschen und die resultierende Satzklammer werden hervorgehoben, wobei die Herausforderungen für Nicht-Muttersprachler nochmals betont werden. Die Flexibilität der deutschen Wortstellung aufgrund des Flexionsreichtums wird ebenfalls diskutiert, sowie die enge Verbindung zwischen Satzstellung und Satzart.
2.1. Satzstellungstypen des Deutschen: Dieser Abschnitt klassifiziert die drei wichtigsten Satzstellungstypen des Deutschen: den Verbzweitsatz (V2), den Verberstsatz (V1) und den Verbletztsatz (VL). Jeder Satztyp wird anhand von Beispielen erläutert und seine typischen Satzarten und Eigenschaften (Hauptsatz/Nebensatz, Selbständigkeit) beschrieben. Die Klassifizierung orientiert sich an Kürschner, dem grammis-Portal und Imo.
2.2. Das allgemeine Grundmuster des Feldermodells: Hier wird das Feldermodell als Werkzeug zur Beschreibung der komplexen Wortstellung im Deutschen vorgestellt. Die fünf primären Stellungsfelder (Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer, Nachfeld) werden erklärt, mit Fokus auf die schriftsprachlichen Normen. Die Bedeutung der Satzklammer als Platzhalter für das (oft geteilte) Verb wird hervorgehoben. Die möglichen Besetzungen der Felder werden erläutert, inklusive der Differenzhypothese für Nebensätze.
3. Eine fachdidaktische Betrachtung des Gegenstandes: Dieses Kapitel widmet sich der didaktischen Relevanz des Feldermodells. Es werden die Vorteile des Modells für den Unterricht skizziert und der Beitrag zur Kompetenzentwicklung der Schüler*innen im Fach Deutsch diskutiert. Darüber hinaus werden didaktische Reduktionen des Modells für die unterrichtliche Implementierung betrachtet, um den Stoff für Schüler*innen leichter zugänglich zu machen.
4. Lehrwerkanalyse: Die Lehrwerkanalyse untersucht zwei ausgewählte Lehrwerke der 5. Jahrgangsstufe unter Bezugnahme auf das Feldermodell. Die Analyse bewertet, wie gut die Lehrwerke das Feldermodell im Unterricht umsetzen und ob sie die Herausforderungen des deutschen Satzbaus adäquat berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Feldermodell, Deutsche Syntax, Satzstellung, Verbzweitsatz (V2), Verberstsatz (V1), Verbletztsatz (VL), Satzklammer, Wortstellung, Didaktik, Grammatikunterricht, Schulbuch, Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Das Feldermodell im Grammatikunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Spezifitäten der deutschen Syntax und die Herausforderungen, die der deutsche Satzbau für Nicht-Muttersprachler darstellt. Sie präsentiert und evaluiert das Feldermodell als didaktisches Werkzeug zur Verbesserung des Satzbauverständnisses.
Welche Satzstellungstypen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die drei wichtigsten Satzstellungstypen des Deutschen: den Verbzweitsatz (V2), den Verberstsatz (V1) und den Verbletztsatz (VL). Jeder Satztyp wird anhand von Beispielen erläutert und seine Eigenschaften beschrieben.
Was ist das Feldermodell und wie wird es in der Arbeit verwendet?
Das Feldermodell ist ein didaktisches Werkzeug zur Beschreibung der komplexen Wortstellung im Deutschen. Die Arbeit erklärt die fünf primären Stellungsfelder (Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer, Nachfeld) und zeigt, wie es zur Analyse des deutschen Satzbaus eingesetzt werden kann.
Welche didaktischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Vorzüge des Feldermodells für den Grammatikunterricht und diskutiert didaktische Reduktionen, um den Stoff für Schüler*innen leichter zugänglich zu machen. Der Beitrag des Modells zur Kompetenzentwicklung der Schüler*innen wird ebenfalls erörtert.
Welche Lehrwerke werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert zwei ausgewählte Lehrwerke der 5. Jahrgangsstufe (D. Eins (2017) und Deutschbuch Gymnasium 5 (2019)) unter Bezugnahme auf das Feldermodell, um zu bewerten, wie gut die Lehrwerke das Feldermodell im Unterricht umsetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Feldermodell, Deutsche Syntax, Satzstellung, Verbzweitsatz (V2), Verberstsatz (V1), Verbletztsatz (VL), Satzklammer, Wortstellung, Didaktik, Grammatikunterricht, Schulbuch, Kompetenzentwicklung.
Welche wissenschaftliche Grundlage liegt der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit basiert auf dem topologischen Modell nach Erich Drach und begründet dessen Relevanz für den Grammatikunterricht.
Welche Herausforderungen des deutschen Satzbaus werden für Nicht-Muttersprachler hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die Herausforderungen der komplexen deutschen Satzstellung, insbesondere die Satzklammer und die verschiedenen Satzstellungstypen, für Nicht-Muttersprachler hervor. Mark Twain wird als Beispiel für die Schwierigkeiten genannt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen der Felderlehre (inkl. Satzstellungstypen und dem allgemeinen Grundmuster des Feldermodells), eine fachdidaktische Betrachtung, eine Lehrwerkanalyse und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Deutschlehrer*innen und alle, die sich für die Didaktik des deutschen Grammatikunterrichts und insbesondere für das Feldermodell interessieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Feldermodell zur Vermittlung der deutschen Syntax, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1304061