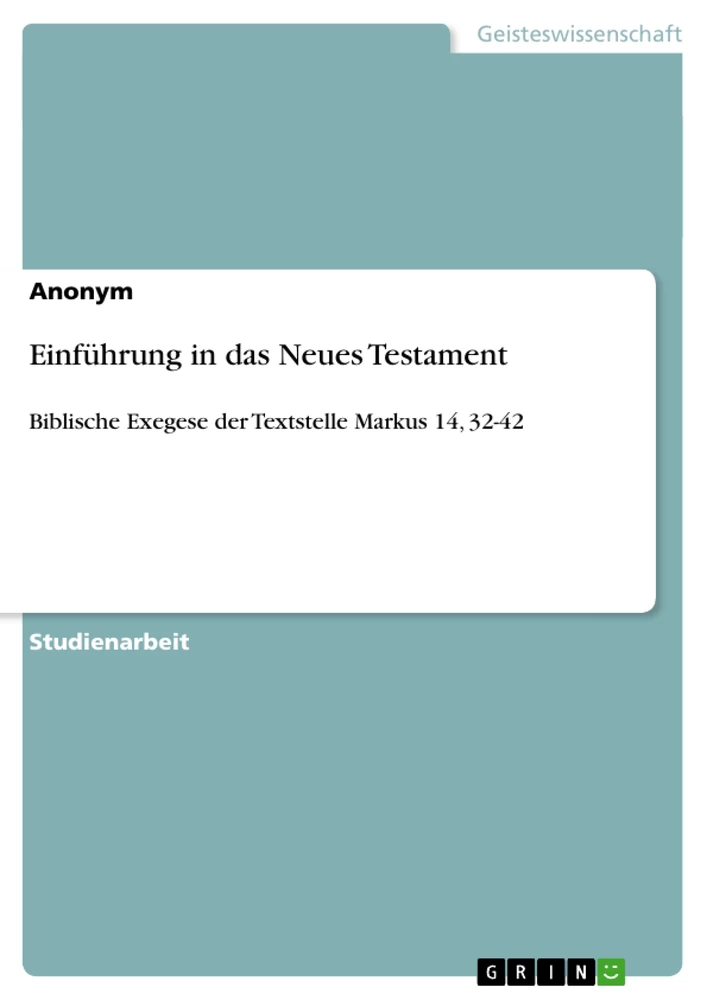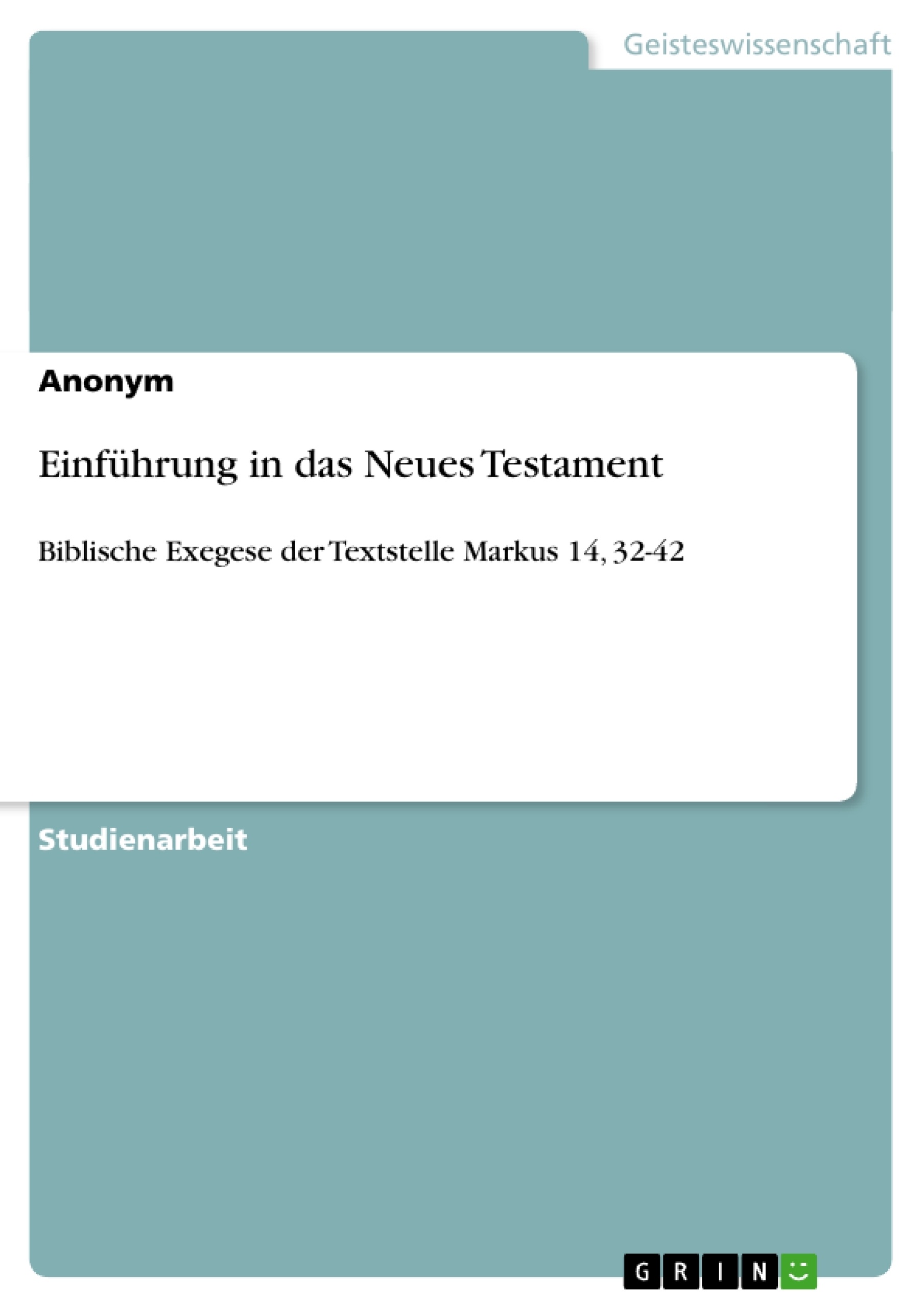Wie schreibt man eine Exegese über eine biblische Textstelle? Das wusste ich zu Anfang dieser Arbeit noch nicht so genau. Ebenfalls wusste ich nicht, wie interessant so etwas
eigentlich auch sein kann. Mit der Einarbeitung in die Erstellung einer Exegese hat mir die Arbeit daran immer mehr Spaß gemacht. Da ich den ein oder anderen Arbeitsschritt aufgrund
meines eigenen Interesses daran etwas ausführlicher bearbeitet habe, fallen andere dafür evtl.
etwas kürzer aus. Dies konnte ich aber nicht vermeiden, da das Geschriebene sonst den Rahmen dieser Seminararbeit gesprengt hätte. Im Inhaltsverzeichnis habe ich die einzelnen,
von mir behandelten Arbeitsschritte angegeben und aufgeführt, auf was ich besonders eingehen werde.
Ich habe die in dieser Exegese behandelte Textstelle mehrfach gelesen und anfangs einfach aufgeschrieben, was mir persönlich daran auffällt und zum Teil schon kleinere Interpretationsversuche gemacht. Als ich die Textstelle dann später noch mit den Markuskommentaren abgeglichen habe, fanden sich einige meiner eigenen Vermutungen und Bemerkungen zum Text dort ebenfalls wieder. Doch da ich den Text zuerst ohne Kommentierung durchgegangen bin, wollte ich auch meine eigenen Ideen in die Hausarbeit mit einbringen. Es ist aber durchaus möglich, dass diese so auch in der Fachliteratur
angegeben sind, da es zumeist ganz einfache, eindeutige Auffälligkeiten am Text sind.
Wenn keine Fußnote mit der Quelle angegeben ist, so bezieht sich das Geschriebene auf meine eigenen Ideen und Bemerkungen zum Text.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche Bemerkungen zum Text
- Textkritik
- Literarkritik
- In welchem Zusammenhang steht der Text in der Bibel?
- Sprachliche Besonderheiten des Textes
- Aufbau und Gliederung des Textes
- Redaktionskritik und Synoptischer Vergleich
- Vergleich der Textstelle in den drei Evangelien Mathäus, Markus und Lukas
- Welche Quellen hatten die Autoren vorliegen und wer hat von wem abgeschrieben?
- Traditionsgeschichte und Motivkritik
- Woher hatte Markus seine Informationen?
- Stark hervortretende Motive der Textstelle
- Form- und Gattungskritik
- Zu welcher Gattung gehört das Markusevangelium?
- Welches Ziel verfolgte Markus mit seinem Evangelium und an wen richtete er es?
- Welche Verwendung sah Markus für sein Evangelium vor?
- Literaturverzeichnis
- Bücher
- Zeitschriften
- Internetadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der biblischen Exegese der Textstelle Markus 14, 32-42. Ziel ist es, die Textstelle mithilfe verschiedener exegetischer Methoden zu analysieren und zu interpretieren. Dabei werden die literarische Struktur, die sprachlichen Besonderheiten, die historischen und kulturellen Hintergründe sowie die theologischen Aussagen des Textes beleuchtet.
- Die Darstellung der Menschlichkeit Jesu
- Die Bedeutung des Gebets in der Bibel
- Die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern
- Die Rolle des Leidens und Todes in der christlichen Theologie
- Die Bedeutung des Textes für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und erläutert die Vorgehensweise bei der Exegese der Textstelle. Im zweiten Kapitel werden persönliche Bemerkungen zum Text vorgestellt, die den Leser auf die Thematik einstimmen und die eigene Interpretation des Textes einleiten. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Textkritik, die den Text mit verschiedenen Bibelübersetzungen und einem Markuskommentar vergleicht und auf sprachliche Besonderheiten und Abweichungen eingeht. Das vierte Kapitel widmet sich der Literarkritik und untersucht den Zusammenhang des Textes in der Bibel, die sprachlichen Besonderheiten sowie den Aufbau und die Gliederung des Textes. Das fünfte Kapitel behandelt die Redaktionskritik und den synoptischen Vergleich, der die Textstelle mit den entsprechenden Stellen in den Evangelien von Matthäus und Lukas vergleicht und die Quellenlage sowie die Abhängigkeiten zwischen den Evangelien untersucht. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Traditionsgeschichte und Motivkritik, die die Entstehung des Textes und die darin enthaltenen Motive beleuchtet. Das siebte Kapitel widmet sich der Form- und Gattungskritik, die die Gattung des Markusevangeliums, die Zielgruppe und die Verwendung des Textes untersucht. Das Literaturverzeichnis listet die verwendeten Quellen auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die biblische Exegese, das Markusevangelium, die Textstelle Markus 14, 32-42, die Menschlichkeit Jesu, das Gebet, die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern, das Leiden und der Tod Jesu, die christliche Theologie und die Relevanz des Textes für die heutige Zeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Einführung in das Neues Testament, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/130125