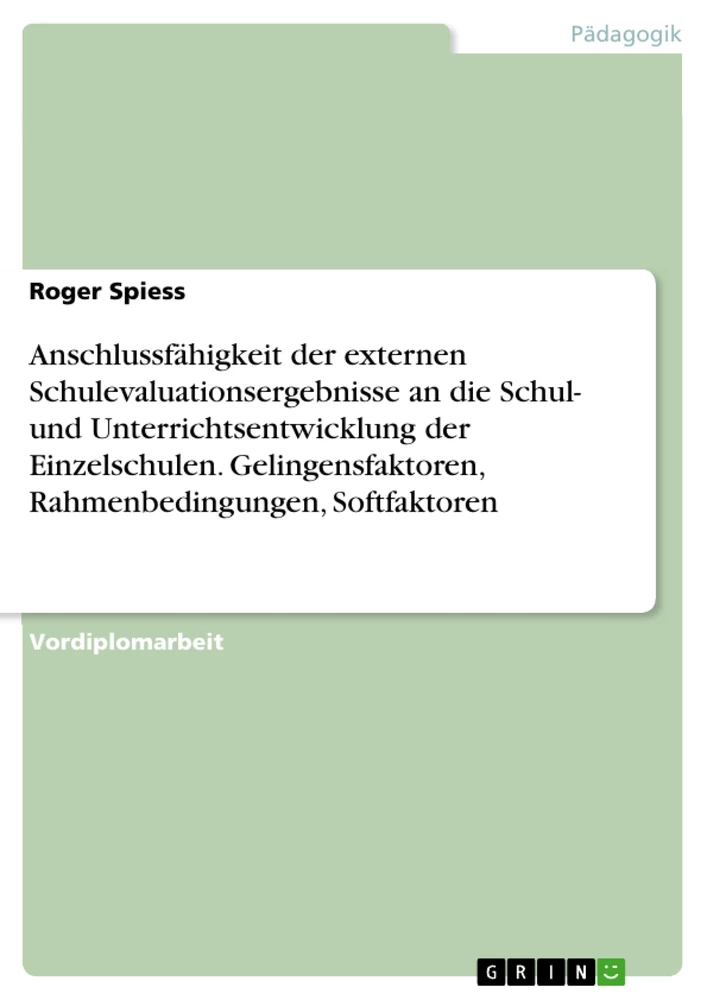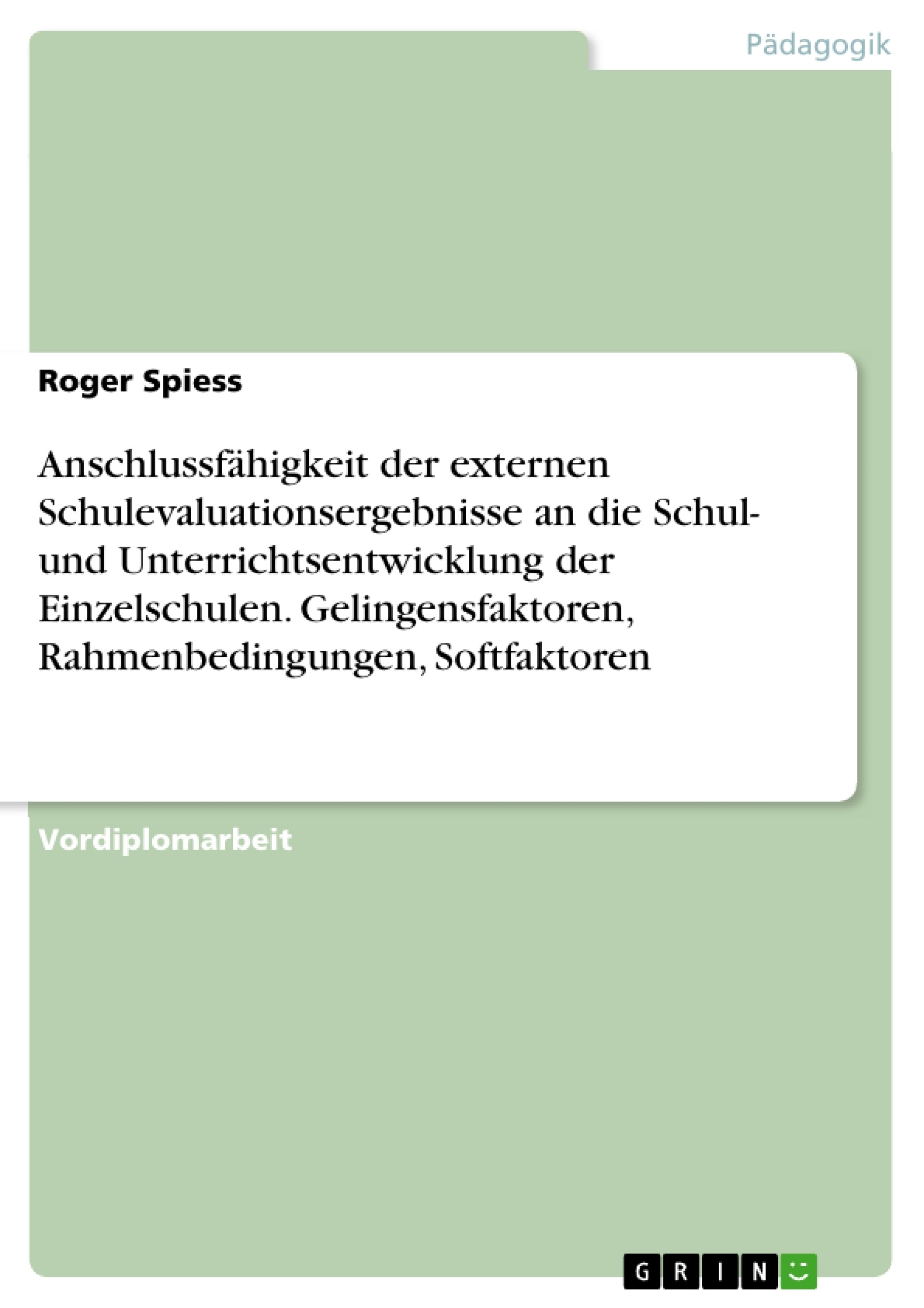In dieser Arbeit geht es um Gelingensfaktoren für eine datenbasierte Qualitätsentwicklung im Schulkontext sowie Rahmen- und Kontextfaktoren (Strategien, Inputqualität, Machtverständnis, Organisationslogik), welche begünstigend oder hemmend wirken. Zusätzlich spielen Softfaktoren, insbesondere in der Bewältigung der "Bruchstelle zur Aktion", eine nicht zu unterschätzende Rolle und werden hier ebenfalls kurz beleuchtet.
Es leiten entsprechend folgende Fragestellungen: Wie können die Deutungsprozesse der vorhandenen Daten gestaltet werden, damit erkennen, verstehen, gestalten und handeln möglich wird? Welche Rolle spielen die Führungsebenen und betroffenen Akteure in der Reflexion und Integration der Evaluationsergebnisse? Wie und wo kann ich als Evaluator der Volksschule aktiv die Anschlussfähigkeit der Evaluationsergebnisse an die Unterrichts- und Schulentwicklung der Einzelschule fördern? Gibt es unterstützende strukturelle und kulturelle Organisationselemente als Schlüssel für Entwicklungsrealisationen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen emotional-motivationalen Aspekten und einer nachhaltigen Implementation von Entwicklungsvorhaben (Bruchstelle zur Aktion überwinden)?
Vom Expertengutachten zur Innovationskraft
1 Problemaufriss, Leitfragen und Vorgehen
1.1 Erkenntnisinteresse, Problemfelder, Fragestellungen
1.2 Bezug zur Rolle als Evaluator und Berater
1.3 Vorgehensweise und Thesenerarbeitung
2 Erkenntnisse und Thesen anhand der Portfolioauszüge
2.1 Qualitätseinschätzung von schulischen Prozessen als Dialoggrundlage
2.1.1 Thesen I: Interpretationsräume schaffen; wirkungsorientiertes Handeln fördern
2.2 Entwicklung von Schulqualität als Zusammenspiel von Akteuren
2.2.1 Thesen II: Behörde als „Lernende Organisation“; gemeinsame Strategien
2.3 Wissenschaftliche Gelingensfaktoren zur Nutzung von Evaluationsdaten
2.3.1 Thesen III: Passung von Daten & Praxis herstellen; Routinen fokussieren
2.4 Organisationslogik als zentraler Schlüssel für Entwicklungsumsetzungen
2.4.1 Thesen IV: “Form Follows Function“; Freiräume & Autonomie ermöglichen
2.5 Nachhaltigkeit über individuellen Mehrwert und Sicherheit gewährleisten
2.5.1 Thesen V: Motivationale Aspekte, Widerstände und Emotionen einbeziehen
3 Sachliche und berufsbezogene Schlussfolgerungen zu allen Thesen
3.1 Verknüpfungen und Fazit bezüglich der Leitfrage
3.2 Berufliche Erkenntnisse und persönliche Lernprozesse
3.2.1 Rolle als Evaluationsfachperson
3.3 Kritische Reflexion, Grenzen der Arbeit, offene Fragen
4 Verweisangaben
4.1 Literatur
4.1.1 Sammelbände
4.1.2 Monografien
4.1.3 Artikel
4.1.4 Unterlagen aus Organisationen
4.1.5 Grafiken
4.1.6 Weiterführende, eigene wissenschaftliche Arbeiten
1 Problemaufriss, Leitfragen und Vorgehen
1.1 Erkenntnisinteresse, Problemfelder, Fragestellungen
Die datenbasierte Qualitätsentwicklung zieht sich im Lehrgang als roter Faden durch die diversen angeschnittenen Bereiche von Schulqualität. In meiner Tätigkeit im Rahmen der externen Schulevaluation erfassen und beschreiben wir mit grossem Aufwand und unter Berücksichtigung aller wesentlichen Anspruchsgruppen Daten, Fakten und Beobachtungen zur Qualität einer Einzelschule. Dieses Expert/innengutachten liefert wertvolle Daten, doch der Schritt zur Weiterentwicklung aufgrund der Informationen ist gross. Gemäss des in dieser Arbeit wesentlichen „Integrativen Rahmenmodells für evidenzorientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung“ (vgl. Abb. 1, Wiesner, 2018) umfasst dieser Datennutzungsschritt anspruchsvolle Phasen: Rezeptionsphase, Reflexions- und Proflexionsphase, Integrations- und Aktionsphase. Sogar bei gutem Willen und ehrlicher Absicht besteht in der Regel eine Bruchstelle zwischen der Erkenntnis sinnvoller Entwicklungsvorhaben und der Aktion (vgl. Helmke, 2014, 312ff). Im Titel verwende ich darum den Begriff der Innovationskraft als Zielvorstellung einer erfolgreichen Datennutzung, weil dieser nicht nur neue und kreative Entwicklungsideen beinhaltet, sondern auch deren erfolgreiche Umsetzung und Verwendung (vgl. Wikipedia, 2022).
Mich interessieren Gelingensfaktoren für eine datenbasierte Qualitätsentwicklung sowie Rahmen- und Kontextfaktoren (Strategien, Inputqualität, Machtverständnis, Organisationslogik), welche begünstigend oder hemmend wirken. Zusätzlich spielen Softfaktoren, insbesondere in der Bewältigung der „Bruchstelle zur Aktion“, eine nicht zu unterschätzende Rolle und sollen hier ebenfalls kurz beleuchtet werden. Es leiten mich entsprechend folgende Fragestellungen:
- Wie können die Deutungsprozesse der vorhandenen Daten gestaltet werden, damit erkennen, verstehen, gestalten und handeln möglich wird?
- Welche Rolle spielen die Führungsebenen und betroffenen Akteure in der Reflexion und Integration der Evaluationsergebnisse?
- Wie und wo kann ich als Evaluator der Volksschule aktiv die Anschlussfähigkeit der Evaluationsergebnisse an die Unterrichts- und Schulentwicklung der Einzelschule fördern?
- Gibt es unterstützende strukturelle und kulturelle Organisationselemente als Schlüssel für Entwicklungsrealisationen?
- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen emotional-motivationalen Aspekten und einer nachhaltigen Implementation von Entwicklungsvorhaben (Bruchstelle zur Aktion überwinden)?
Innerhalb dieser Zertifikatsarbeit besteht nicht der Anspruch auf eine fundiert wissenschaftliche und umfassende Beantwortung der obenstehenden Fragen, sondern ich beschreibe meine Lernwege- und -prozesse bzw. meinen Erkenntnisgewinn für die Berufspraxis - basierend auf theoretischen Modellen.
1.2 Bezug zur Rolle als Evaluator und Berater
Im Strategiepapier (vgl. FSB, 2019) der Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB) wird formuliert, dass die Stärkung der Entwicklungskompetenzen der Schulführung und die Unterstützung der Schulen als lernende Organisationen als eigentliche „Mission“ im Vordergrund stehen. Die Fachstelle engagiert sich als Kompetenzzentrum für Schul- und Unterrichtsqualität für eine 2 CAS SQA «Vom Expertengutachten zur Innovationskraft», Roger Spiess differenzierte Rückmeldung, wichtige Handlungsfelder und Anstösse zu ersten Umsetzungsschritten (S. 3-5). Wissenschaftlich führen Josacher-Rössler & Kemethofer (vgl. 2020, S. 344-345) charakterisierende „Typen“ von Schulinspektor/innen auf. In Bezug auf die FSB Strategie verstehe ich mich als „entrepreneurial Enabler“, welcher pädagogische Themen im Rahmen der Vorgaben mit Inhalt füllt und verständlich macht sowie eine Diskurskultur mit der Schulführung pflegt. Landwehr (vgl. 2015, S. 16) sieht die Aufgabe der Schulevaluation als Impulsgebende zu „einer Perspektivenerweiterung der eigenen Wirklichkeitswahrnehmung“ und „mehrperspektivischen Betrachtung des Unterrichts“. Die Nutzung der Daten einer externen Schulevaluation geschieht also üblicherweise nicht von selbst, sondern wird durch einen aktiv-moderierenden Deutungsprozess durch die FSB initiiert. Die Fragestellungen dieser Arbeit klären vertiefter das „Wie & Was“ dieser Aufgabe.
Einige Aspekte und Einflussfaktoren in meinen Ausführungen werden den Aufgabenbereich und die Funktion einer Evaluationsfachperson übersteigen. Themenfelder wie Emotionen, Führungsverständnis, Personalentwicklung und Organisationsgestaltung können am Rande gestreift werden. Diese sind jedoch in meiner beruflichen Nebentätigkeit als Berater und Coach relevant und zentral. Bewusst tangiere ich diese Punkte aufgrund meines persönlichen Erkenntnisinteresses, fokussiere aber insgesamt in der Verknüpfung meiner Thesen auf die Rolle als Evaluationsfachperson.
1.3 Vorgehensweise und Thesenerarbeitung
Zur Synthese aller Portfolioaussagen orientiere ich mich übergreifend am Rahmenmodell von Wiesner (vgl. Abb. 1). Jeder Portfolioauszug (2.1 - 2.5) widmet sich grundsätzlich einer der Leitfragen, greift jedoch übergeordnete Aspekte auf. Die dazugehörigen Portfolioauszüge (6.1 - 6.5) sind im Detail in den Anhängen ersichtlich. Analysierend suche ich nach Antworten aufgrund von Theorien, Lehrgangsinhalten und eigenen Schlussfolgerungen; diese münden in Thesen. Im Kapitel 3 verknüpfe ich die Thesen zu einem Gesamtfazit entlang meines Erkenntnisinteresses und zeige berufspraktische Ansatzmöglichkeiten auf.
2 Erkenntnisse und Thesen anhand der Portfolioauszüge
Das Rahmenmodell für den pädagogischen Nutzen der Bildungsstandards in Österreich (vgl. Abb. 1, Wiesner, 2018, S. 421) bildet einen Zyklus für evaluationsbasierte Entwicklungsprozesse ab, welcher auch auf die externe Schulbeurteilung des Kantons Zürich angewendet werden kann. Zudem zeigt Schratz wesentliche Einflussbereiche auf den Datennutzungskreislauf:
- die Schulaufsicht mit den Schulleitungen bzw. dem Schulteam;
- schulische Bedingungen im Sinne der Kultur und Kommunikation;
- Unterrichtsqualität mit Fokus auf die Kompetenzorientierung;
- Diagnoseverfahren zur vergleichenden Leistungsmessung.
Konkretisierend nennt er einige Gelingensfaktoren im Modell. Aufgrund der Metabene meiner Fragestellung werden diese in dieser Arbeit zwar teils aufgegriffen, dienen aber in erster Linie als Übersicht zur operativen Entwicklungsumsetzung für die einzelnen Schulen im Alltag. Diese sind für die Gesamtschau wesentlich, aber weniger Bestandteil meines Erkenntnisinteresses.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Die Abbildung wird auf der letzten Seite größer angezeigt.)
2.1 Qualitätseinschätzung von schulischen Prozessen als Dialoggrundlage
„Schulqualität“ ist ein Begriff enormer Weite und komplexer Wechselwirkungen. Im Hinblick auf unsere Fragestellung und aus der Perspektive eines Evaluationsperson bietet der „Q2E- Referenzrahmen“ einen verständlichen Überblick von Aspekten. Die externe Schu levaluation im Kanton Zürich fokussiert auf die „Prozessqualität von Schulen“, also die Bewertung der Ausprägung von Schulentwicklungselementen (Schulführung, Organisation & Administration, Zusammenarbeit und Schulkultur) sowie der Unterrichtsqualität (Lehr- und Lernarrangement, soziale Beziehungen, Beurteilungspraxis). Somit wird eine normative Beurteilung aller sehr unterschiedlichen Volksschulen möglich, im Prinzip unabhängig von Input- und Outcomequalitäten. Für die Datennutzung der Aussagen zur „Prozessqualität“ sind für die Einzelschulen die Kontextfaktoren und auch die Wirkungsorientierung jedoch wichtig. Eine Integration der externen Sicht in den internen Entwicklungskreislauf geschieht gemäss diverser Autoren (z. B. Landwehr, 2015, S. 14; Ammann et al., 2020, S. 194) über eine professionelle, partizipative Datenreflexion. Beurteilende und betroffene Personen analysieren gemeinsam Resultate, Gründe, Kriterien etc. und gleichen ihre Differenzen und Übereinstimmungen zur Wahrnehmung ab. Beywl (2019) zeigt zudem auf, wie fundamental eine gemeinsame „kollektive Wirksamkeitsvorstellung“ in einem Schulteam sind, also eine pädagogische Vision, interdisziplinäre Kooperation und Wirkungsorientierung in Bezug auf die Schulkinder. Bei der erwähnten Datenreflexion einer Schulbeurteilung betrachtet man die Prozesse demnach auch „vom Ende her gedacht“ (Output, Outcome): Was bewirken Aspekte der Prozessqualität an der Einzelschule im Hinblick auf die schulischen Leistungen, die Sozialisationsergebnisse und die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler. Im Idealfall findet also ein Dialog zum Beurteilungsbericht einer Schulevaluation statt, in welchem
- Behörden geeignete Inputqualitäten erhöhen zugunsten von zielführenden Prozessen,
- die Schulleitungen schulinterne Prozesse und Kulturelemente optimieren
- als Unterstützung für die Lehrpersonen, damit diese eine hohe Unterrichtsqualität erreichen,
- wo Lernende die Lernangebote (vgl. Helmke, 2014, S. 71) annehmen wollen und können.
2.1.1 Thesen I: Interpretationsräume schaffen; wirkungsorientiertes Handeln fördern
Zur Frage nach unterstützend gestalteten Deutungsprozessen datenbasierter, externer Qualitätseinschätzungen stelle ich aufgrund der obigen Herleitung diese zwei Thesen zur Diskussion:
- Es braucht gemeinsame Zeit- und Interpretationsräume, wo die Berichtsautor/innen gemeinsam mit möglichst vielen Anspruchsgruppen einer Schule die Beurteilungsfakten und Befragungswerte unter gegenseitigem Respekt und Vertrauen diskutieren, analysieren und reflektieren können. Mögliche Leitfragen: Gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen? Wo sind Überraschungen oder Blinde Flecken? Gilt es Entwicklungen zu verstärken, anzupassen oder zu verknüpfen? Welche empfohlenen Handlungsfelder unterstützen Prozesse für einen wirkungsvollen Unterricht vor Ort besonders?
- Trotz bewusster Fokussierung des Evaluationsberichtes auf den IST-Zustand der Prozessqualität einer Einzelschule, sollen die Betroffenen „Output und Wirkung“ als Messlatte und Bezugspunkte bei der Diskussion zu den Aspekten der Prozessqualität nutzen. Konkret: Speziell an den Impulsworkshops könnten Indikatorenformulierungen (sichtbare Resultate, relevante Outputs, erfassbare Auswirkungen) handlungsunterstützender sein als Zielformulierungen.
2.2 Entwicklung von Schulqualität als Zusammenspiel von Akteuren
In der Feldphase des CAS SQA vertiefte ich mich gemeinsam mit Caroline Cada (Behördenmitglied) in die Fragestellung, wie die unterschiedlichen Führungsebenen und Akteure gewinnbringend Schulqualitätsentwicklung beeinflussen können. Als Keyplayer definierten wir die politische Behörde, Schulleitung, Schulverwaltung und das Lehrpersonal. Wir analysierten
- den Einfluss auf die Unterrichtsqualität,
- die Rollen und Aufgaben im Qualitätsmanagement
- sowie die Fachmeinung der pädagogischen Hochschule (Interview mit A. Hugelshofer).
Grundsätzlich zeigt sich, dass ein „organisationspädagogisches Handlungsverständnis“ des Schulsystems fundamental ist (vgl. Huber et al., 2014, S. 135). Wie bereits im vorherigen Kapitel aufgegriffen, hat die Schulführung als Gesamtheit eine besondere Aufgabe im Qualitätskreislauf: In den Momenten eines Schulprogrammwechsels, der Jahresplanung oder dem Abschluss einer internen oder externen Evaluation sollen alle Führungsebenen ihre fördernden Einflussbereiche zugunsten eines entwicklungsorientierten Zusammenspiels nutzen. Die Behörde kann die Einzelschule in ihren Vorhaben bestärken (Empowerment), indem sie bei den Schritten „verstehen, hinterfragen und gestalten“ im Evaluationskreislauf mitdenken und diskutieren. Auch Strategien im Bereich der Inputqualität wirken unterstützend (Ressourcenzuweisung, bauliche Anpassungen, pädagogische Legislaturziele zu ICT oder Beurteilungspraxis). Die Schulverwaltung soll sich lösen von der in erster Linie prägenden Kontrolle und Fehlervermeidung. Gewinnbringend erlebte administrative Abläufe aus der Perspektive aller Akteure können kooperativ neu konzipiert werden (ebd., S. 136) und so fördernde Strukturen und Prozesse für Entwicklungsvorhaben bieten. Die Schulleitung ist aufgefordert im Sinne der geteilten Führung geeignete Personen aus dem Schulteam in die Proflexions-, Integrations- und Aktionsphase einzubeziehen und damit für eine praxisbezogene Massnahmenplanung zu sorgen.
2.2.1 Thesen II: Behörde als „Lernende Organisation“; gemeinsame Strategien
Mögliche Aspekte zur Rolle der betroffenen Akteure aller Führungsebenen bei der Integration und Reflexion von Evaluationsdaten zeigen folgende Thesen auf:
- Gemeinsam mit den Schulleitungen sollen sich die Behörden als Teil der „lernenden Organisation Schule“ (Senge, 2006) sehen und modellartig vorleben. Beispielsweise ein organisationspädagogisches Verständnis entwickeln; sich Wissen über Bildungsentwicklungen aneignen um Entwicklungsschritte antizipieren zu können; pädagogische Schwerpunkte und Prioritäten setzen zur Entlastung und Orientierung für die einzelnen Schuleinheiten.
- Die Behörde soll in ihrer Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung durch die Evaluationsfachpersonen angesprochen werden. Legislaturziele, Vorgaben einer Qualitätsgruppe oder Aufsichtskommission sollen evidenz- und nicht nur politisch orientiert sein, also eine wirkungsvolle Schul- und Unterrichtsentwicklung begünstigen. Die Behörde kann sich in Evaluationsprozesse der Schule involvieren aber auch übergeordnete Retraiten und Tagungen initiieren. Wirkungsorientierte, partizipativ entwickelte Strategien verbessern die Rahmenbedingungen für qualitativ hochstehende Prozesse in den Einzelschulen (materielle und finanzielle Ressourcensteuerung, Personalförderungskonzepte, sinnvolle Rahmenvorgaben).
2.3 Wissenschaftliche Gelingensfaktoren zur Nutzung von Evaluationsdaten
Die Forschung liefert hilfreiche Ansatzpunkte für mich als Evaluator, in welchen Themenbereichen oder Handlungsfeldern aktiv der Transfer von Evaluationsdaten zur Nutzung gefördert werden kann. Die beiden Gastreferentinnen des Lehrgangs, Bremm & Maag Merki (vgl. 2021, CAS SQA), stützen sich auf zahlreiche Forschungsergebnisse; nachfolgend erläutere ich einige anerkannte, gemeinsame Aussagen und Gelingensfaktoren.
In den vorherigen Kapiteln wurde herausgearbeitet, wie wesentlich dialogisch geführte Datenanalysen und dafür geeignete Interpretationsräume sind, mit Vertretungen alle Führungsebenen. Die Zusammenhänge von aktuellen Faktenlagen mit Wirkungszielen sollen dabei beachtet werden. Bremm & Maag Merki fokussieren stark auf das Lernen der Schulkinder und damit auf die Verbindung von Qualitätsbeurteilung, Schul- und Unterrichtsentwicklung. Daten- und Evaluationsergebnisse können dann ihre Wirkung entfalten, wenn gemeinsam mit dem operativ tätigen Schulteam Verknüpfungen mit ihrer „professionellen Weisheit“ bzw. ihren mentalen Erklärungs- und Erfahrungsmodellen hergestellt werden. Solche und ähnliche Leitfragen sind zielführend: An welchen Praxisbeispielen oder Routineprozessen können die Daten festgemacht werden? Welche Haltungen, Problempunkte oder Muster liegen den Analyseresultaten zugrunde? Welche Erklärungen und Hypothesen finden die Betroffenen Lehr- und Leitungspersonen (vgl. Mintrop, 2018, S. 101ff)? Bremm (ebd.) beschreibt eine zentralen „Sinn“ von evidenzbasierter Schulentwicklung im „Empowerment von Lehrkräften als Innovationsinstrument“ und empfiehlt die Diskussion der obigen Fragen idealerweise in Lerngemeinschaften mit einer hohen Vetrauensbasis. Maag Merki (ebd.) sieht den Fokus in dieser Antwortfindung in den Lerngemeinschaften auf den täglichen Mustern und Routinen. Es geht darum, diese Routinen zu erkennen, verstehen und durchschauen um dann gemeinsam mögliche Handlungsalternativen im Schulalltag zu finden. Diese Erkenntnisse können in einem psychologisch sicheren Schulumfeld umgesetzt, ausprobiert und evaluiert werden - die Schulentwicklung soll sich von einem Managementverständnis zu einer Qualitätslogik bewegen (vgl. Abb. 2, Maag Merki, 2021, CAS SQA).
- Stärken - Schwächen
- Ist-Soll
- Analyse Gründe
- Gewichtung Ergebnisse, Interpretation
- Sense-making
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Strategien der Regulation von Routinen, Maag Merki et al., 2022 in press
2.3.1 Thesen III: Passung von Daten & Praxis herstellen; Routinen fokussieren
Die Anschlussfähigkeit von Daten zum konkreten Nutzen im Unterrichtsalltag führt wissenschaftlich betrachtet zu diesen Thesen:
- Die gemeinsame Evaluationsdaten- und Berichtsreflexion soll über eine Diskussion hinaus mit Alltagsgegebenheiten und Praxiserfahrungen verbunden und abgeglichen werden. Problematische Aspekte, Lösungsansätze und umsetzbare Alternativen können zusammen entworfen und experimentell zum Einsatz kommen, mit einer gezielten Überprüfung am Ende (vgl. Wampfler, 2018, S. 8ff).
- Der Schulalltag ist geprägt von Handlungsroutinen im Unterricht aber auch Regulationsprozessen in der Organisation und Schulkultur. Daten und Beobachtungen müssen im Gespräch mit solchen alltäglichen „Strategien“ in Verbindung gebracht werden. Unterstützende Fragen dazu: Welche Routinen sind relevant für eine nachhaltige Qualitätsentwicklung? In welchem Verhältnis stehen organisationale und kulturelle Regulationsprozesse mit den Evaluationsergebnissen? In welchen Situationen wird routiniertes Handeln unterbrochen und soll verändert werden? (vgl. Maag Merki, PPT CAS SQA, Folie 35)
2.4 Organisationslogik als zentraler Schlüssel für Entwicklungsumsetzungen
Im Kapitel 2.2. wurde der Begriff „organisationspädagogisches Handlungsverständnis“ ins Feld geführt, welcher auch die administrativen und strukturellen sowie organisationalen Einflüsse auf Schulqualität aufzeigt, wobei alle Akteure ihren Einflussbereich erkennen sollten. Im architektonischen Bereich kennen wir die Aussage „Form follows Function“, ein Gebäude muss auf seinen Zweck ausgerichtet sein. Der Schulalltag ist geprägt von Spannungsfeldern: Zielorientierung versus Beziehung & Kooperation; Ordnungsstrukturen versus Veränderungsprozesse & Innovation (Wagner, 2011 nach Schratz et al., 2010, Integrales Leadership-Kompetenz-Modell). Die Schule bewegt sich in einem mehrdeutigen, sich rasch verändernden Kontext und soll ihre Organisation und Struktur sowie ihre Zusammenarbeitsformen darauf und die erwähnten Spannungsfelder ausrichten. Diverse „agile“ Organisationsmodelle entwerfen neue Organisationslogiken (u. a. Laloux, 2017) Grössere Volksschulen, welche aufgrund von Evaluationsergebnissen nicht nur optimieren, sondern wirklich innovativ (vgl. Kruse, 2015, Next Practice) sein möchten, sind herausgefordert, passende Strukturen anzubieten. Folgende Elemente sind prüfenswert:
- Lehrpersonen mit klaren Funktionen und den entsprechenden Kompetenzen und Verantwortungen ausstatten.
- Ziel- und Zweckorientierte Kooperationseinheiten bilden, welche sich umfassend selbst organisieren (Moderationsart, Wahl der Leitung, Entscheidungskompetenz in der Sache).
- Werte wie Pragmatismus, rasche Veränderungsmöglichkeiten, unkomplizierte Abläufe und Selbstbestimmung sind grundlegend. (vgl. CAS OB, 2021) Schulen, welche ihre Organisation radikal den pädagogischen und funktionalen Zielen unterordnen, müssen sich folgenden Gelingensfaktoren bewusst sein (ebd.):
- Die Übergabe von Kompetenz und Mitbestimmung bedeutet einen Machtverlust der Schulführung. Kontrollmechanismen über verbindende Steuerungskreise sind zu beachten.
- Die Personen brauchen einen Kompetenzaufbau im Umgang mit mehr Autonomie und besitzen bereits eine professionelle Kommunikations- und Kooperationskultur.
- Der Changeprozess muss zwingend von der Schulführung her gewünscht sein und ein mehrjähriger Einführungsprozess ist mit Geduld anzugehen.
2.4.1 Thesen IV: “Form Follows Function“; Freiräume & Autonomie ermöglichen
In komplexen Schulorganisationen gibt es Schlüsselelemente und Modelle, welche die Umsetzung von Entwicklungsvorhaben begünstigen und die Identifikation der Mitarbeitenden erhöhen. Folgende Thesen verbinden diese Erkenntnisse mit der Verarbeitung von Evaluationsdaten:
- Im Anschluss an die Reflexionsphase eines Evaluationsberichtes sollen pädagogische Ziele und dazugehörige Aktionen die schulische Organisationsform und die Kooperationskultur tangieren und beeinflussen - eine kritische Überprüfung ist in den Evaluations- und Qualitätskreislauf einzubauen.
- Agile Führungsformen und Strukturen schaffen für die Mitarbeitenden Spiel- und Freiräume; es knüpft an die Stärken der traditionellen, selbstbestimmten Schulkultur vor der Einführung von Schulleitungen an. In der erweiterten Autonomie steckt ein enormes, intrinsisches Motivationspotential zur Umsetzung von Entwicklungsabsichten.
2.5 Nachhaltigkeit über individuellen Mehrwert und Sicherheit gewährleisten
Wie Eingangs eröffnet (vgl. Kap. 1.1), entscheiden zu einem grossen Anteil emotionalmotivationale Softfaktoren darüber, ob der Evaluations- und Entwicklungsschritt von der Proflexion zur Aktionsphase bis hin zu den einzelnen Mitarbeitenden und in den Unterricht vollzogen wird. Eine nachhaltige und gesicherte Implementation von evidenzbasierten Massnahmen erfordert demnach eine Berücksichtigung dieser Einflüsse auf das Projektmanagement.
In der Abbildung 3 sind insbesondere die Psychosozialen- und Umsetzungsprozessverläufe bei Veränderungen zentral. In der Phase des Loslassens von Bewährtem und Akzeptierens von Neuerungen ist die Motivation der Betroffenen am geringsten. Entsprechend sind in dieser Phase “Quick-Wins“ wichtig, also rasch erkennbarer Nutzen. Helmke (vgl. 2014, S. 317) zeigt, dass der “Nutzen“ nicht ausschliesslich sachlich gemeint ist, sondern tatsächlich ein persönlicher Anreiz/Gewinn da sein muss, also Entwicklungen individuell mehr Ertrag als Kosten mit sich bringen. Geäusserte Widerstände aber auch erkennbare Veränderungstreiber sind darum von den Projektleitenden ernst zu nehmen und systematisch für eine erfolgreiche Implementation ins Projektmanagement zu integrieren (vgl. Bremm, 2021, PPT CAS SQA).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.5.1 Thesen V: Motivationale Aspekte, Widerstände und Emotionen einbeziehen
Emotional-motivationale Veränderungsaspekte sind besonders beim Transfer von externen Evaluationsergebnissen in die individuelle Aktion durch das Schulteam entscheidend.
- In der Gestaltung des Projektmanagements aufgrund von Erkenntnissen aus dem externen Evaluationsbericht sind Phasen des Zuhörens und Zurückfragens einzubauen (Scharmer, 2015), damit gemeinsam im Schulteam wesentliche Widerstände zur Zielerreichung ausgesprochen, aber auch Sinnesanker und Veränderungstreiber als Energiequellen erkannt werden können.
- Für eine nachhaltige Veränderung, welche auch die Unterrichtsqualität positiv beeinflusst, müssen die einzelnen Mitarbeitenden für sich einen Mehrwert bei den Entwicklungsvorhaben erkennen. Entwicklungsschritte lösen oft Angst und Widerstände aus, weil die notwendigen Kompetenzen bei den Mitarbeitenden nicht parallel zu den Entwicklungsprozessen aufgebaut werden und damit die psychologische Sicherheit nicht gegeben ist - die Versagensängste und Tendenzen zur Fehlervermeidung sind stärker als die Motivationskräfte.
3 Sachliche und berufsbezogene Schlussfolgerungen zu allen Thesen
3.1 Verknüpfungen und Fazit bezüglich der Leitfrage
Die Portfolioauszüge (vgl. Anhänge) wurden mithilfe der Leitfragen aus Kapitel 1.1. beleuchtet und mit weiteren Theorien in Verbindung gebracht. Meine dazugehörigen Konklusionen, Erkenntnisse sind in den diversen „Thesen“ zusammengefasst. An dieser Stelle zeige ich als sachliches Fazit meiner Lernerkenntnisse, über alle Thesen hinweg, Antwortmöglichkeiten zur übergeordneten Fragestellung dieser Arbeit: Welche Gelingensfaktoren begünstigen die Integration von externen Schulevaluationsergebnissen in die Schul- und Unterrichtsentwicklung der Einzelschulen?
Neben der Ergebnispräsentation von Schulevaluationsresultaten in mündlicher und schriftlicher Form, sind gemeinsame Interpretationsräume im Sinne einer Datenreflexion und Diskussion wesentlich für einen gelingenden Transfer zum schuleigenen Qualitätskreislauf bzw. dem individuellen Schulalltag. Die Evaluationspersonen bringen dabei ihr Expertenwissen ein und nehmen die Analyse möglichst vieler Anspruchsgruppen zusammenfassend auf - es entsteht ein Wahrnehmungsabgleich und eine Verbindung mit dem Praxiswissen. In dieser Zusammenarbeit werden Problemfelder sichtbar und auch Lösungsansätze zu empfohlenen Handlungsfeldern oder kritischen Befragungswerten aus der Evaluation, diese sind jedoch eng mit alltäglichen Handlungsroutinen und Strategien verknüpft. Alternative Routinen und Regulationsprozesse aber auch praktisches Ausprobieren und Prüfen dieser Ideen sind zielführend für die schulinterne Weiterentwicklung, besonders in installierten Lerngemeinschaften.
Die Entwicklungsansätze, Massnahmen oder Strategien aus der Diskussion zu den Evaluationsergebnissen finden ihre Umsetzung je nach „Flughöhe“ in anderer Form. Im Bereich der Unterrichtsqualität müssen konkrete Handlungsroutinen angewandt und evaluiert werden, die Überprüfung soll jedoch nicht nur sachlich nutzbringende Veränderungen aufzeigen, sondern auch einen Mehrwert und Gewinn für die unterrichtenden Lehrpersonen ausweisen. Eine angemessene „gefühlte“ Effizienz bei Neuerungen und Innovationen sind entscheidend für eine langfristige Nachhaltigkeit. Als Unterstützungsprozess ist das Personal hinsichtlich neuer Aufgaben oder Verantwortungen bewusst in ihrer Kompetenz auszubilden und zu fördern. Aus dieser Sicherheit entsteht Motivationsund Innovationskraft. Nicht nur auf der individuellen Ebene sind Umsetzungsprozesse zu beachten, auch als Schulteam braucht es in den Innovationsprozessen Momente des Zwischenhalts, um begründete Widerstände aber auch Sinnesanker und „Quick-Wins“ gemeinsam zu erkennen. Diese Gefässe des Zuhörens und Innehaltens sind in der Projektplanung vorgängig einzuplanen.
Die gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze und Erkenntnisse aus der externen Evaluation werden dann innovativ, wenn stetig die Wirkungsperspektive berücksichtigt wird. Neue Prozesse, Strukturen, finanzielle und materielle Ressourcen sowie pädagogische Vorhaben sollen einerseits miteinander logisch verbunden sein, also nicht isoliert geplant werden, andererseits an ihrem Einfluss auf „Output und Outcome“ bei den Schulkindern gemessen werden. Innovative, agile Organisations- und Kooperationsformen können pädagogisch begründete Entwicklungsvorhaben positiv beeinflussen, sofern sie aufeinander abgestimmt sind. Die gewonnene Autonomie und entstehende Freiräume lösen oft intrinsische Motivation beim Schulteam aus und begünstigen eine verinnerlichte Transformation.
Die politischen Behörden können eine „lernende Organisation Schule“ fördern, indem sie ihre Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen und Ressourcenzuweisungen pädagogisch motiviert gestalten. Abgestimmt mit den Entwicklungsvorhaben (z. B. Schulprogrammen) der Einzelschulen aber auch unterstützenden Legislaturzielen, welche an die übergreifenden Handlungsempfehlungen der externen Schulevaluation anknüpfen.
3.2 Berufliche E rkenntnisse und persönliche Lernprozesse
3.2.1 Rolle als Evaluationsfachperson
Bezüglich der beruflichen Umsetzung der Thesen und des Fazits hat sich meine Ansicht auf mögliche Einflussbereiche in der Rolle als Evaluationsfachperson verändert. Die Abläufe, Kriterien, Vorgaben und Einschätzungshilfen erlauben tatsächlich wenig Freiraum für mich als Individuum. Allerdings gibt es Gestaltungsraum in der Art und Weise der Umsetzung innerhalb des Evaluationsprozesses. Exemplarisch und auf die Leitfrage dieser Arbeit fokussiert, einige Handlungsfelder:
- Die Anschlussfähigkeit der finalen Evaluationsergebnisse wird bereits im Entstehungsprozess beeinflusst und der Boden für eine vertrauensvolle und gemeinsame Datenanalyse geschaffen - durch das Zeigen authentischen Interesses an den Menschen und Inhalten der Schule während der Vorbereitungssitzungen, der Teamvorstellung, in den Unterrichtsbesuchen oder informellen Kurzgesprächen mit dem Schulteam beziehungsweise professionellen Nachfragen in den Interviews. Insbesondere aber auch eine angemessene Menschlichkeit gepaart mit Professionswissen an der Präsentationsform der mündlichen Ergebnisse fördert die emotionale Bereitschaft zur Ergebnisauseinandersetzung durch die Betroffenen. Aufgrund meiner ersten Erfahrungen im Praxisalltag erkennen ich an Reaktionen und Feedbacks, dass meine Absicht in den Schulteams ankommt und geschätzt wird.
- In der Formulierung von Handlungsfeldern können Gelingensfaktoren berücksichtigt werden: Hinweise auf die Wirkungsaspekte von Entwicklungsbereichen; Aufzeigen der Wichtigkeit von Routineprozessen, Haltungen und Emotionen bei Umsetzungsvorhaben; Organisationale und strukturelle Aspekte in Wechselwirkung mit pädagogischen Absichten setzen.
- Während der Schulführungsgespräche können Behörden direkt in ihrer Rolle einbezogen und angesprochen werden, dabei auch auf ihre Anteile einer gelingenden Umsetzung hingewiesen werden. Eine erster befruchtender Interpretationsraum entsteht oft bereits nach der Rückmeldeveranstaltung oder beim Vorgespräch zum Impulsworkshop.
- Der Impulsworkshop selbst ermöglicht am meisten Einfluss auf die Anschlussfähigkeit. Beim Verstehensprozess können Methoden und Leitfragen gewählt werden, die auch Routineprozesse tangieren. Vernetzungen mit Strukturen und motivationalen Faktoren können initiiert werden bei der Analyse. Die Wirkungsorientierung ist besser gewährleistet, wenn verstärkt Indikatoren anstelle oder anhand von Zielen formuliert werden.
- Der Impuls zur Projektplanung geschieht am Ende des Workshops und als Evaluationsperson sind dort Anstösse für Zwischenhalte und Meilensteine möglich, welche auch Emotionen ansprechen und die Wichtigkeit von rasch sichtbaren, ersten Erfolgen aufzeigen.
3.3 Kritische Reflexion, Grenzen der Arbeit, offene Fragen
Im Umfang dieser Zertifikatsarbeit sind die komplexen Nutzungszusammenhänge in Bezug auf externe Gutachten in Kombination mit Datenerhebungen nur unvollständig und eher oberflächlich behandelbar.
Der ganze Einflussbereich auf Seite der Einzelschule (vgl. Kontextfaktoren Abb. 1) ist kaum bearbeitet. Ich habe mich auf Gelingensfaktoren konzentriert, welche grossteils aktiv als Gelingensbeitrag aus meiner Evaluationsrolle anwendbar sind. Im Sinne eines “Angebots- Nutzungs“-Lernverständnisses, spielt die Empfängerpartei eine mindestens so wichtige Rolle - diese Fragen und Antworten bleiben an dieser Stelle offen. Andere Arbeiten meinerseits (vgl. Literaturverzeichnis) leisten einen Beitrag dazu: Wissensmanagement, Basisprozesse Changemanagement, Wirkungsorientierte Schulführung.
Das Zitat der beiden Koryphäen Rolff & Schratz (2015, S. 6) illustriert die Grenzen von „Anschlussfähigkeit“: «Genauso müssen Transferaktivitäten betrachtet werden, die in die Tiefe gehen, also Wert- und Verhaltensdimensionen berühren: Man kann nicht davon ausgehen, dass sie genauso gelingen wie geplant und sie haben möglicherweise Nebenfolgen, die nicht geahnt und nicht gewollt sind.»
4 Verweisangaben
4.1 Literatur
4.1.1 Sammelbände
- Ammann, Markus / Wiesner, Christian / Schratz, Michael (2020): Über das Zusammenwirken von Schulaufsicht und Schulleiterinnen und Schulleitern. In: Klein, Dominique / Bremm, Nina (Hrsg) (2020): Unterstützung - Kooperation - Kontrolle. Zum Verhältnis von Schulaufsicht und Schulleitung in der Schulentwicklung. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 191-212.
- Glasl, Friedrich (2020): Die sieben Basisprozesse der Organisationsentwicklung. In F. Glasl / F., Kalcher, T. / H. Piber, H. (Hrsg.) (2020): Professionelle Prozessberatung. Das TrigonModell der sieben OE-Basisprozesse. 4. Auflage. Haupt Verlag Freies Geistesleben, S. 104144.
- Jesacher-Roessler, Livia / Kemethofer, David (2020): Kooperation auf regionaler Ebene - Schulaufsicht und Schulleitung im Dickicht institutioneller Umwelten. In: Klein, Dominique / Bremm, Nina (Hrsg) (2020): Unterstützung - Kooperation - Kontrolle. Zum Verhältnis von Schulaufsicht und Schulleitung in der Schulentwicklung. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 335-355.
- Wiesner, Christian (2018): Möglichkeiten und Grenzen evidenzorientierter Schulentwicklung. In: Schratz, Michael / Wiesner, Christian / Jesacher-Roessler, Livia (Hrsg.) (2018): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2018. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen. Innsbruck: Leykam, S. 403-453.
4.1.2 Monografien
- Helmke, Andreas (2014): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. 5., aktualisierte Auflage berücksichtigt die Hattie-Studien. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Huber, Stephan / Hader-Popp, Sigrid / Schneider, Nadine (2014): Qualität und Entwicklung von Schule. Basiswissen Schulmanagement. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kruse, Peter (2015): next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität. Veränderung durch Vernetzung. 8. Auflage. Offenbach: GABAL Verlag.
- Laloux, Frederic (2017): Reinventing Organizations. Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Verlag Franz Vahlen GmbH.
- Mintrop, Rick (2018). Design-Based School Improvement. A Practical Guide for Education Leaders. Second Printing. Cambridge: Harvard Education Press.
- Scharmer, Claus Otto (2015): Theorie U. Von der Zukunft her führen - Presencing als soziale Technik. 4. Auflage. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Senge, Peter M. (2006): London: The Fifth Discipline. The Art & Practice of The Learning Organisation. Revised and Updated Edition. Random House Business Books.
- Wagner, Cornelia (2011): Führung und Qualitätsmanagement in beruflichen Schulen. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
4.1.3 Artikel
- Beywl, Wolfgang (2019): Vom Miteinander überzeugte Lehrpersonen steigern die Lernerfolge. Kollektive Wirksamkeitserwartung als Angelpunkt der Schulentwicklung. In: journal für schulentwicklung, Jg. 23, Nr. 1.
- Landwehr, Norbert (2015): Von Evaluationsdaten zur Unterrichtsentwicklung. In: Rolff, Hans- Günter (Hrsg.) (2015): Handbuch Unterrichtsentwicklung. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 157-181.
- Rolff, Hans-Günter / Schratz, Michael (2015): Transfer von Innovationen. Editorial. In: journal für schulentwicklung, 19 (2015) 4, S. 4-6.
- Wampfler, Philippe (2018): Schule, Führung und Design Thinking. Einem Ansatz aus der Kreativbranche folgen. In: Schule leiten, 14 (2018), S. 8-10.
4.1.4 Unterlagen aus Organisationen
- Bremm, Nina (2021): Evidenzorientierte Schulentwicklung. PPT CAS SQA, Modul 2. Zürich: Pädagogische Hochschule.
- CAS OB S2T3 (2021). Die zentralen inhaltlichen Schritte. Sequenz 2, Tag 3 Handout. Zürich: AEB.
- FSB (2019): Strategie «Evaluation 21». Strategische Grundsätze und Ziele 2021 bis 2026. Zürich: Fachstelle für Schulbeurteilung.
- Maag Merki, (2021): Schulentwicklungskapazität als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. PPT CAS SQA, Modul 3. Zürich: Pädagogische Hochschule.
4.1.5 Grafiken
- Titelbild: Innovation by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org
4.1.6 Weiterführende, eigene wissenschaftliche Arbeiten
- Spiess, Roger / Bühler, Miriam / Rüedi, Patrick (2011): Wissensmanagement. Literaturbasierte Konzeptarbeit zu Wissensmanagement mit Bezug zum System Schule. CAS Führen einer Bildungsorganisation. Zürich: Pädagogische Hochschule.
- Spiess, Roger (2016): Learning Leader. In der Rolle der Schulleitung mittels unterrichtsbezogener Führung die Wirksamkeit des Unterrichts fördern: Rahmenmodell, Umsetzungsprozesse, Instrumente. MAS Bildungsinnovation. Zürich: Pädagogische Hochschule.
- Spiess, Roger (2022): Beratungsmandat zur Implementation des «Rahmenkonzeptes Schulische Integration» der Stadt Winterthur. Changemanagement in den Rollen als Projektleiter sowie des externen Beraters und Coachs: Kontextfaktoren, Analyse, Methode, Prozessarchitektur und Reflexion. CAS Organisationsberatung und Führungscoaching. Zürich: Akademie für Erwachsenenbildung, Pädagogische Hochschule St. Gallen.
Schulaufsicht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Integratives Rahmenmodells für evidenzorientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung" (Wiesner, 2018)
Abbildung 1 (siehe S. 4)
Häufig gestellte Fragen zu "Vom Expertengutachten zur Innovationskraft"
Was ist das Hauptthema des Dokuments "Vom Expertengutachten zur Innovationskraft"?
Das Hauptthema ist die datenbasierte Qualitätsentwicklung in Schulen, insbesondere die Frage, wie Expertengutachten und Evaluationsdaten effektiv für Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt werden können. Der Fokus liegt auf Gelingensfaktoren, Rahmenbedingungen und Softfaktoren, die eine erfolgreiche Umsetzung von Entwicklungsinitiativen unterstützen oder behindern.
Welche Fragestellungen werden im Dokument behandelt?
Folgende Fragestellungen werden adressiert:
- Wie können Deutungsprozesse von Daten gestaltet werden, um Erkenntnisse zu gewinnen und Handlungen zu ermöglichen?
- Welche Rolle spielen Führungsebenen und Akteure bei der Reflexion und Integration von Evaluationsergebnissen?
- Wie kann ein Evaluator die Anschlussfähigkeit der Evaluationsergebnisse an die Schulentwicklung fördern?
- Gibt es unterstützende strukturelle und kulturelle Organisationselemente für Entwicklungsrealisationen?
- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen emotional-motivationalen Aspekten und einer nachhaltigen Implementation von Entwicklungsvorhaben?
Welche Thesen werden im Dokument aufgestellt?
Das Dokument präsentiert fünf Hauptthesen:
- These I: Es braucht gemeinsame Zeit- und Interpretationsräume, um Beurteilungsfakten zu diskutieren und wirkungsorientiertes Handeln zu fördern.
- These II: Die Schulbehörde soll sich als „Lernende Organisation“ verstehen und evidenzorientierte Strategien entwickeln.
- These III: Die Evaluationsdaten- und Berichtsreflexion soll mit Alltagsgegebenheiten und Praxiserfahrungen verbunden werden, und Routinen sollen fokussiert werden.
- These IV: Pädagogische Ziele sollen die schulische Organisationsform und Kooperationskultur beeinflussen; Freiräume und Autonomie ermöglichen.
- These V: Emotional-motivationale Aspekte und Widerstände sollen bei der Gestaltung des Projektmanagements berücksichtigt werden.
Welche Rolle spielt der Evaluator in diesem Kontext?
Der Evaluator wird als "entrepreneurial Enabler" verstanden, der pädagogische Themen im Rahmen der Vorgaben mit Inhalt füllt, eine Diskurskultur mit der Schulführung pflegt und Impulse für eine Perspektivenerweiterung der Wirklichkeitswahrnehmung gibt. Die Nutzung der Daten einer externen Schulevaluation geschieht üblicherweise nicht von selbst, sondern wird durch einen aktiv-moderierenden Deutungsprozess initiiert.
Welche Bedeutung haben Organisation und Struktur für Schulentwicklung?
Die Organisationslogik spielt eine zentrale Rolle für die Umsetzung von Entwicklungsvorhaben. Agile Führungsformen und Strukturen schaffen Freiräume und fördern die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden. Die Anpassung der Organisationsform an pädagogische Ziele ("Form Follows Function") wird als wichtiger Faktor für erfolgreiche Entwicklungsprozesse gesehen.
Wie werden emotionale und motivationale Aspekte berücksichtigt?
Emotionale und motivationale Softfaktoren sind entscheidend für die nachhaltige Implementation von evidenzbasierten Maßnahmen. Die Berücksichtigung von Widerständen, Ängsten und individuellen Mehrwerten ist wichtig, um die Motivation der Mitarbeitenden zu fördern und die Akzeptanz von Veränderungen zu erhöhen. "Quick-Wins" und die Schaffung psychologischer Sicherheit spielen eine wichtige Rolle.
Welche Modelle und Rahmenwerke werden im Dokument verwendet?
Das Dokument bezieht sich auf verschiedene Modelle und Rahmenwerke, darunter:
- Das "Integrative Rahmenmodell für evidenzorientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung" (Wiesner, 2018).
- Den "Q2E-Referenzrahmen" zur Einschätzung der Schulqualität.
- Das "Integrales Leadership-Kompetenz-Modell" (Wagner, 2011 nach Schratz et al., 2010).
Was sind die Grenzen der Arbeit und welche Fragen bleiben offen?
Die Arbeit behandelt die komplexen Nutzungszusammenhänge von externen Gutachten nur unvollständig. Der Einflussbereich auf Seite der Einzelschule und die Rolle der Empfängerpartei im Sinne eines "Angebots-Nutzungs"-Lernverständnisses sind kaum bearbeitet. Die Arbeit konzentriert sich auf Gelingensfaktoren, die aktiv aus der Evaluationsrolle anwendbar sind, lässt aber andere Perspektiven offen.
Wie beeinflusst diese Arbeit die Rolle des Autors als Evaluationsfachperson?
Die Arbeit hat die Sicht des Autors auf mögliche Einflussbereiche in der Rolle als Evaluationsfachperson verändert. Es wird betont, dass bereits im Entstehungsprozess der Evaluation der Boden für eine vertrauensvolle Datenanalyse geschaffen werden kann. Die Art und Weise der Umsetzung innerhalb des Evaluationsprozesses bietet Gestaltungsraum, um die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse zu fördern.
- Quote paper
- Roger Spiess (Author), 2022, Anschlussfähigkeit der externen Schulevaluationsergebnisse an die Schul- und Unterrichtsentwicklung der Einzelschulen. Gelingensfaktoren, Rahmenbedingungen, Softfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1301079