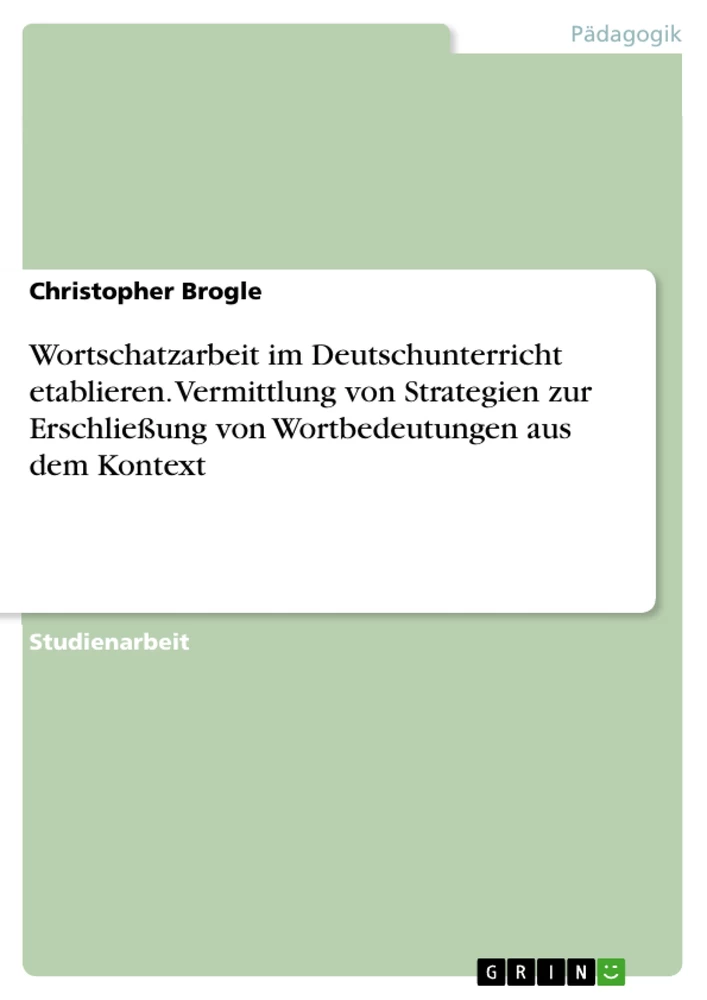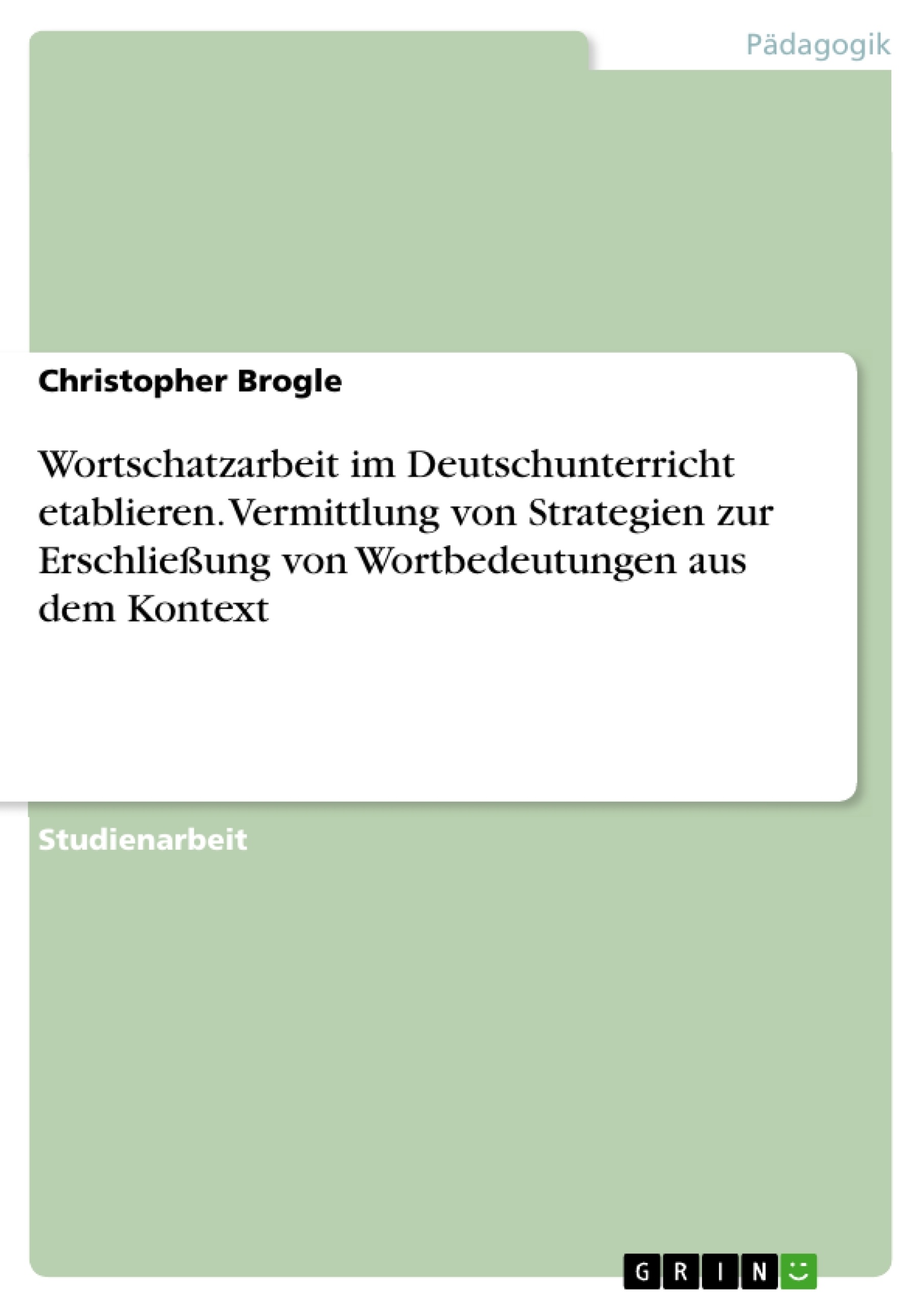Die Etablierung von Wortschatzarbeit sollte im schulischen Kontext angestrebt werden, zumindest jedoch sollte dies eine Priorität für den Deutschunterricht darstellen. Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Vorhabens werden im Folgenden genauer ausgeführt. Im Zentrum steht dabei die Vermittlung von Strategien zur selbständigen Erschließung der Bedeutungen von unbekannten Wörtern aus dem Kontext. Neben der theoretischen Grundlage bezüglich der Forschungslage zum Wortschatz per se werden allgemeine Vor- und Nachteile, sowie Nutzen und Ziele der Strategien herausgearbeitet. Außerdem werden einzelne Strategien und ihre Eignung für die Praxis vorgestellt. Parallel dazu werden auch alternative Methoden kurz beleuchtet, um die vielfältigen Möglichkeiten der Wortschatzarbeit herauszuarbeiten.
Wer sich mit Wortschatzarbeit im muttersprachlichen Deutschunterricht auseinandersetzt, betritt weitgehend Neuland. Im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo nach Carrol bereits seit langem die Erkenntnis vorherrschend ist, dass der Wortschatzerwerb größtenteils während der Schulzeit erfolgt und Wortschatzarbeit somit eine Hauptaufgabe des Sprachenunterrichts in der Schule darstellt. Seit längerem ist bekannt, dass bei Kindern über die gesamte Schulzeit pro Jahr nach Clark etwa 3000 neu verstandene Wörter hinzukommen. Im Laufe des Lebens verändert sich das Wortschatzlernen von der Erweiterung zur Vertiefung des Wortschatzes, wobei Wörter zunehmend vom mentalen Lexikon in dem sie repräsentiert sind, durch wiederholte Konfrontation im Alltag in den Sprachgebrauch übergehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Warum Wortschatzarbeit?
- 2. Welche Strategien zur Wortschatzvermittlung gibt es?
- 3. Kontextbasierte Wortschatzarbeit
- 3.1 Vorteile
- 3.2 Nachteile
- 3.3 Wie kann die Wortschatzarbeit in der Praxis umgesetzt werden?
- 3.3.1 Prämissen
- 3.3.1.1 Zur Anwendung von Prämissen im Unterricht
- 3.3.1.1.1 Das Trainingsprogramm nach Hacker et al.
- 3.3.1.1.2 Übungen
- 3.3.1.1.3 Voraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern
- 3.3.1.1 Zur Anwendung von Prämissen im Unterricht
- 3.3.2 Wir werden Textdetektive
- 3.3.3 C(2)QU
- 3.3.4 SCAR
- 3.3.1 Prämissen
- 4. Fazit
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Modul befasst sich mit der Vermittlung von Strategien zur Erschließung unbekannter Wortbedeutungen aus dem Kontext im Deutschunterricht. Der Fokus liegt auf indirekten Methoden, insbesondere der kontextbasierten Wortschatzarbeit. Es werden die Vorteile und Nachteile dieser Vorgehensweise beleuchtet und verschiedene Strategien und ihre praktische Umsetzung vorgestellt.
- Die Bedeutung von Wortschatzarbeit im Deutschunterricht
- Indirekte Methoden zur Wortschatzvermittlung, insbesondere kontextbasierte Ansätze
- Vorteile und Nachteile von kontextbasierten Strategien
- Praktische Umsetzung von Strategien zur Erschließung unbekannter Wortbedeutungen
- Alternative Methoden zur Wortschatzarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Warum Wortschatzarbeit?
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Wortschatzarbeit im Deutschunterricht und stellt die Notwendigkeit von Strategien zur Wortschatzvermittlung im Kontext des Bildungserfolgs heraus. Es werden die Forschungsergebnisse zum Wortschatzerwerb und den Folgen eines erfolgreichen Wortschatzerwerbs dargestellt.
2. Welche Strategien zur Wortschatzvermittlung gibt es?
Dieses Kapitel unterscheidet zwischen direkten und indirekten Methoden der Wortschatzvermittlung. Es stellt das Konzept der "Robust Vocabulary Instruction" als direkte Methode vor und erläutert ihre Anwendung. Es werden außerdem die Vorteile und Nachteile direkter Methoden im Vergleich zu indirekten Methoden diskutiert.
3. Kontextbasierte Wortschatzarbeit
Dieses Kapitel widmet sich der kontextbasierten Wortschatzarbeit als indirekte Methode. Es werden die Vorteile, Nachteile und die praktische Umsetzung dieser Methode erläutert.
- Quote paper
- Christopher Brogle (Author), 2015, Wortschatzarbeit im Deutschunterricht etablieren. Vermittlung von Strategien zur Erschließung von Wortbedeutungen aus dem Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1301016