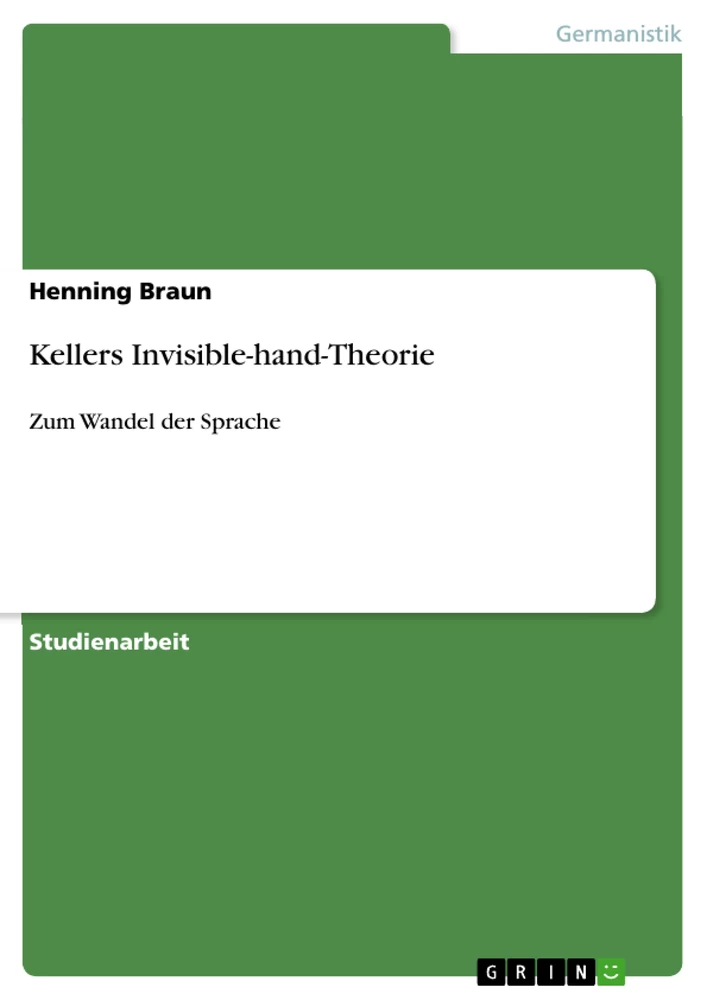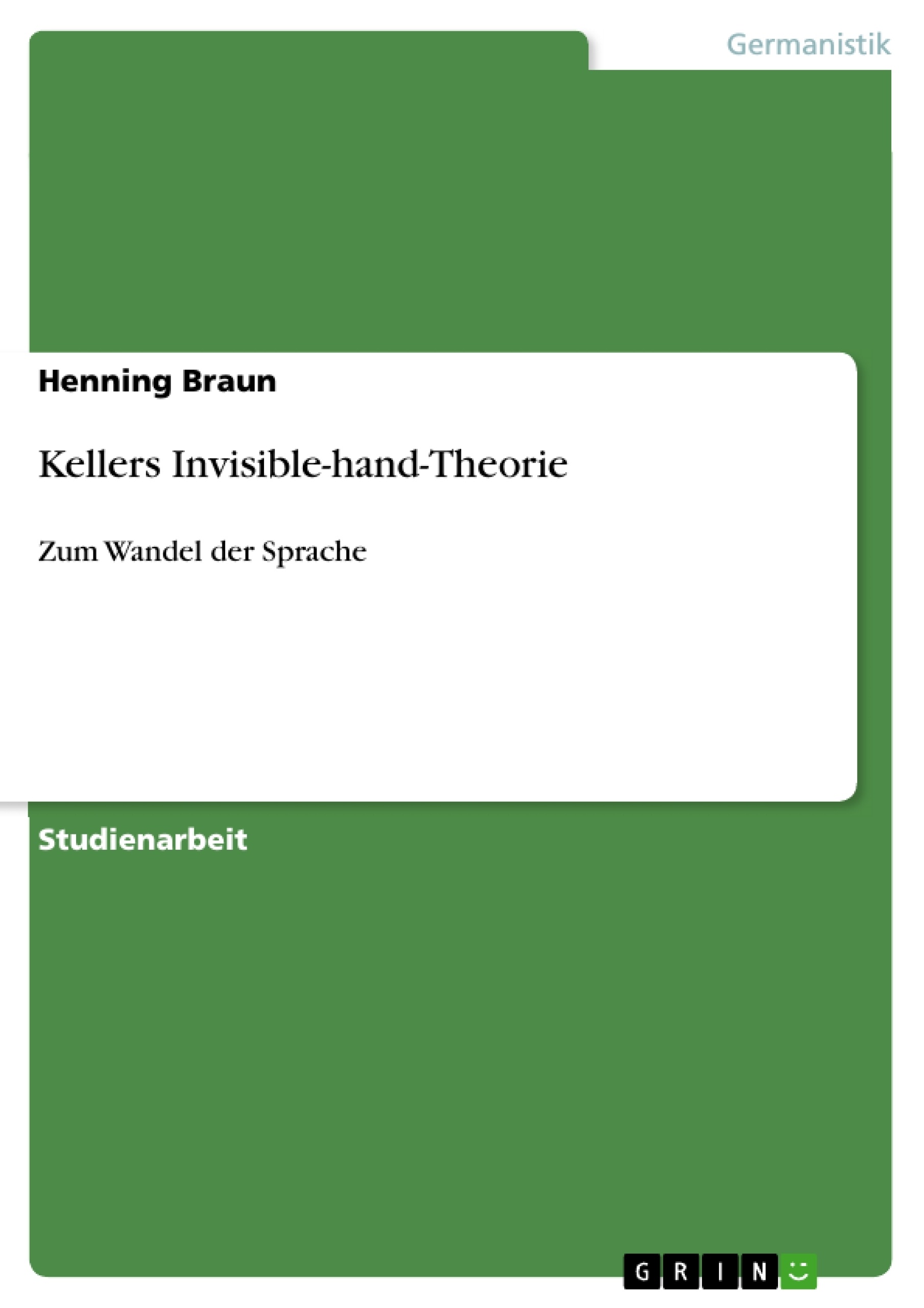Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Invisible-hand-Theorie von Rudi Keller. Grundlegend ist vor allem die Darstellung der Theorie in „Sprachwandel: von der Unsichtbaren Hand in der Sprache“ . Außerdem wird das später erschienene Werk „Bedeutungswandel“ , besonders in Teil 3, berücksichtigt. Ferner ziehe ich noch ein Beispiel aus einem 1982 erschienenen Zeitschriftenartikel von Keller heran.
In Teil 1 werde ich also die Theorie weitgehend kritiklos, doch teilweise schon reflektierend, darstellen. Dies beinhaltet die Prämisse, dass Sprache sich wandelt, die Kritik an früheren Erklärungen sprachlichen Wandels anderer Autoren und die Einführung der Invisible-hand-Theorie. Schließlich werde ich die „Individualkompetenzen“ und den daraus resultierenden Sprachbegriff berücksichtigen.
In Teil 2 setze ich mich kritisch mit dem in Teil 1 besprochenen Text auseinander. Dabei orientiere ich mich überwiegend an kritischen Beiträgen anderer Autoren zu „Sprachwandel“, welche selbst wiederum von mir kritisch betrachtet werden.
In Teil 3 kommt es dann zur Anwendung der Invisible-hand-Theorie. An konkreten Beispielen wie z.B. Friseur/Coiffeur/Hair Stylist werde ich die Anwendbarkeit unter Bezug auf die vorhergegangene Kritik überprüfen.
Im Schluss ziehe ich dann das Fazit meiner Überlegungen zu Kellers Invisible-hand-Theorie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1. Darstellung der Invisible-hand-Theorie
- 1.1. Die Voraussetzung sprachlichen Wandels
- 1.2. Dichotomien und ihr Ausweg
- 1.3. Phänomene der 3. Art und Invisible-hand-Theorie
- 1.4. Sprache als abstrahierte, gebrauchte Individualkompetenz
- 2. Kritik
- 2.1. Beispiellosigkeit
- 2.2. Invisible-hand-Theorie vs. sprachinterner Wandel u.a. Theorien
- 2.3. Wortschöpfungen
- 2.4. Selbstisolation
- 2.5. Extreme Dichotomie
- 2.6. Prognostizierbarkeit und Wahrheitswert
- 2.7. Handlungsmaximen
- 2.8. gleichgerichtete Intentionen, Trivialität und getrennte Sprachbereiche
- 3. Anwendung an konkreten Beispielen
- 3.1. Friseur vs. Coiffeur vs. Hair-Stylist
- 3.2. Weib vs. Frau
- 3.3. englisch₁ vs. englisch₂
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Rudi Kellers Invisible-hand-Theorie des Sprachwandels. Die Zielsetzung besteht in der Darstellung der Theorie, einer kritischen Auseinandersetzung mit ihr und der Anwendung auf konkrete Beispiele. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Theorie im Kontext bestehender Ansätze.
- Darstellung der Invisible-hand-Theorie Kellers
- Kritik an der Theorie und Vergleich mit anderen Ansätzen
- Anwendung der Theorie auf konkrete sprachliche Entwicklungen
- Analyse der Dichotomien im Verständnis von Sprachwandel
- Konzept der "Individualkompetenzen" im Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Darstellung der Invisible-hand-Theorie: Dieses Kapitel präsentiert Kellers Invisible-hand-Theorie des Sprachwandels. Es beginnt mit der Prämisse eines permanenten, nicht zielgerichteten Sprachwandels, der sich als evolutionärer Prozess darstellt. Keller kritisiert dabei bestehende Dichotomien, die Sprachwandel entweder als natürlichen oder künstlichen Prozess betrachten. Der Kapitel untersucht die Voraussetzungen sprachlichen Wandels, die Notwendigkeit einer neuen Theorie und die Einführung der Invisible-hand-Theorie selbst. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Sprachwandels als ein Ergebnis menschlicher Handlungen, die aber nicht deren Intentionen entsprechen. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere kritische Auseinandersetzung.
2. Kritik: Dieses Kapitel analysiert kritische Punkte der Invisible-hand-Theorie. Es hinterfragt die Anwendbarkeit der Theorie auf verschiedene Aspekte des Sprachwandels wie Wortschöpfungen, Selbstisolation von Sprachgemeinschaften und die Prognostizierbarkeit sprachlicher Entwicklungen. Die Kritik bezieht sich auf die Beispiellosigkeit der Theorie, den Vergleich mit anderen Theorien des Sprachwandels und die Frage nach der Berücksichtigung gleichgerichteter Intentionen in der Sprachveränderung. Die verschiedenen Aspekte der Kritik werden detailliert erläutert und diskutiert.
3. Anwendung an konkreten Beispielen: In diesem Kapitel wird die Anwendbarkeit der Invisible-hand-Theorie auf konkrete Beispiele getestet. Es untersucht anhand von Beispielen wie "Friseur/Coiffeur/Hair Stylist", "Weib/Frau" und unterschiedlichen Varietäten des Englischen, wie gut die Theorie die beobachteten sprachlichen Veränderungen erklärt. Dieser Teil vergleicht die theoretischen Aussagen mit empirischen Daten und überprüft die Gültigkeit der Theorie im Kontext realer sprachlicher Entwicklungen. Die Analyse der Beispiele dient der Überprüfung der vorhergehenden Kritikpunkte.
Schlüsselwörter
Invisible-hand-Theorie, Sprachwandel, Sprachvariation, Rudi Keller, Individualkompetenz, Dichotomien, Organismus-Mechanismus-Debatte, Sprachgeschichte, empirische Sprachforschung.
FAQ: Analyse der Invisible-hand-Theorie des Sprachwandels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Invisible-hand-Theorie des Sprachwandels von Rudi Keller. Sie beinhaltet eine Darstellung der Theorie, eine kritische Auseinandersetzung und die Anwendung auf konkrete Beispiele, um die Theorie im Kontext bestehender Ansätze zu bewerten.
Welche Aspekte der Invisible-hand-Theorie werden dargestellt?
Die Darstellung umfasst die Prämisse eines permanenten, nicht zielgerichteten Sprachwandels als evolutionären Prozess. Keller kritisiert dabei Dichotomien, die Sprachwandel als natürlichen oder künstlichen Prozess betrachten. Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen sprachlichen Wandels und die Invisible-hand-Theorie selbst, die den Sprachwandel als Ergebnis menschlicher Handlungen beschreibt, die aber nicht deren Intentionen entsprechen.
Welche Kritikpunkte an der Invisible-hand-Theorie werden behandelt?
Die Kritikpunkte umfassen die Anwendbarkeit der Theorie auf verschiedene Aspekte des Sprachwandels wie Wortschöpfungen, Selbstisolation von Sprachgemeinschaften und die Prognostizierbarkeit sprachlicher Entwicklungen. Die Arbeit vergleicht die Theorie mit anderen Theorien des Sprachwandels und hinterfragt die Berücksichtigung gleichgerichteter Intentionen in der Sprachveränderung. Die Beispiellosigkeit der Theorie und die Extreme Dichotomie werden ebenfalls kritisch beleuchtet.
Welche konkreten Beispiele werden zur Anwendung der Theorie herangezogen?
Die Anwendbarkeit der Theorie wird anhand konkreter Beispiele wie der Entwicklung der Wörter "Friseur", "Coiffeur" und "Hair-Stylist", "Weib" und "Frau", sowie unterschiedlicher Varietäten des Englischen untersucht. Die Analyse vergleicht theoretische Aussagen mit empirischen Daten und überprüft die Gültigkeit der Theorie im Kontext realer sprachlicher Entwicklungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 stellt die Invisible-hand-Theorie vor. Kapitel 2 widmet sich der kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie. Kapitel 3 wendet die Theorie auf konkrete Beispiele an. Kapitel 4 ist ein Schlusskapitel (Zusammenfassung und Ausblick sind nicht explizit genannt).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Invisible-hand-Theorie, Sprachwandel, Sprachvariation, Rudi Keller, Individualkompetenz, Dichotomien, Organismus-Mechanismus-Debatte, Sprachgeschichte, empirische Sprachforschung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Kellers Invisible-hand-Theorie darzustellen, kritisch zu hinterfragen und anhand konkreter Beispiele zu evaluieren. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Theorie im Kontext bestehender Ansätze zur Erklärung von Sprachwandel.
- Quote paper
- Magister Henning Braun (Author), 2005, Kellers Invisible-hand-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/130096