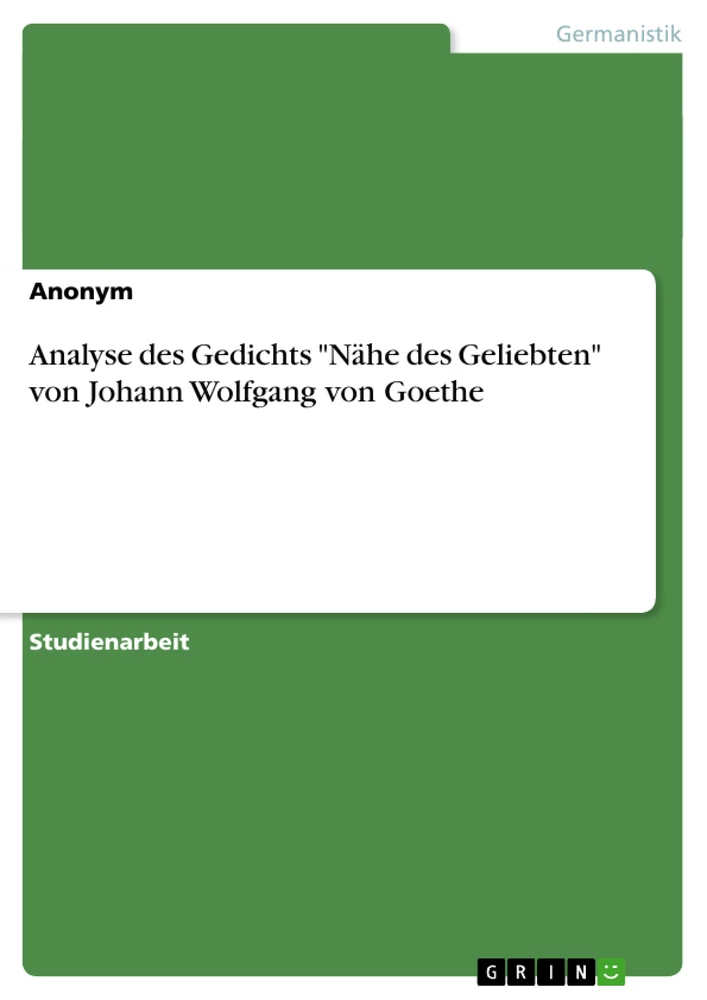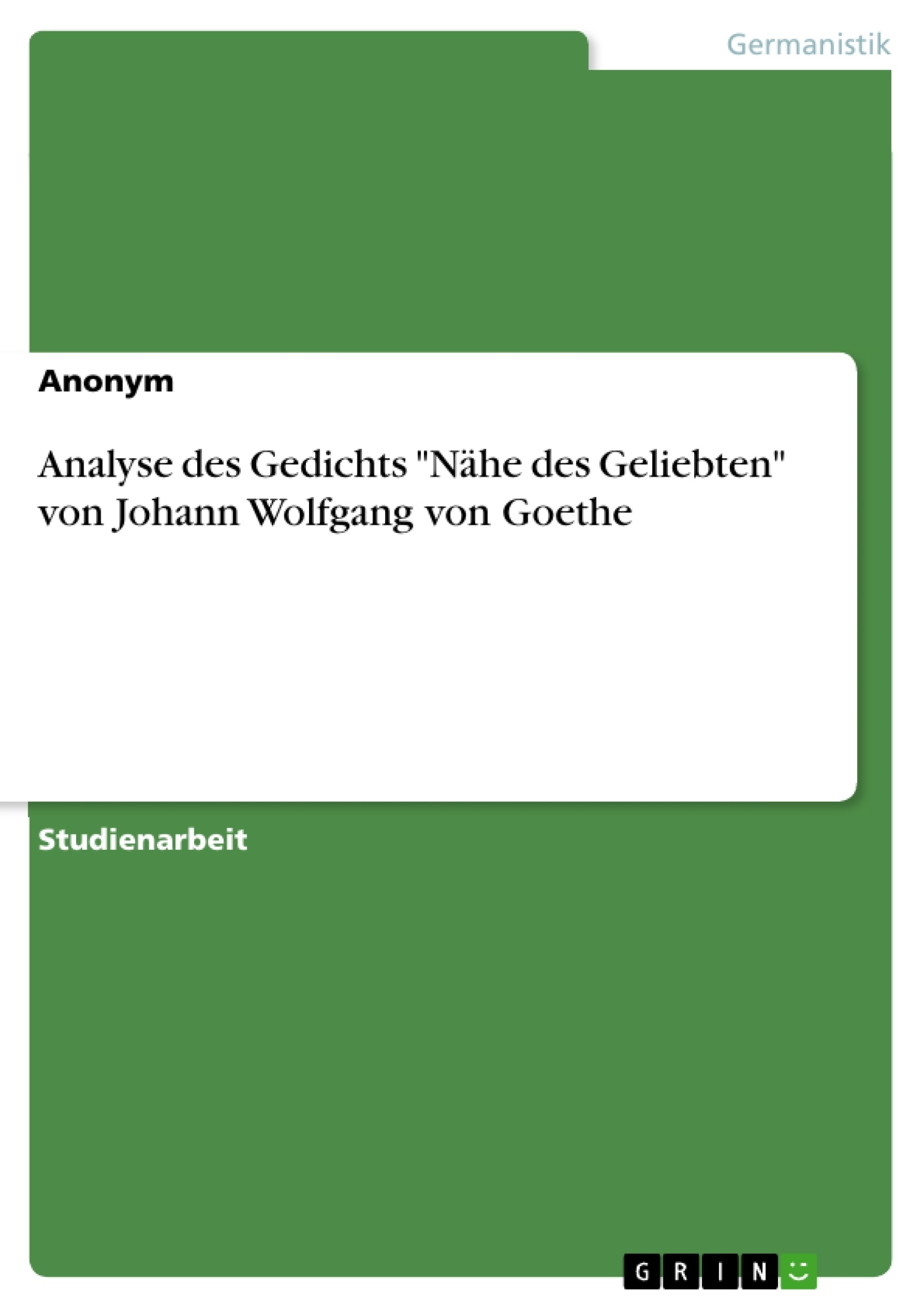„Nähe des Geliebten“ ist ein von Johann Wolfgang von Goethe 1795 verfasstes Kurzgedicht. Es beschreibt die Liebe und die Sehnsucht zu einer entfernten Person. Das Gedicht ist an das Gedicht „Ich denke dein“ angelehnt, welches von der zu damaliger Zeit bekannten Dichterin Friederike Brun verfasst wurde. Ein Freund Goethes, der Komponist Carl-Friedrich Zelter (1758-1832), schrieb dazu eine Melodie. Im Jahr 1799 wurde „Nähe des Geliebten“ von Ludwig van Beethoven vertont, 1834 auch von Josephine Lang (Opus 5). Es zählt zu den bekanntesten musikalisch aufbereiteten Gedichten Goethes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Epocheneinordnung
- Inhaltlicher Aufbau und Formanalyse
- Sprachliche Mittel
- Biographische Bezüge
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Gedichtsanalyse von Goethes „Nähe des Geliebten“ zielt darauf ab, das Gedicht im Kontext seiner Entstehungszeit zu betrachten und seine sprachlichen, formalen und biographischen Aspekte zu untersuchen. Die Analyse beleuchtet die Verbindung zu anderen Werken und den Einfluss der jeweiligen Epoche auf das Gedicht.
- Einordnung des Gedichts in die Epoche der Klassik und Romantik
- Analyse des formalen Aufbaus und der sprachlichen Mittel
- Untersuchung der biographischen Bezüge und möglicher Inspirationen
- Interpretation der Thematik Liebe und Sehnsucht
- Bedeutung der musikalischen Vertonungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Kurzgedicht „Nähe des Geliebten“ von Johann Wolfgang von Goethe ein, das 1795 entstand und die Liebe und Sehnsucht zu einer fernen Person thematisiert. Es wird auf die Anlehnung an Friederike Bruns „Ich denke dein“ und die verschiedenen musikalischen Vertonungen hingewiesen, welche die Bekanntheit des Gedichts unterstreichen.
Epocheneinordnung: Die Einordnung des Gedichts in eine bestimmte Epoche gestaltet sich schwierig, da es zwischen Klassik und aufkommender Romantik steht. Goethes offene Haltung gegenüber der Romantik und die in der Literatur der Zeit immer wichtiger werdende Selbstbestimmung und die Suche nach wahren Werten werden als Kontextualisierung herangezogen. „Nähe des Geliebten“ wird als Bindeglied zwischen traditioneller und emotionaler Literatur interpretiert, wobei die Natur als verbindendes Element und zentrales Motiv der Romantik hervorgehoben wird. Die Symbolik von Mond, Sonne und Meer wird als Ausdruck des Strebens nach Harmonie von Gemüt und Verstand interpretiert.
Inhaltlicher Aufbau und Formanalyse: Das vierstrophige Gedicht mit jambischem Aufbau und Kreuzreimen zeichnet sich durch seine melodische Struktur aus. Der Wechsel von männlichen und weiblichen Kadenzen und die regelmäßigen Enjambements tragen zum lyrischen Charakter bei. Die Wiederholung der Versanfänge („Ich denke dein“, „Ich sehe dich“, „Ich höre dich“) verstärkt die liedhafte Wirkung und unterstreicht die Sehnsucht des lyrischen Ichs nach dem Geliebten. Das Gedicht beschreibt die gefühlte Nähe trotz räumlicher Distanz und steigert die Gefühle in phantasievolle Sinneswahrnehmungen. Die finale Strophe betont die gefühlte Verbundenheit, die die reale Entfernung überwindet. Der Bezug auf Friederike Bruns „Ich denke dein“ wird hervorgehoben.
Sprachliche Mittel: Goethe verwendet Stilmittel wie Alliterationen, Anaphern und Enjambements, um den Lesefluss und die liedhafte Wirkung zu verstärken. Metaphorische Umschreibungen und Personifikationen schaffen eine gefühlsbetonte Atmosphäre und fördern die emotionale Beteiligung des Lesers. Der Gebrauch konjunktivischer Formen unterstreicht die Sehnsucht und die Spannung zwischen Illusion und Realität.
Biographische Bezüge: Das Gedicht steht in engem Zusammenhang mit Friederike Bruns „Ich denke dein“, welches Goethe als Inspiration diente und welches er überarbeitete. Die musikalischen Vertonungen durch Zelter und Beethoven verstärken die künstlerische Aussagekraft. Die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller wird erwähnt, und es wird spekuliert, ob Schiller der Adressat des Gedichts sein könnte.
Schlüsselwörter
Goethe, Nähe des Geliebten, Klassik, Romantik, Liebeslyrik, Sehnsucht, Sprachliche Mittel, Formanalyse, Friederike Brun, musikalische Vertonung, Anapher, Metapher, Illusion, Realität.
Häufig gestellte Fragen zur Gedichtsanalyse von Goethes „Nähe des Geliebten“
Was ist der Inhalt dieser Gedichtsanalyse?
Diese Analyse untersucht Goethes Gedicht „Nähe des Geliebten“ umfassend. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Epocheneinordnung, eine inhaltliche und formale Analyse, eine Betrachtung der sprachlichen Mittel, biographische Bezüge und eine abschließende Bewertung. Die Analyse beleuchtet die Verbindung zu anderen Werken, insbesondere zu Friederike Bruns „Ich denke dein“, und den Einfluss der Epoche auf das Gedicht.
Welche Epoche wird in der Analyse betrachtet?
Die Einordnung des Gedichts gestaltet sich schwierig, da es zwischen Klassik und Romantik steht. Die Analyse betrachtet es als Bindeglied zwischen diesen Epochen und hebt die Bedeutung der aufkommenden Selbstbestimmung und der Suche nach wahren Werten in der damaligen Literatur hervor. Die Natur wird als zentrales Motiv der Romantik und verbindendes Element interpretiert.
Wie ist der formale Aufbau des Gedichts?
Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit jambischem Aufbau und Kreuzreimen. Der Wechsel von männlichen und weiblichen Kadenzen und die regelmäßigen Enjambements tragen zu seiner melodischen Struktur bei. Die Wiederholung von Versanfängen verstärkt die liedhafte Wirkung und unterstreicht die Sehnsucht des lyrischen Ichs.
Welche sprachlichen Mittel verwendet Goethe?
Goethe verwendet Alliterationen, Anaphern und Enjambements, um den Lesefluss und die liedhafte Wirkung zu verstärken. Metaphorische Umschreibungen und Personifikationen schaffen eine gefühlsbetonte Atmosphäre. Konjunktivische Formen unterstreichen die Sehnsucht und die Spannung zwischen Illusion und Realität.
Welche biographischen Bezüge werden hergestellt?
Die Analyse stellt einen engen Zusammenhang zwischen „Nähe des Geliebten“ und Friederike Bruns „Ich denke dein“ her. Goethe verwendete Bruns Gedicht als Inspiration. Die musikalischen Vertonungen durch Zelter und Beethoven werden ebenfalls thematisiert, ebenso wie die mögliche Beziehung zu Schiller.
Welche Themen werden im Gedicht behandelt?
Das zentrale Thema ist die Liebe und Sehnsucht nach einem fernen Geliebten. Das Gedicht thematisiert die gefühlte Nähe trotz räumlicher Distanz und steigert die Gefühle in phantasievolle Sinneswahrnehmungen. Die Symbolik von Mond, Sonne und Meer wird als Ausdruck des Strebens nach Harmonie von Gemüt und Verstand interpretiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Nähe des Geliebten, Klassik, Romantik, Liebeslyrik, Sehnsucht, sprachliche Mittel, Formanalyse, Friederike Brun, musikalische Vertonung, Anapher, Metapher, Illusion, Realität.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse umfasst die Kapitel: Einleitung, Epocheneinordnung, Inhaltlicher Aufbau und Formanalyse, Sprachliche Mittel, Biographische Bezüge und Bewertung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Analyse des Gedichts "Nähe des Geliebten" von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129897