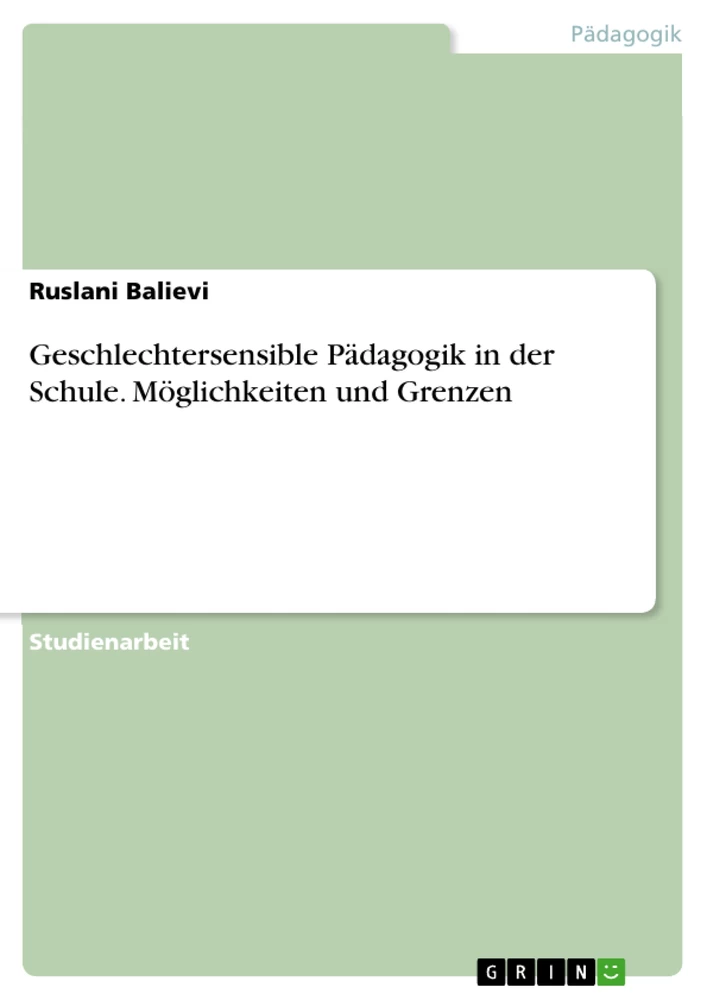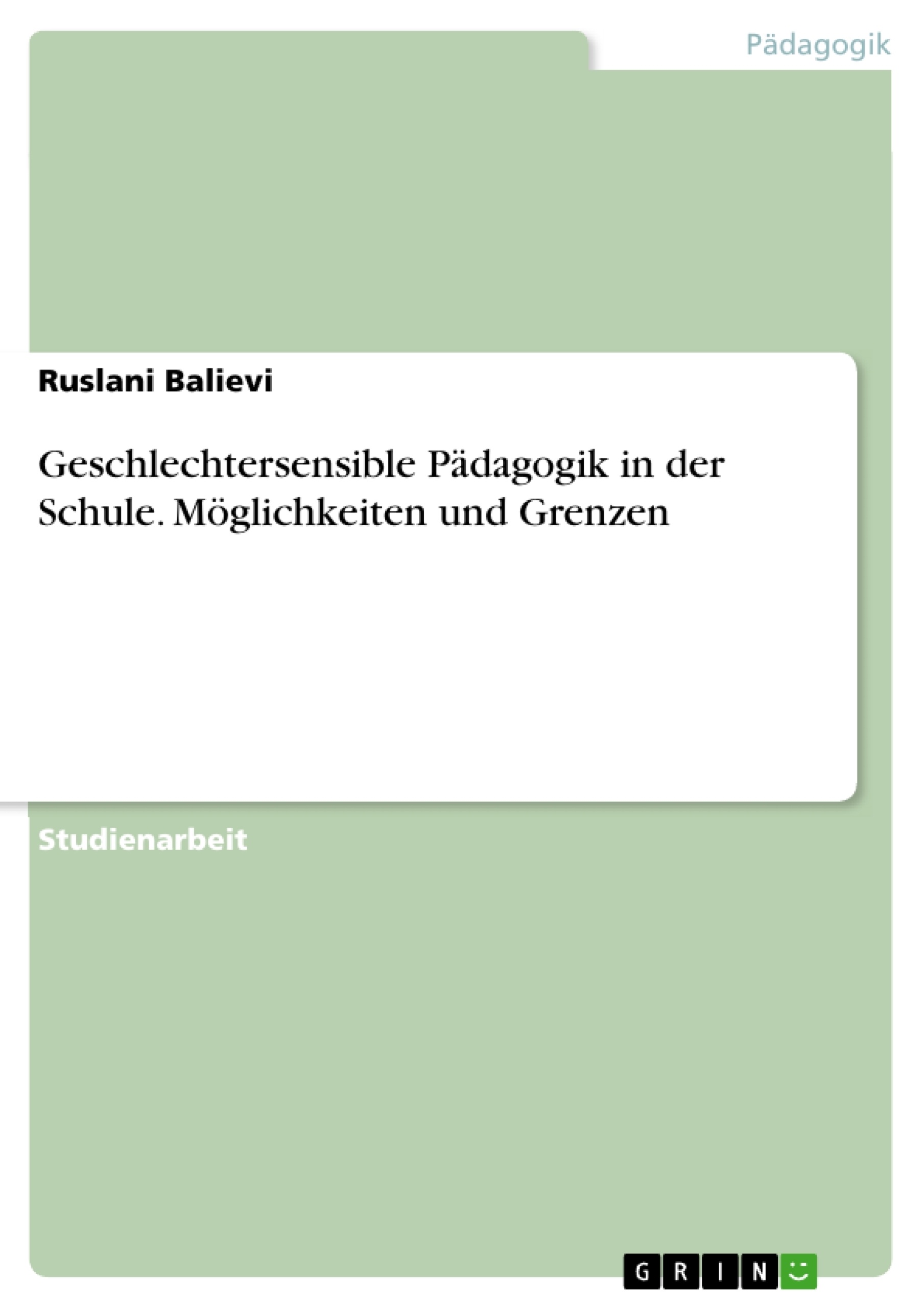In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, in welcher Weise die Schule dazu beiträgt, die zwischen den Geschlechtern existierende Differenzen zu verstärken beziehungsweise hervorzuheben und wie in einer geschlechtersensiblen Pädagogik eine ungewollte Reifizierung von Geschlecht vermieden werden kann.
Der soziale Wandel im 21. Jahrhundert unterliegt vielen Einflussfaktoren – von zunehmender Globalisierung über demografischem Wandel bis hin zur Modernisierung. Der Prozess des Wandels variiert je nach Gesellschaft, auch wenn sich dabei auf der internationalen Ebene Gemeinsamkeiten erkennen lassen. Auch das Verständnis von Geschlecht und die damit verbundenen Rollen haben sich im Laufe der Zeit verändert.
Heute kann man sich in einigen westlichen Ländern ein "drittes Geschlecht" offiziell in den Personalausweis eintragen lassen, was vor einigen Jahren unvorstellbar wäre. Auch die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland ist ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft sich von der Heteronormativität und Geschlechterstereotypen loslöst.
Trotz der positiven Entwicklung des Geschlechtsverständnisses in den westlichen Ländern wird das Thema „Geschlecht“ nach wie vor sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft kontrovers diskutiert. Die Zweigeschlechtlichkeit scheint die soziale Ordnung einer Gesellschaft zu dominieren.
Bei der Geburt wird dem Säugling anhand seines Genitals ein Geschlecht zugewiesen: weiblich oder männlich. Wie bereits erwähnt, ist die Eintragung des "dritten Geschlechts" erst seit vor kurzem in einigen Ländern möglich. Dies stellt aber eine Ausnahme dar. Schon mit der Zuweisung eines Geschlechts beginnt die Sozialisation des Kindes. Es eignet sich bestimmte Normen und Werte der jeweiligen Gesellschaft an und lernt, wie es sich zu verhalten hat, um als ein Mann oder eine Frau wahrgenommen zu werden.
Die Zuordnung nach "weiblich" und "männlich" brachte schon immer und bringt immer noch Benachteiligung mit sich, die sich in vielen Bereichen des Lebens beobachten lassen. Beispielsweise verdienen die Frauen in denselben Positionen immer noch weniger als Männer.
Neben der Familie spielt auch die sekundäre Sozialisationsinstanz Schule eine bedeutende Rolle, wenn es um die Entwicklung des Geschlechterbewusstseins bei den Kindern geht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschlecht als soziale Konstruktion
- 2.1. Sex und Gender
- 2.2. Doing Gender
- 2.3. Einfluss von Geschlecht auf schulische Lernprozesse
- 3. Geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext
- 3.1. Forderungen nach Jungenförderung
- 4. Geschlechtersensibler Unterricht aus Sicht von Plaimauer
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Schule in der Konstruktion und Reproduktion von Geschlechterungleichheiten. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen geschlechtersensibler Pädagogik aufzuzeigen und Wege zur Vermeidung ungewollter Reifizierung von Geschlecht zu diskutieren.
- Geschlecht als soziale Konstruktion (Sex vs. Gender, Doing Gender)
- Geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext
- Jungen- und Mädchenförderung: Kritik und Perspektiven
- Geschlechtersensible Pädagogik: Konzepte und Strategien
- Der Einfluss von Geschlecht auf schulische Lernprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtersensiblen Pädagogik ein und beschreibt den gesellschaftlichen Wandel im Verständnis von Geschlecht. Sie betont die Kontroversen um das Thema und die anhaltende Dominanz der Zweigeschlechtlichkeit, verweist auf die Bedeutung der Sozialisation und die Rolle der Schule in der Entwicklung des Geschlechterbewusstseins. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie die Schule Geschlechterunterschiede verstärkt und wie geschlechtersensible Pädagogik dies verhindern kann. Die Struktur der Arbeit wird kurz umrissen.
2. Geschlecht als soziale Konstruktion: Dieses Kapitel differenziert zwischen „Sex“ (biologisches Geschlecht) und „Gender“ (sozial konstruiertes Geschlecht). Es erklärt den Prozess des „Doing Gender“, in dem Geschlecht durch alltägliche Interaktionen hergestellt und reproduziert wird. Der Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen auf die Konstruktion von Geschlecht wird beleuchtet und die Problematik der Naturalisierung von Geschlechterunterschieden kritisch hinterfragt. Die unterschiedlichen biologischen Faktoren des Geschlechts werden ebenfalls diskutiert, um die soziale Konstruktion stärker hervorzuheben.
3. Geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext: Kapitel 3 analysiert statistische Daten über geschlechtsbedingte Benachteiligung im Bildungssystem, insbesondere die Benachteiligung von Mädchen. Es wird die Kritik an der Forderung nach Jungenförderung diskutiert, die auf die Annahme basiert, Jungen seien nun benachteiligt, nachdem Mädchen sie in bestimmten Bereichen überholt haben. Der Fokus liegt darauf, die komplexen und oft widersprüchlichen Mechanismen der Ungleichheit aufzuzeigen.
4. Geschlechtersensibler Unterricht aus Sicht von Plaimauer: Dieses Kapitel präsentiert die Ansichten von Christine Plaimauer zu gendersensiblem Unterricht. Plaimauers Argument, dass gendersensibler Unterricht nicht als spezieller Unterricht, sondern als eine Haltung verstanden werden sollte, die Unterschiede sensibel wahrnimmt, Stigmatisierungen thematisiert und auf spezifische Bedürfnisse beider Geschlechter eingeht, wird erläutert und analysiert. Die Bedeutung einer solchen Haltung für die pädagogische Praxis wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Geschlechtersensible Pädagogik, Gender, Sex, Doing Gender, Geschlechterungleichheit, Schule, Sozialisation, Jungenförderung, Mädchenförderung, Geschlechterstereotypen, Heteronormativität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Geschlechtersensible Pädagogik im Schulkontext"
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Rolle der Schule bei der Konstruktion und Reproduktion von Geschlechterungleichheiten. Sie beleuchtet Möglichkeiten und Grenzen geschlechtersensibler Pädagogik und diskutiert Wege zur Vermeidung ungewollter Reifizierung von Geschlecht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Geschlecht als soziale Konstruktion (Sex vs. Gender, Doing Gender), geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext, Jungen- und Mädchenförderung (Kritik und Perspektiven), geschlechtersensible Pädagogik (Konzepte und Strategien) und den Einfluss von Geschlecht auf schulische Lernprozesse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Geschlecht als soziale Konstruktion, Geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext, Geschlechtersensibler Unterricht aus Sicht von Plaimauer und Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den gesellschaftlichen Wandel im Verständnis von Geschlecht. Kapitel 2 differenziert zwischen Sex und Gender und erklärt „Doing Gender“. Kapitel 3 analysiert geschlechtsbedingte Benachteiligung im Bildungssystem und die Kritik an der Jungenförderung. Kapitel 4 präsentiert Plaimauers Sicht auf gendersensiblen Unterricht. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Was versteht die Arbeit unter "Geschlecht als soziale Konstruktion"?
Die Arbeit unterscheidet zwischen „Sex“ (biologischem Geschlecht) und „Gender“ (sozial konstruiertem Geschlecht). Sie erklärt „Doing Gender“ als den Prozess, in dem Geschlecht durch alltägliche Interaktionen hergestellt und reproduziert wird. Der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Erwartungen auf die Konstruktion von Geschlecht wird beleuchtet, und die Problematik der Naturalisierung von Geschlechterunterschieden kritisch hinterfragt.
Wie wird geschlechtsbedingte Benachteiligung im schulischen Kontext dargestellt?
Kapitel 3 analysiert statistische Daten über geschlechtsbedingte Benachteiligung im Bildungssystem, insbesondere die Benachteiligung von Mädchen. Es wird die Kritik an der Forderung nach Jungenförderung diskutiert, die auf der Annahme basiert, Jungen seien nun benachteiligt, nachdem Mädchen sie in bestimmten Bereichen überholt haben. Der Fokus liegt auf den komplexen und oft widersprüchlichen Mechanismen der Ungleichheit.
Welche Rolle spielt Christine Plaimauer in der Arbeit?
Kapitel 4 präsentiert die Ansichten von Christine Plaimauer zu gendersensiblem Unterricht. Ihre Argumentation, dass gendersensibler Unterricht nicht als spezieller Unterricht, sondern als eine Haltung verstanden werden sollte, die Unterschiede sensibel wahrnimmt, Stigmatisierungen thematisiert und auf spezifische Bedürfnisse beider Geschlechter eingeht, wird erläutert und analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Geschlechtersensible Pädagogik, Gender, Sex, Doing Gender, Geschlechterungleichheit, Schule, Sozialisation, Jungenförderung, Mädchenförderung, Geschlechterstereotypen, Heteronormativität.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen geschlechtersensibler Pädagogik aufzuzeigen und Wege zur Vermeidung ungewollter Reifizierung von Geschlecht zu diskutieren. Die Arbeit untersucht, wie die Schule Geschlechterunterschiede verstärkt und wie geschlechtersensible Pädagogik dies verhindern kann.
- Quote paper
- Ruslani Balievi (Author), 2021, Geschlechtersensible Pädagogik in der Schule. Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1298436