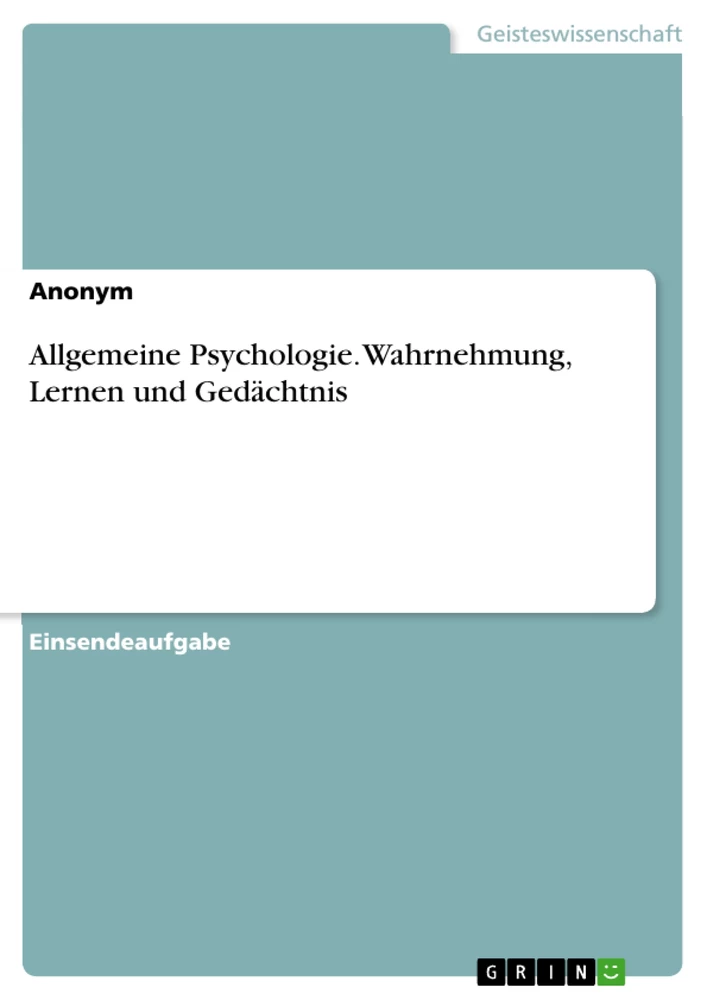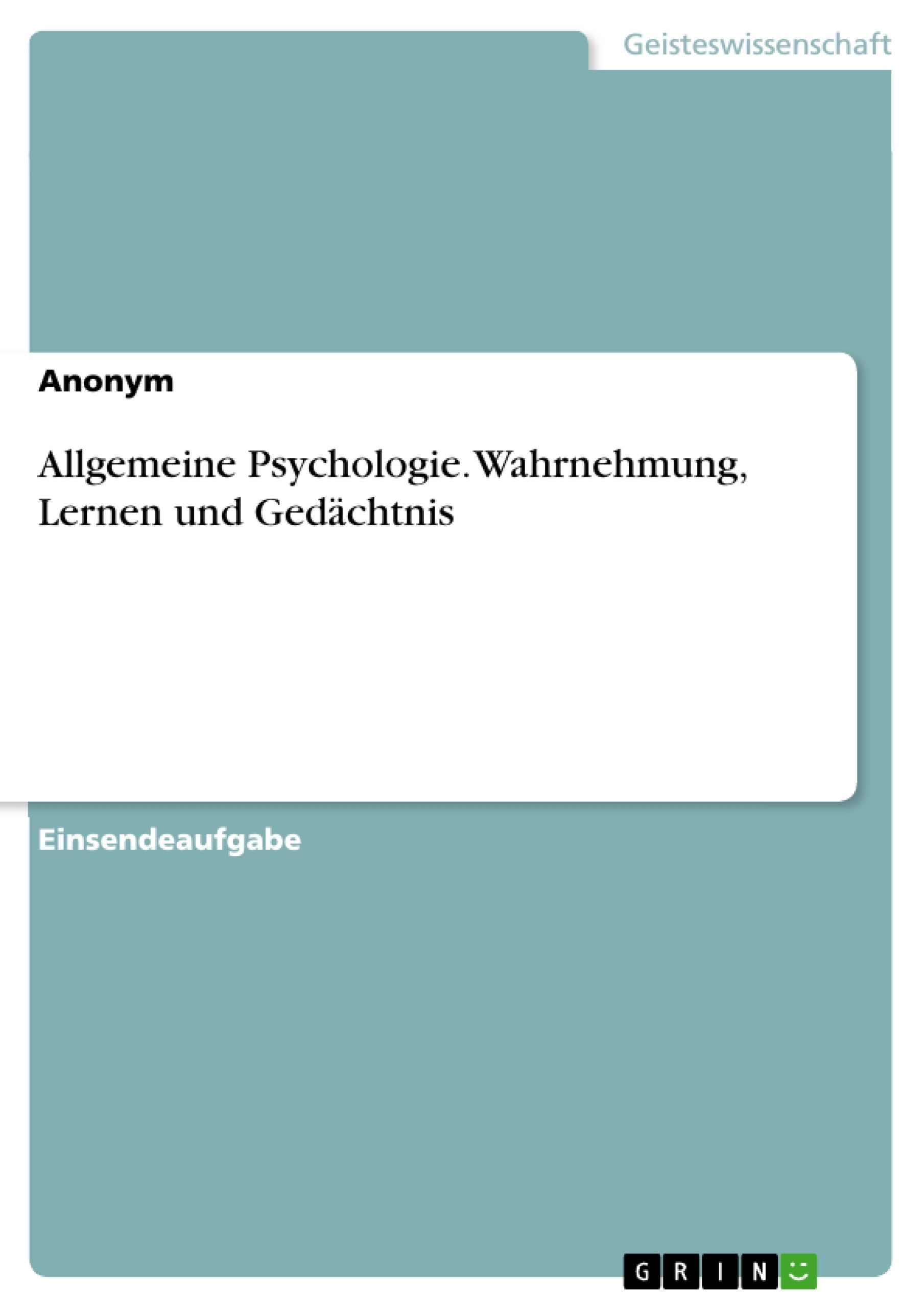Wie verläuft Lernen? Wie kann das Modelllernen in der Entwicklung von Führungskräften eingesetzt werden und was für eine Rolle spielt die Führungskraft im Unternehmen?
Das Ziel der Hausarbeit besteht darin, das Phänomen des Lernens näher zu betrachten und die verschiedenen Formen des Lernens darzustellen.
Diese Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Im Anschluss an diese Einleitung wird der Terminus Lernen näher beleuchtet. Intendiert wird darin die Erörterung diverser Formen des Lernens. Im darauffolgenden Kapitel liegt der Fokus auf dem Modelllernen und dem Einsatz bei der Entwicklung von Führungskräften. Zur praktischen Vertiefung werden die vier basalen Prozesse, die zur Entstehung von Imitation zuständig sind, beschrieben, um später in diesem Zusammenhang die Rolle von Führungskräften einer Unternehmung zu diskutieren. Im Anschluss erfolgt ein Resümee der wichtigsten Erkenntnisse in einem Schlusswort.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungsverzeichnis
2 Abbildungsverzeichnis
3 Vermerk
4 Einleitung
4.1 Problemstellung
4.2 Zielsetzung
4.3 Aufbau der Arbeit
5 Lernen – Die Grundlagen
5.1 Begriffsdefinition
5.2 Historische Wurzeln des Lernens
5.3 Lernformen
5.3.1 Klassische Konditionierung
5.3.2 Operante Konditionierung
5.3.3 Beobachtungslernen
5.3.4 Habituationslernen
5.4 Zusammenfassung
6 Kritische Rolle der Führungskräfte
6.1 Begriffsabgrenzung Leadership
6.2 Transformationale Führung
6.3 Zusammenfassung
7 Modellernen in der Unternehmung
7.1 Abgrenzung des Begriffs Modellernen und Ihre essenzielle Rolle im Unternehmen
7.2 Kriterien für ein erfolgreiches Modellernen in der Führungskräfteentwicklung
7.3 Zusammenfassung
8 Fazit und Ausblick
9 Literaturverzeichnis
1 Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Aufl. Auflage
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise
z. B. Zum Beispiel
vgl. vergleiche
2 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Transformationale Führung und deren Mehrwert
Abbildung 2: Beteiligte Prozesse beim Beobachtungslernen
3 Vermerk
Aus Gründen der Lesbarkeit wird das generische Maskulinum eingesetzt. Frauen- und andere Geschlechtsidentitäten sind explizit miteinzubeziehen, sofern dies für die Behauptung erforderlich ist.
4 Einleitung
4.1 Problemstellung
Die Lernfähigkeit war in der Evolution schon immer eine der wichtigsten phylogenetischen Fähigkeiten von Organismen, um sich an die Umwelt anzupassen. Diese bedeutet für die meisten, sich an eine verändernde Umwelt anzugleichen, und ein damit verbundenes Überleben. Die meisten Menschen assoziieren den Begriff sofort mit der Schule, in der Vokabeln, historische Daten oder das Rechnen mit Zahlen gelernt werden. Schulisches Lernen ist jedoch nur ein kleiner Teil dessen, was Lernen wirklich ausmacht.1
Babys lernen, wie sie sich bewegen, und Kleinkinder beispielsweise, wie sie richtig laufen und sprechen. Sie lernen die Regeln spielend und gesellig kennen, während sie auch motorische Fähigkeiten wie Radfahren oder Schwimmen üben. Erwachsene lernen, beschäftigen sich mit neuen Technologien oder verfolgen, wie die Funktionsweise von neuen Computerprogrammen ist, während ältere Erwachsene üben, mit körperlichen und geistigen Behinderungen umgehen zu können und wie Geräte zur Unterstützung ihres täglichen Lebens genutzt werden können.2
Kurz gesagt – Menschen lernen ihr ganzes Leben lang. Schließlich ist Lernen zweifellos eine der Eigenschaften menschlicher Aktivitäten, denn ohne das Erlernen kultureller Fähigkeiten, Überzeugungen und Verhaltensnormen wäre es unmöglich, eine erfolgreiche Anpassung einer Gesellschaft zu ermöglichen.3
4.2 Zielsetzung
Das Ziel der Hausarbeit besteht darin, das Phänomen des Lernens näher zu betrachten und die verschiedenen Formen des Lernens darzustellen. Aus diesem Grund wird versucht, die folgenden Fragen zu beantworten:
- Wie verläuft Lernen?
- Wie kann das Modelllernen in der Entwicklung von Führungskräften eingesetzt werden und was für eine Rolle spielt die Führungskraft im Unternehmen?
4.3 Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Im Anschluss an diese Einleitung wird in Kapitel 5 der Terminus Lernen näher beleuchtet. Intendiert wird darin die Erörterung diverser Formen des Lernens. In Kapitel 6 liegt der Fokus auf dem Modelllernen und dem Einsatz bei der Entwicklung von Führungskräften. Zur praktischen Vertiefung werden die vier basalen Prozesse, die zur Entstehung von Imitation zuständig sind, beschrieben, um später in diesem Zusammenhang die Rolle von Führungskräften einer Unternehmung zu diskutieren. In Kapitel 5 erfolgt ein Resümee der wichtigsten Erkenntnisse in einem Schlusswort.
5 Lernen – Die Grundlagen
In Kapitel 5 werden die Grundlagen des Lernens thematisiert. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erklärung der Definition. Ferner werden die verschiedenen Formen des Lernens wiedergegeben.
5.1 Begriffsdefinition
Eine allgemeingültige Definition von Lernen gibt es nicht. In der Psychologie wird Lernen als ein Prozess beschrieben, der aufgrund von Erfahrungen langfristige Veränderungen des Verhaltenspotenzials bewirkt. Diese auf den ersten Blick umständlich erscheinende Definition ist leicht verständlich, wenn sie in einzelne Komponenten heruntergebrochen wird. Lernen ist ein Veränderungsprozess. Das Resultat dieses Prozesses stellt die Veränderung des Verhaltenspotenzials dar. Lernen muss sich jedoch nicht immer direkt durch Verhaltensänderungen ausdrücken, daher begnügt sich die Definition damit, dass sich das Verhaltenspotential des Lernenden ändert. Die Fähigkeit zu lernen, ermöglicht es, sich an aktuelle, ständig ändernde Anforderungen anzupassen sowie auf Umweltereignisse zu reagieren.4
Dieses Potenzial ist zwar angeboren, jedoch gestaltet sich die Nutzung individuell. Obwohl alle Menschen lernen, können nicht alle ihr Lernpotenzial frei entfalten. Ein völliger Verzicht, das eigene Lernpotenzial nicht zu nutzen, ist undenkbar. Lernen ist Teil des Lebens eines jeden Menschen, auch wenn dies auch des Öfteren unbewusst und im Vorbeigehen sowie seltener absichtlich oder vorsätzlich verläuft – Menschen müssen lernen. Beispiele für das Lernen sind sehr vielfältig: vom Auswendiglernen eines Lieds zum Erlangen eines neuen Wortschatzes bis hin zum Erwerb spezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Aufzählung dieser Beispiele zeigt, wie unterschiedlich das Lernen sein kann und dass wir stets und überall lernen.5
Im Mittelpunkt der Psychologie des Lernens steht die systematische Untersuchung von Lernprozessen: Wie lernen wir und was ist dafür erforderlich? Wann haben wir beispielsweise besonders gut gelernt? Der Lernprozess basiert oft auf experimenteller Forschung. Ein typisches Lernexperiment besteht aus Lernphase und Abrufphase. Ferner findet auch noch eine Differenzierung statt, ob ein Testteilnehmer absichtlich lernt oder er ungewollt – ohne seine Absicht – lernt beziehungsweise ein inzidentelles Lernen stattfindet.6
Lernen kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen. Oftmals sind Assoziationen die Grundlagen des Lernprozesses. Unter assoziativem Lernen werden allgemein Lernformen verstanden, bei denen Ereignisse, Reize, Verhaltensweisen etc. als zusammengehörig identifiziert, wahrgenommen oder interpretiert werden. Unter assoziativem Lernen wird insbesondere die klassische und operante Konditionierung zusammengefasst. Eine solche Lernform beschreibt die Bildung neuronaler Verbindungen zwischen neutralen Reizen und sekundären Reizen, die positive oder negative Auswirkungen auf den Organismus haben.7
5.2 Historische Wurzeln des Lernens
Die Lernpsychologie ist historisch eng mit dem Begriff der Assoziation verwandt.
Dieser Begriff existiert schon lange und erschien bereits bei Aristoteles.
Er differenzierte drei Prinzipien der Assoziationsbildung: zeitliches Zusammenfließen (Kontiguitätsprinzip), Ähnlichkeit und Kontrast. Dieses Prinzip beschreibt die Assoziation zweier Ereignisse oder Dinge, wenn sie wiederholt und zeitlich benachbart sind. Als ein Beispiel dieses Kontiguitätsprinzips kann das Warten im Wartezimmer beim Zahnarzt herangezogen werden. Für manche Menschen kann allein der Lärm eines Zahnarztbohrers Schweißausbrüche verursachen, da dieses Geräusch früher mit unangenehmen Erfahrungen assoziiert wurde.8
Basierend auf diesen Ideen entwickelte sich im Laufe der Zeit die philosophische Richtung Assoziationismus. Diese Richtung besagt, dass psychische Prozesse wesentlich auf der Bildung von Assoziationen beruhen. Diese historischen Wurzeln bildeten den Hintergrund, vor dem die Pioniere wie Iwan P. Pawlow und Edward L. Thorndike die systematische, empirisch-experimentelle Untersuchung vom Lernen initiiert haben. Diese bahnbrechenden Errungenschaften in der assoziativen experimentellen Psychologie haben sich vor allem in den USA etabliert, wobei diese Psychologierichtung unter dem Namen Behaviorismus zusammenzufassen ist. Die Kernidee des Behaviorismus besteht darin, dass nur Verhalten Gegenstand der Untersuchung ist und die Gegebenheiten gefunden werden müssen, um eine Änderung des Verhaltens zu bewirken und eine Anpassung an die Umweltbedingungen zu ermöglichen. Dabei ist der Behaviorismus eng mit der Psychologie des Lernens verknüpft, da wie bereits geschildert das Lernen als langfristige, erfahrungsbezogene Verhaltensänderungen definiert wird.9
5.3 Lernformen
Die Lernpsychologie befasst sich mit den Mechanismen des Wissenserwerbs (Lernen) und Speicherns (Gedächtnis). Grundsätzlich lassen sich vier Arten des Lernens differenzieren: assoziatives Lernen, klassische Konditionierung, operante Konditionierung und Beobachtungslernen. Die Lernforschung wird hauptsächlich von zwei Richtungen beeinflusst:
- Der Behaviorismus pointiert externe Ereignisse und versucht, Lernen ohne Zwischenvariablen (z. B. Motivation) zu veranschaulichen.
- Der Kognitivismus setzt sich hauptsächlich mit der menschlichen Informationsverarbeitung und höheren kognitiven Funktionen auseinander. Im Vergleich zum Behaviorismus wird das menschliche Verhalten im Kognitivismus nicht durch Umweltbedingungen, sondern durch kognitive Prozesse erklärt. Kern der Forschung sind die inneren Prozesse des Menschen: die Art und Weise, wie Menschen Informationen aufnehmen, verarbeiten, verstehen und sich diese merken.10
5.3.1 Klassische Konditionierung
Die klassische Konditionierung ist eine Grundform des Lernens, bei der ein Stimulus oder Ereignis das Eintreten eines anderen Stimulus oder Ereignisses vorhersagt. Dabei folgt auf ein Ereignis ein weiteres bestimmtes Ereignis. Der Lernmechanismus der klassischen Konditionierung wurde von Iwan Pawlow entdeckt. Er wollte die chemische Zusammensetzung von Verdauungssäften (z. B. Speichel) primär analysieren und nicht Verhalten und Lernmechanismen.11
In seinen Experimenten beobachtete er jedoch, dass Hunde damit anfingen, zu speicheln, bevor sie Nahrung spüren (sehen oder riechen) konnten. Dabei war es ein neutraler Reiz, auf den Hunde reagierten und der die Verdauungsreaktion stimuliert hatte. In späteren Experimenten verwendete Pawlow eine Glocke als neutralen Stimulus, wobei viele klassische Phänomene der klassischen Konditionierung erforscht werden konnten.12
Diese durch die Glocke ausgelöste antizipative Reaktion des Speichels nannte er einen konditionierten Reflex. Der Kern der klassischen Konditionierung ist demzufolge der Lernreflex. Ein Reflex ist eine ungelernte Reaktion, die dabei durch bestimmte Reize ausgelöst wird und biologisch kurativ ist. Da das Verursachen des Speichelflusses in Gegenwart von Nahrung nicht erlernt, sondern ein Reflex ist, wird diese Reaktion als unkonditionierte Reaktion beschrieben.13
Ein Zahnarztbesuch kann für diese Wirksamkeit als Beispiel herangezogen werden. Der Zahnarztbohrer verursacht häufig Schmerzen und es tritt die Angst auf, dass die Schmerzen anhalten könnten. Kurz bevor der Zahnarzt seine Arbeit mit dem Bohrer verrichtet, wird ein Bohrgeräusch wahrgenommen, mit dem das anschließende Schmerzempfinden verknüpft wird, ehe der Bohrer tatsächlich angewendet wird. In einigen Fällen kann auch nur schon das Wort „Zahnarzt“ mit der jeweiligen Vorstellung ein Unbehagen auslösen. Als weiteres Beispiel können Asthmaanfälle durch nicht allergene Artikel herangezogen werden. Asthma beginnt oft als eine allergische Reaktion auf bestimmte, allergieauslösende Stoffe wie z. B. Staub oder Tierhaare. Sobald diese Allergene mehrmals in Begleitung eines nicht allergenen Reizes stehen und auf diesen konditioniert wurden, kann dieser allergisch wirken. So kann nur schon der Anblick einer Katze im Nebenzimmer oder auch nur das Bild einer Katze bei Allergikern zu Atemproblemen führen. Manchmal können Menschen in Angst oder Panik geraten, nur wenn schon über Katzen gesprochen wird.14
5.3.2 Operante Konditionierung
Bei der klassischen Konditionierung wird ein vorheriger neutraler Reiz mit einem bestehenden Reiz kombiniert. Bei der operanten Konditionierung wird hingegen eine neue Verhaltensweise erlernt. Operantes Verhalten ist instrumentell, weil das Verhalten Veränderungen und somit Folgen auf die Umgebung bewirkt. Bei der operanten Konditionierung wird davon ausgegangen, dass die Belohnung eines bestimmten Verhaltens die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass sich dieses wiederholen wird.15
Thorndike (1898) führte das erste Experiment Ende des 19. Jahrhunderts durch, aber Skinners Forschung besitzt eine größere Bekanntheit. Bei seinem Experiment wird ein hungriges Tier (normalerweise eine Maus oder Taube) in einem leeren Käfig (Skinner-Box) eingeschlossen. Außer dem Tier gibt es nur ein Panel mit Knöpfen. Durch das Drücken des Panels wird Nahrung (Belohnung) in das Gehege gelegt. Im ersten Schritt drückt das Tier den Knopf zunächst per Zufall, dann wird das Drücken des Knopfes häufiger, weil es merkt, dass durch das Betätigen des Knopfes die Belohnung in Form von Futter auftritt.16
Um einen Verstärkungseffekt zu erzielen, dürfen die erwartete Verhaltensweise und Belohnung nicht zu weit auseinanderliegen. Heutzutage ermöglichen Online-Angebote eine operante Konditionierung. Zum Beispiel sind viele Computerspiele vollständig nach dem Muster der operanten Konditionierung konstruiert: Spieler merken schnell, welches Verhalten ihnen einen Vorteil verschafft und zu Punkten führt. Wenn sie besonders gute Ergebnisse erzielt haben (beispielsweise das Erreichen eines neuen Levels), erhält der Spieler die Ehre bzw. einen zusätzlichen Bonus. Dieses eindrucksvolle Beispiel zeigt, wie dieser operante Prozess auf die Süchtigkeit eines Spielers wirkt. Dabei erweist sich ein Abbruch einer Session als äußert schwierig. Klassische und operante Konditionierung gehören zu den Grundprinzipien nicht nur des tierischen, sondern auch des menschlichen Verhaltens. Der Mensch ist im Grunde eine Black Box, die sich einfach definieren lässt. Die Mechanismen basieren auf einem hochkomplexen Spiel von Motiven, Moralvorstellungen, Einstellungen sowie äußeren Faktoren. Es ist jedoch unmöglich, zu leugnen, dass Menschen sich mittels Belohnung und Verhaltensverstärkern indoktrinieren lassen.17
Die Prinzipien der operanten Konditionierung sind nicht nur im Rahmen von Computerspielen anwendbar, sondern auch bei der Implementierung von Belohnungs- und Motivationssystemen in Unternehmen. Da die Verstärker leistungssteigernd wirken, bieten Firmen ihren Mitarbeitern eine Gewinnbeteiligung oder Anteile an der Firma an. Unternehmen im Allgemeinen und Manager im Besonderen achten auf eine bedingte Verstärkung. Leistungsziele werden in Zielverträgen so detailliert wie möglich definiert und mit klar definierten Belohnungen verbunden. Idealerweise sollten Führungskräfte nicht nach einer vorgegebenen Zeit belohnen, sondern unmittelbar nach dem Erreichen der Ergebnisse.18
5.3.3 Beobachtungslernen
Menschen und Tiere lernen nicht nur, wenn sie miteinander agieren oder auf Reize reagieren, vielmehr lernen sie auch durch das Beobachten anderer. Dieses Lernen stellt eine optimale Möglichkeit dar, um das Verhalten besser anzupassen, ohne dabei selbst Fehler zu machen oder sich anstrengen zu müssen, um ein Verhalten in einer bestimmten Situation erfolgreich zu etablieren.19
Beobachtungslernen wird auch als Modelllernen, soziales Lernen oder Imitationslernen bezeichnet. Beobachtungslernen bedeutet, dass wir nicht nur durch unser eigenes Verhalten und seine Folgen (instrumentelle Konditionierung) lernen, sondern auch durch das Beobachten des Verhaltens anderer und seiner Folgen. Es wird davon ausgegangen, dass gerade Kinder viel durch Modelllernen erfahren, also durch die Beobachtung ihrer Eltern und Geschwister.20
5.3.4 Habituationslernen
Die Verhaltensänderung durch Gewöhnung stellt die einfachste Art dar, um etwas zu lernen. Bei dieser Methode lernen Menschen automatisch, den anfänglich aufregenden Reiz außer Acht zu lassen, der durch eine häufige Wiederholung ausgelöst wird. Dieses Phänomen lässt sich bereits beispielsweise bei Säuglingen vor der Geburt nachweisen. Im Vergleich zu der erwähnten Konditionierung findet bei dieser Lernform keine Assoziation statt. Ferner wird auch keine Bestätigung oder Belohnung herbeigeführt. Ein bekanntes Beispiel für Gewöhnung findet sich bei Geräuschen. Obwohl Hunde am Anfang eine Orientierungsreaktion auf raschelnde Blätter besitzen, gewöhnen sie sich sehr schnell daran und ignorieren allmählich das Rascheln.21
Das Lernen durch Habituation, das gelegentlich auch als Müdigkeit oder negatives Lernen beschrieben wird, ist nicht auf die Ermüdung funktionierender Organe (Muskeln) zurückzuführen, sondern die Ursache liegt in den beteiligten neuralen Strukturen. Dabei kommt es zu einer Schwächung der Reaktion, sofern eine gleichartige Wiederholung des Reizes erfolgt, wobei dieser schließlich nach einer kurzen Pause wieder voll auslösbar ist.22
5.4 Zusammenfassung
Der Prozess, alles zu erwerben, was mit unseren Fähigkeiten und unserem Wissen zusammenhängt, wird Lernen genannt, vor allem im akademischen Sinne. Lernen findet statt, wenn eine beobachtbare Verhaltensänderung, die zeitlich überdauert, durch Übung oder Erfahrung erlangt wurde. Gegenstand der klassischen Konditionierung ist die biologische Reaktion auf Reize, wenn eine Koppelung des anfänglichen Reizes mit einem neuen Reiz stattfindet und dabei auch der neue Reiz eine gleiche biologische Reaktion auslöst. Das berühmteste Beispiel ist Pawlows Hund für klassische Konditionierung. Pawlows Hund lernte, auf die Glocke mit erhöhtem Speichel zu reagieren. Dabei nimmt der Speichel auf natürliche Weise zu, wenn Hunde gefüttert werden.23
Es geht heraus, dass bei der klassischen Konditionierung die Reizpräsentation unabhängig vom Verhalten des Versuchstiers oder der Versuchsperson auftritt. Dahingegen liegt bei der operanten Konditionierung das Augenmerk auf auftretenden Lernphänomenen, wenn das Verhalten des Versuchstiers oder der Versuchsperson bestimmte Folgen auf diese hat. Dabei handelt es sich um einen instrumentellen Lernprozess, da die Umweltbedingungen beeinflusst werden.24
Als eine weitere Lernform ist neben der klassischen und operanten Konditionierung das Beobachtungslernen zu nennen. Dabei handelt es sich um einen kognitiven Lernprozess, wenn eine Person ein neues Verhalten annimmt oder ein bestehendes Verhaltensmuster weitgehend ändert, indem sie das Verhalten und die daraus resultierenden Konsequenzen anderer Personen beobachtet. Schließlich gibt es noch das Habituationslernen. Dabei werden Reize ausgeblendet, die keine relevanten Informationen enthalten.25
[...]
1 Vgl. Bak (2019), S. 4.
2 Vgl. Uhrhahne et al. (2019), S. 4-5.
3 Vgl. Müsseler/Rieger (2017), S. 320.
4 Vgl. Kiesel/Koch (2012), S. 12-13.
5 Vgl. Hasselhorn/Gold (2013), S. 37.
6 Vgl. Bak (2019), S. 6.
7 Vgl. Bak (2019), S. 6-7.
8 Vgl. Müsseler/Rieger (2017), S. 321-322.
9 Vgl. Kiesel/Koch (2012), S. 12-16.
10 Vgl. Schmithüsen (2015), S. 26-27.
11 Vgl. Zimbardo/Gerrig (2008), S. 195.
12 Vgl. Schmithüsen (2015), S. 29-30.
13 Vgl. Jansen (2015), S. 20-21.
14 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 298.
15 Vgl. Kiesel/Koch (2012), S. 22.
16 Vgl. Sokolowski (2013), S. 135-136.
17 Vgl. Kielholz (2008), S. 89-92.
18 Vgl. Jansen (2015), S. 53-54.
19 Vgl. Kiesel/Koch (2012), S. 73.
20 Vgl. Rademacher (2014), S. 109.
21 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 294-295.
22 Vgl. Rahmann/Rahmann (1988), S. 252.
23 Vgl. Sokolowski (2013), S. 129-130.
24 Vgl. Strobach/Wend t (2019), S. 27.
25 Vgl. Becker-Carus/Wendt (2017), S. 342.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Allgemeine Psychologie. Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297401