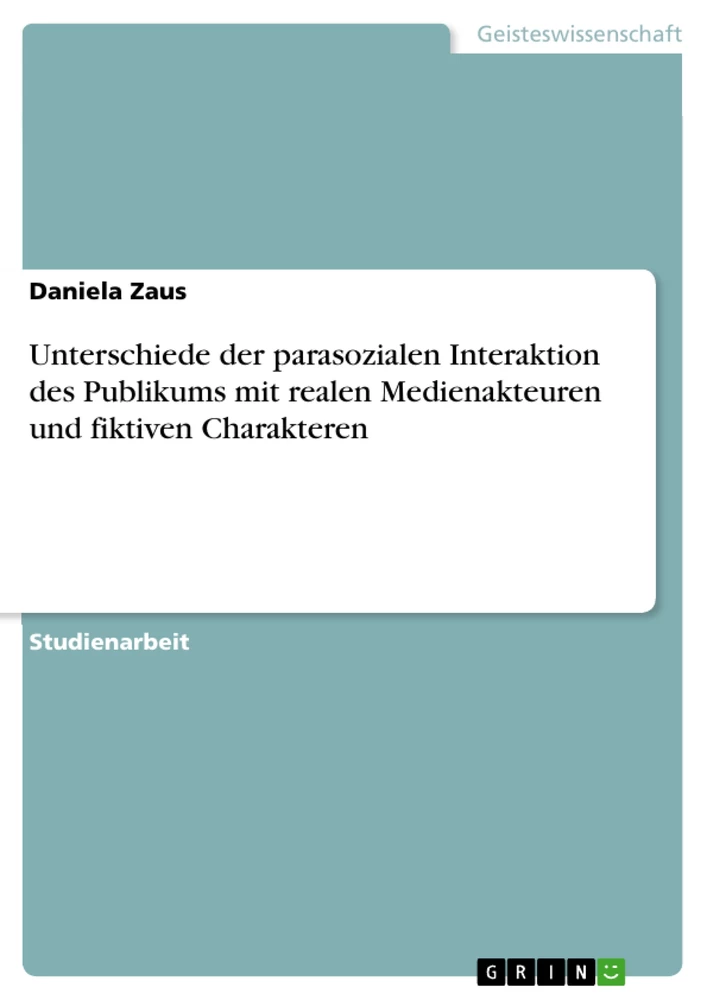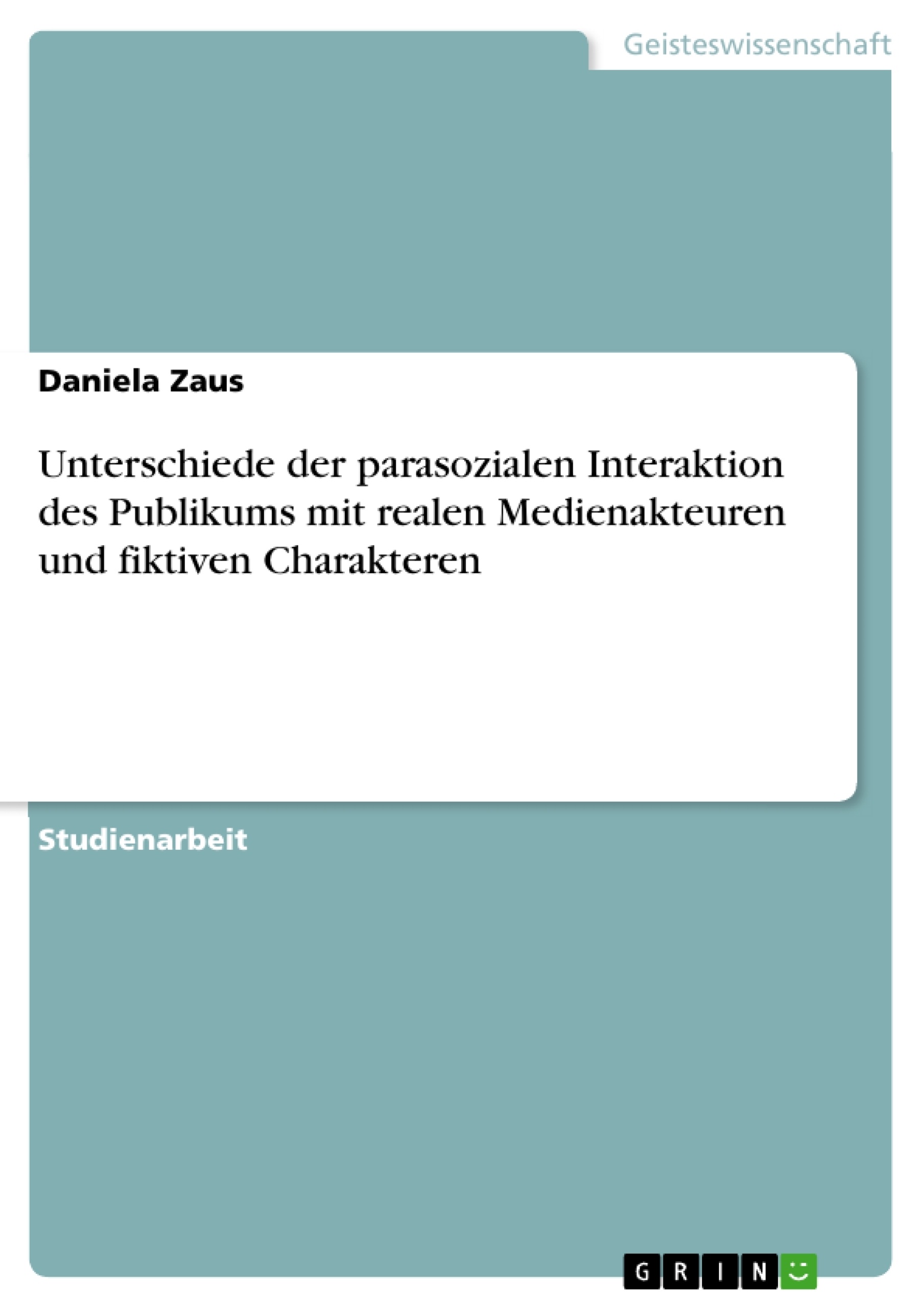Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, eine Antwort auf die Frage zu finden: Welche Unterschiede bestehen bei der parasozialen Interaktion des Publikums mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren? Zu diesem Zweck werden ausschließlich die Medien Film und Fernsehen betrachtet, da eine Gegenüberstellung von realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren hier am einfachsten vorzunehmen ist. Zudem ermöglichen die audiovisuellen Darstellungen im Unterschied zu anderen Medien ein wirklichkeitsnahes Abbild des Geschehens und der Personen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit der parasozialen Interaktion mit diesen erhöht.
Für das allgemeine Verständnis der folgenden Inhalte werden im ersten Teil die zentralen Begriffe, die relevant für diese Arbeit sind, erklärt. Dabei wird vor allem Bezug auf die grundlegenden Annahmen über parasoziale Phänomene von Horton und Wohl genommen, die Tilo Hartmann in seinem Buch "Parasoziale Interaktion und Beziehungen" (2017) erneut aufgegriffen hat.
Der darauffolgende Abschnitt behandelt, basierend auf dem Zwei-Ebenen-Modell parasozialer Interaktion von Hartmann, Schramm und Klimmt (2004), die grundlegenden Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse von Medienpersonen bzw. -figuren.
Im Anschluss werden die Gemeinsamkeiten von realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren beschrieben, bevor in einer Gegenüberstellung die Unterschiede der beiden Gruppen bezüglich parasozialer Interaktionen und Beziehungen ausführlich behandelt werden. Zu diesem Teil haben wieder Hartmann, aber auch Baeßler mit ihrem Buch über "Medienpersonen als parasoziale Beziehungspartner. Ein theoretischer und empirischer Beitrag zu personazentrierter Rezeption" (2009) und Gleich mit seinen Erkenntnissen über "Parasoziale Interaktionen und Beziehungen von Fernsehzuschauern mit Personen auf dem Bildschirm. Ein theoretischer und empirischer Beitrag zum Konzept des aktiven Rezipienten" (1997) maßgebend beigetragen.
Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit nochmals zusammengefasst, um die Beantwortung der forschungsleitenden Frage zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Parasoziale Interaktion und Beziehung
- 2.2 Realer Medienakteur
- 2.3 Fiktiver Charakter
- 3. Personenorientierte Medienrezeption
- 3.1 Wahrnehmung und Bewertung von Medienpersonen
- 4. Voraussetzungen für parasoziale Interaktionen und Beziehungen
- 4.1 Bildschirmpräsenz
- 4.2 Ähnlichkeit
- 4.3 Attraktivität
- 4.4 Verlässlichkeit
- 5. Unterschiede zwischen medienvermittelten Personen und Figuren
- 5.1 Realismus
- 5.2 Adressierung des Rezipienten
- 5.3 Kommunikativer Rahmen
- 5.4 Performance der Medienfigur
- 5.5 Möglichkeiten einer sozialen Interaktion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Unterschiede in der parasozialen Interaktion des Publikums mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren im Film und Fernsehen. Sie basiert auf bestehenden Theorien zur parasozialen Interaktion und Beziehung und analysiert die spezifischen Faktoren, die diese Interaktionen beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung parasozialer Interaktion und Beziehung
- Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung realer Medienakteure und fiktiver Charaktere
- Analyse der Rolle von Faktoren wie Bildschirmpräsenz, Ähnlichkeit, Attraktivität und Verlässlichkeit
- Vergleich der Realitätsdarstellung und des kommunikativen Rahmens
- Möglichkeiten der sozialen Interaktion mit realen und fiktiven Medienfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der parasozialen Interaktion und Beziehung ein und stellt die Forschungsfrage nach den Unterschieden in der parasozialen Interaktion mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren. Sie begründet die Fokussierung auf Film und Fernsehen aufgrund der einfacheren Gegenüberstellung und der realitätsnahen audiovisuellen Darstellung, welche die Wahrscheinlichkeit parasozialer Interaktion erhöht. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Forschung und zitiert relevante Wissenschaftler wie Horton, Wohl, Hartmann, Baeßler und Gleich, die die Grundlage für die Untersuchung bilden.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit: parasoziale Interaktion (PSI) als einseitige Interaktion mit medial vermittelten Personen und parasoziale Beziehung (PSB) als Entwicklung dieser Interaktion über mehrere Situationen hinweg. Es wird der Unterschied zwischen realen Medienakteuren (als Personen, die sich selbst im Fernsehen darstellen) und fiktiven Charakteren (erfunden und von Schauspielern verkörpert) präzise erklärt, wobei die Definition von "Charakter" und "Figur" im filmischen Kontext eingehender beleuchtet wird. Diese präzisen Definitionen legen das Fundament für die nachfolgende Analyse.
3. Personenorientierte Medienrezeption: Dieses Kapitel beschreibt die personenzentrierte Natur der Medienrezeption. Es erklärt das Zwei-Ebenen-Modell von Hartmann, Schramm und Klimmt, das die kognitiven und emotionalen Prozesse der Personenwahrnehmung und deren Rolle bei der Entstehung parasozialer Interaktionen beschreibt. Es wird detailliert auf die Schritte der Medienrezeption eingegangen: die Wahrnehmung des sozialen Objekts, die Zuordnung zu einer sozialen Kategorie (inkl. Fiktionalität) und die anschließende intensivere Auseinandersetzung, die zu parasozialer Interaktion führen kann. Das Kapitel betont die Bedeutung der initialen Wahrnehmung und Bewertung für die Entstehung von PSI.
Schlüsselwörter
Parasoziale Interaktion, parasoziale Beziehung, reale Medienakteure, fiktive Charaktere, Medienrezeption, Personenwahrnehmung, Film, Fernsehen, Realismus, Kommunikation, Bildschirmpräsenz, Ähnlichkeit, Attraktivität, Verlässlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Unterschiede in der parasozialen Interaktion mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede in der parasozialen Interaktion des Publikums mit realen Medienakteuren (z.B. Nachrichtensprecher) und fiktiven Charakteren (z.B. Schauspieler in Filmen und Serien) im Film und Fernsehen. Sie analysiert die Faktoren, die diese Interaktionen beeinflussen.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie parasoziale Interaktion (PSI) als einseitige Interaktion mit medial vermittelten Personen und parasoziale Beziehung (PSB) als deren Entwicklung über mehrere Situationen hinweg. Es wird präzise zwischen realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren unterschieden, inkl. einer genaueren Betrachtung des Begriffs "Charakter" im filmischen Kontext.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Theorien zur parasozialen Interaktion und Beziehung. Das Zwei-Ebenen-Modell von Hartmann, Schramm und Klimmt, welches die kognitiven und emotionalen Prozesse der Personenwahrnehmung beschreibt, spielt eine wichtige Rolle. Die Arbeit zitiert zudem relevante Wissenschaftler wie Horton, Wohl, Baeßler und Gleich.
Welche Faktoren beeinflussen die parasoziale Interaktion?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Faktoren wie Bildschirmpräsenz, Ähnlichkeit zum Rezipienten, Attraktivität der Medienperson und deren wahrgenommene Verlässlichkeit. Es wird untersucht, wie diese Faktoren die Entstehung und Intensität parasozialer Interaktionen beeinflussen.
Wie werden reale Medienakteure und fiktive Charaktere verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf Unterschiede in der Realitätsdarstellung, der Adressierung des Rezipienten, dem kommunikativen Rahmen, der Performance der Medienfigur und den Möglichkeiten sozialer Interaktion mit diesen. Der Fokus liegt auf den audiovisuellen Medien Film und Fernsehen, da diese eine realitätsnahe Darstellung bieten und die Wahrscheinlichkeit parasozialer Interaktion erhöhen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Begriffsdefinitionen, ein Kapitel zur personenorientierten Medienrezeption, ein Kapitel zu den Voraussetzungen parasozialer Interaktionen, ein Kapitel zum Vergleich realer und fiktiver Medienpersonen und ein Fazit. Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt der parasozialen Interaktion mit Bezug auf reale Medienakteure und fiktive Charaktere.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Parasoziale Interaktion, parasoziale Beziehung, reale Medienakteure, fiktive Charaktere, Medienrezeption, Personenwahrnehmung, Film, Fernsehen, Realismus, Kommunikation, Bildschirmpräsenz, Ähnlichkeit, Attraktivität, Verlässlichkeit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede in der parasozialen Interaktion des Publikums mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren zu untersuchen und die spezifischen Faktoren zu analysieren, die diese Interaktionen beeinflussen. Sie trägt dazu bei, ein besseres Verständnis der komplexen Dynamik der Medienrezeption zu entwickeln.
- Quote paper
- Daniela Zaus (Author), 2018, Unterschiede der parasozialen Interaktion des Publikums mit realen Medienakteuren und fiktiven Charakteren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297060