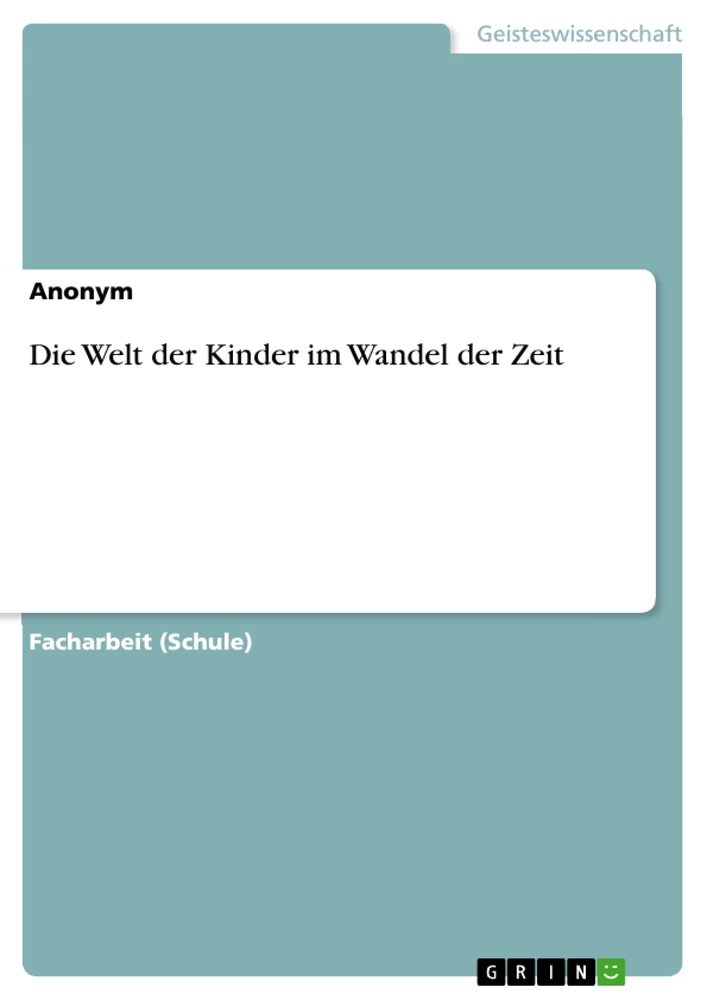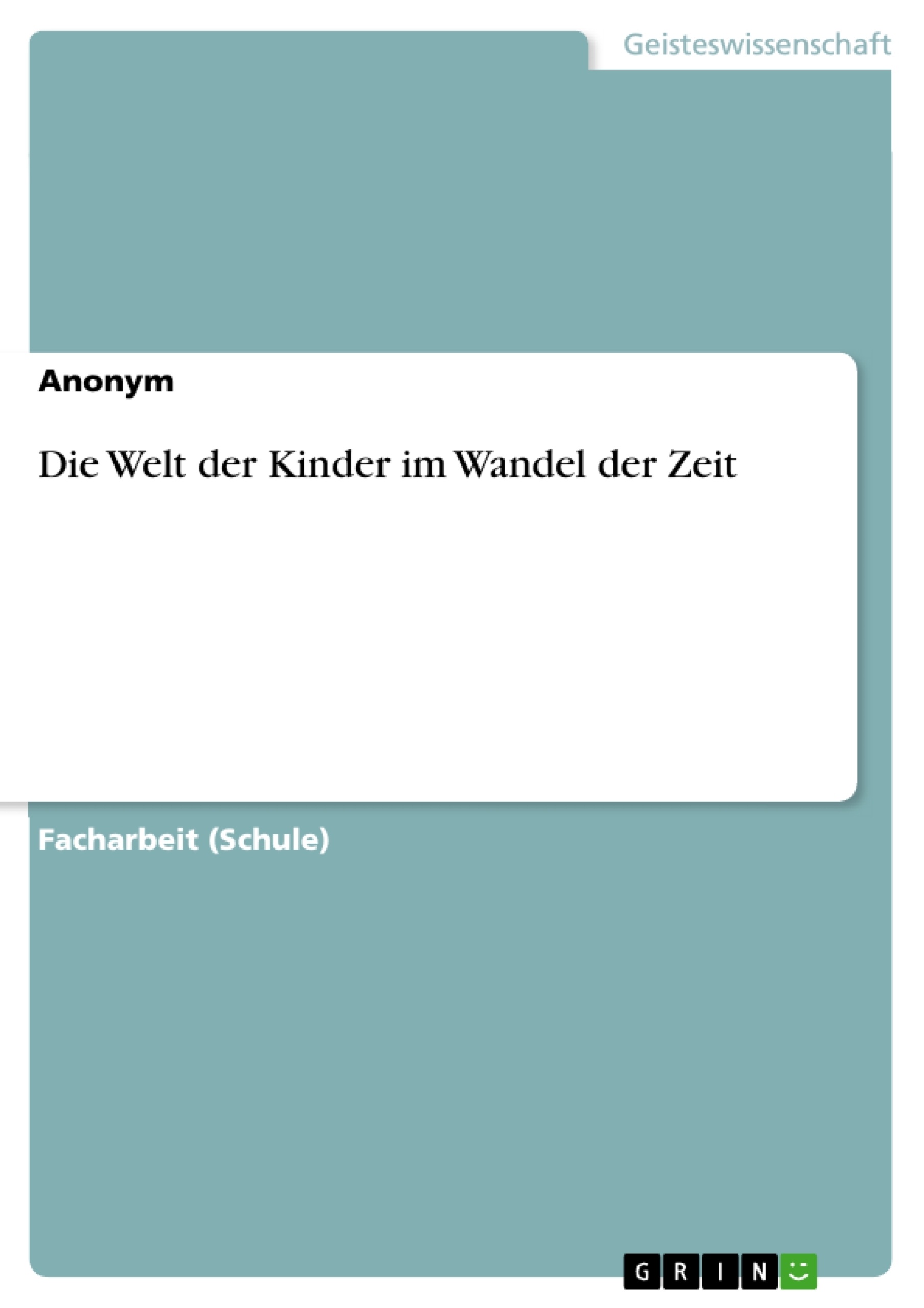Das Erscheinen von „L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime“ von Philippe Ariès um 1960 hat die eigentliche Erforschung der Geschichte der Kindheit in Gang gebracht. Ziel dieser Seminarkursarbeit ist, einen kleinen Einblick in die Ergebnisse dieser neueren Forschung zu bieten. Dabei beschränke ich mich auf den Raum Europa. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitraum zwischen dem Spätmittelalter und der voranschreitenden Industrialisierung, wobei zur besseren Veranschaulichung auch die Antike und die heutige Zeit angesprochen werden. Wenn man von Kindheit spricht, so muss man zwischen „Kindheitsbild“ und „Kinderleben“ unterscheiden. Das „Kindheitsbild“ ist das Bild, das sich eine Gesellschaft von Kindheit macht und das ihre Einstellung und ihr Verhalten gegenüber Kindern maßgeblich beeinflusst. „Kinderleben“ beschreibt hingegen die erlebte Wirklichkeit von Kindern. In diesem Rahmen werde ich folgende Fragen zu klären versuchen: Wie haben Menschen im Laufe der Zeit Kinder wahrgenommen und welche Impulse haben zur Veränderung ihres „Kindheitsbildes“ beigetragen? Gab es schon immer eine Idee von Kindheit, wie wir sie heute haben, und wenn nicht, wie ist sie entstanden? Wie verhielten sich Eltern und Erwachsene gegenüber Kindern und wie hat sich ihr Verhalten geändert? Wie sah das Leben von Kindern konkret aus? Und schließlich die Frage, wie Kinder erzogen wurden und wie sich das Bildungswesen entwickelt hat. Dabei ist das Thema der Geschichte der Kindheit oft eine Sache der Interpretation und sehr subjektiv. Hinzu kommt, dass die Forschung zu diesem Thema noch nicht abgeschlossen ist. Die zu klärenden Fragen werden in drei Hauptkapiteln „Kinder im Blick der Gesellschaft“, „Kinderleben“ und „Erziehung“ behandelt, wobei Überschneidungen aufgrund der Komplexität des Themas möglich sind. In jedem Unterkapitel bemühe ich mich darum, jeden Aspekt chronologisch darzustellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kinder im Blick der Gesellschaft
- 2.1. Kindesalter
- 2.2. Kindheitsbild
- 2.2.1. Das Bild des Kindes in der Kunst
- 2.2.2. Kindheitsbild im Mittelalter und seit der Renaissance
- 2.2.3. Kindheitsbild seit der Aufklärung
- 2.2.4. Kindheitsbild der Reformpädagogik
- 2.2.5. Kindheitsbild an Beispielen aus der Literatur
- 2.3. Einstellung zu missgebildeten Kindern
- 2.4. Abgrenzung von der Erwachsenenwelt
- 2.5. Kinderwunsch, Kindstod und Kindestötung
- 2.6. Eltern-Kind-Beziehungen
- 2.6.1. Eltern-Kind-Beziehung in Mittelalter und früher Neuzeit
- 2.6.2. Wandel der Mutter-Rolle im 18. Jh.
- 2.6.3. Eltern-Kind-Beziehung in unteren sozialen Schichten
- 3. Kinderleben
- 3.1. Schwangerschaft
- 3.2. Geburt und Taufe
- 3.3. Häusliche Pflege
- 3.4. Kleidung
- 3.5. Spiel
- 3.6. Ernst in der Kindheit
- 3.7. Kindheit im Waisenhaus
- 3.8. Kindliche Lebenswelt
- 3.9. Krankheit, Pädiatrie
- 3.10. Schüler- und Lehrlingsleben
- 3.11. Ritter und Edelfrauen
- 3.12. Ende der Kindheit - Ehe und Kloster
- 4. Erziehung
- 4.1. Erziehung in der Familie
- 4.2. Bildungswesen
- 4.3. Leibeserziehung
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Einblick in die historische Forschung zur Kindheit in Europa, insbesondere zwischen Spätmittelalter und beginnender Industrialisierung. Sie beleuchtet die Entwicklung des Kindheitsverständnisses und des kindlichen Lebensalltags. Die Arbeit untersucht, wie sich das Bild des Kindes in der Gesellschaft verändert hat, wie Kinder lebten und wie sie erzogen wurden.
- Wandel des Kindheitsbildes im Laufe der Zeit
- Entwicklung des Verständnisses von Kindheit
- Eltern-Kind-Beziehungen in verschiedenen historischen Kontexten
- Alltagsleben von Kindern in unterschiedlichen sozialen Schichten
- Entwicklung des Erziehungswesens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der historischen Kindheitsforschung ein und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie erläutert den Unterschied zwischen „Kindheitsbild“ (gesellschaftliche Wahrnehmung) und „Kinderleben“ (erlebte Realität) und skizziert die Struktur der Arbeit mit den drei Hauptkapiteln „Kinder im Blick der Gesellschaft“, „Kinderleben“ und „Erziehung“. Die Arbeit betont den interpretativen und subjektiven Charakter der historischen Kindheitsforschung und räumt ein, dass die Forschung noch nicht abgeschlossen ist.
2. Kinder im Blick der Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindern in verschiedenen Epochen. Es untersucht die Definition des Kindesalters im Mittelalter und die Entwicklung des Kindheitsbildes von der Antike bis zur Moderne. Es werden unterschiedliche Kindheitskonzepte und deren Hintergründe beleuchtet, einschließlich des Einflusses von Kunst, Religion und Reformpädagogik. Der Abschnitt beleuchtet die rechtliche Stellung des Kindes, die Einstellung zu missgebildeten Kindern und die Abgrenzung der Kinder von der Erwachsenenwelt. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Wandel der Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere der Rolle der Mutter, und deren Ausprägung in unterschiedlichen sozialen Schichten.
3. Kinderleben: Dieses Kapitel beschreibt den Alltag von Kindern in verschiedenen historischen Perioden. Es behandelt Themen wie Schwangerschaft, Geburt, Taufe, häusliche Pflege, Kleidung, Spiel und die Herausforderungen der Kindheit. Der Abschnitt befasst sich mit dem Leben von Kindern in Waisenhäusern, Krankheiten, der Pädiatrie sowie mit dem Schüler- und Lehrlingsleben, dem Leben von Kindern des Adels und dem Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben durch Ehe oder Eintritt ins Kloster. Es zeichnet ein umfassendes Bild des kindlichen Lebensalltags und der damit verbundenen Bedingungen.
4. Erziehung: Dieses Kapitel widmet sich der Erziehung von Kindern in der Familie und im Bildungswesen, einschließlich der Leibeserziehung. Es analysiert Erziehungsmethoden und die Entwicklung von Bildungseinrichtungen in verschiedenen historischen Epochen. Es zeichnet ein Bild des Wandels der Erziehungspraktiken und deren Einfluss auf die Entwicklung des Kindheitsbildes. Der Abschnitt betrachtet die Entwicklung des Bildungswesens und der damit verbundenen Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Kindheit, Kindheitsbild, Kinderleben, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Reformpädagogik, Eltern-Kind-Beziehung, Erziehung, Bildungswesen, soziale Schichten, historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Historische Kindheit in Europa
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die historische Forschung zur Kindheit in Europa, insbesondere zwischen Spätmittelalter und beginnender Industrialisierung. Sie untersucht die Entwicklung des Kindheitsverständnisses, den kindlichen Lebensalltag, den Wandel des Kindheitsbildes in der Gesellschaft, die Eltern-Kind-Beziehungen in verschiedenen historischen Kontexten und die Entwicklung des Erziehungswesens.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Kindheitsbild in verschiedenen Epochen (Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Reformpädagogik), die Definition des Kindesalters, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindern, das Leben von Kindern in unterschiedlichen sozialen Schichten (inkl. Adel, Waisenhäuser), Schwangerschaft, Geburt, Taufe, häusliche Pflege, Kleidung, Spiel, Krankheit, Pädiatrie, Schüler- und Lehrlingsleben, Ehe und Kloster als Übergang ins Erwachsenenleben, Eltern-Kind-Beziehungen (inkl. Wandel der Mutterrolle), Erziehung in der Familie und im Bildungswesen sowie Leibeserziehung.
Welche Epochen werden in der Seminararbeit betrachtet?
Der Fokus liegt auf der Zeit zwischen Spätmittelalter und beginnender Industrialisierung. Die Arbeit beleuchtet jedoch auch Entwicklungen aus der Antike und der Moderne, um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Kinder im Blick der Gesellschaft, 3. Kinderleben, 4. Erziehung und 5. Schlusswort. Kapitel 2 analysiert die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindern. Kapitel 3 beschreibt den kindlichen Alltag. Kapitel 4 widmet sich der Erziehung. Die Einleitung führt in das Thema ein und das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Kindheitsbild, Kinderleben, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Reformpädagogik, Eltern-Kind-Beziehung, Erziehung, Bildungswesen, soziale Schichten, historische Forschung.
Was ist der Unterschied zwischen „Kindheitsbild“ und „Kinderleben“ in der Seminararbeit?
„Kindheitsbild“ bezieht sich auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindern, also wie Kinder in der jeweiligen Epoche gesehen und bewertet wurden. „Kinderleben“ beschreibt hingegen die erlebte Realität von Kindern, ihren Alltag und ihre Lebensbedingungen.
Welche Forschungsfragen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie sich das Bild des Kindes in der Gesellschaft verändert hat, wie Kinder lebten und wie sie erzogen wurden. Sie beleuchtet die Entwicklung des Kindheitsverständnisses und des kindlichen Lebensalltags.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Die Seminararbeit richtet sich an Personen, die sich für die Geschichte der Kindheit und die historische Kindheitsforschung interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Geschichte, Pädagogik, Soziologie und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2006, Die Welt der Kinder im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129399