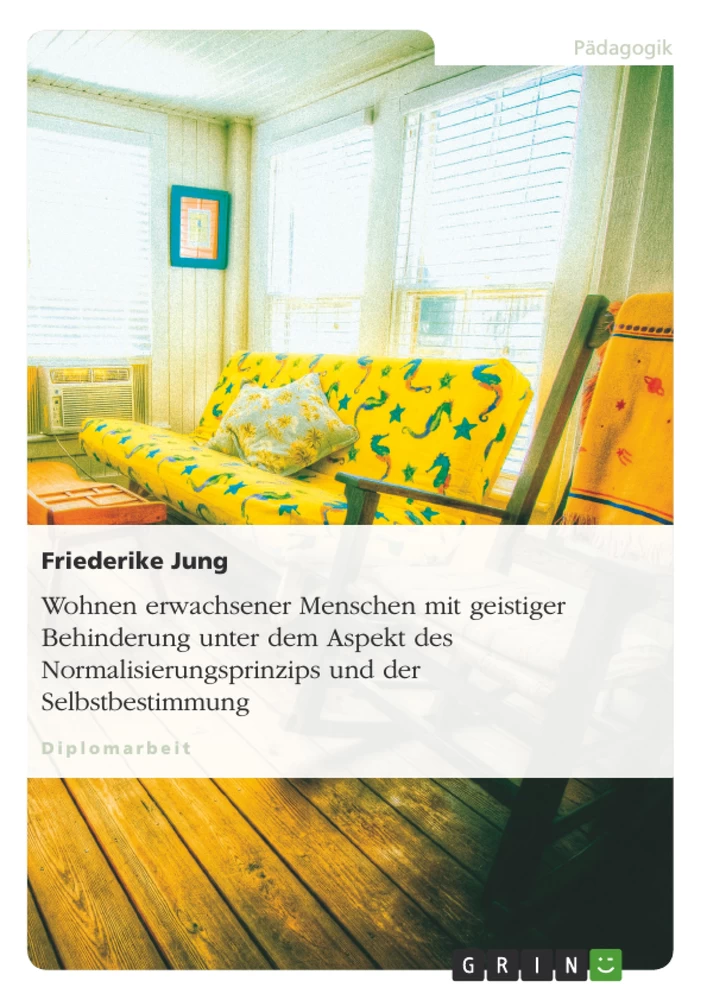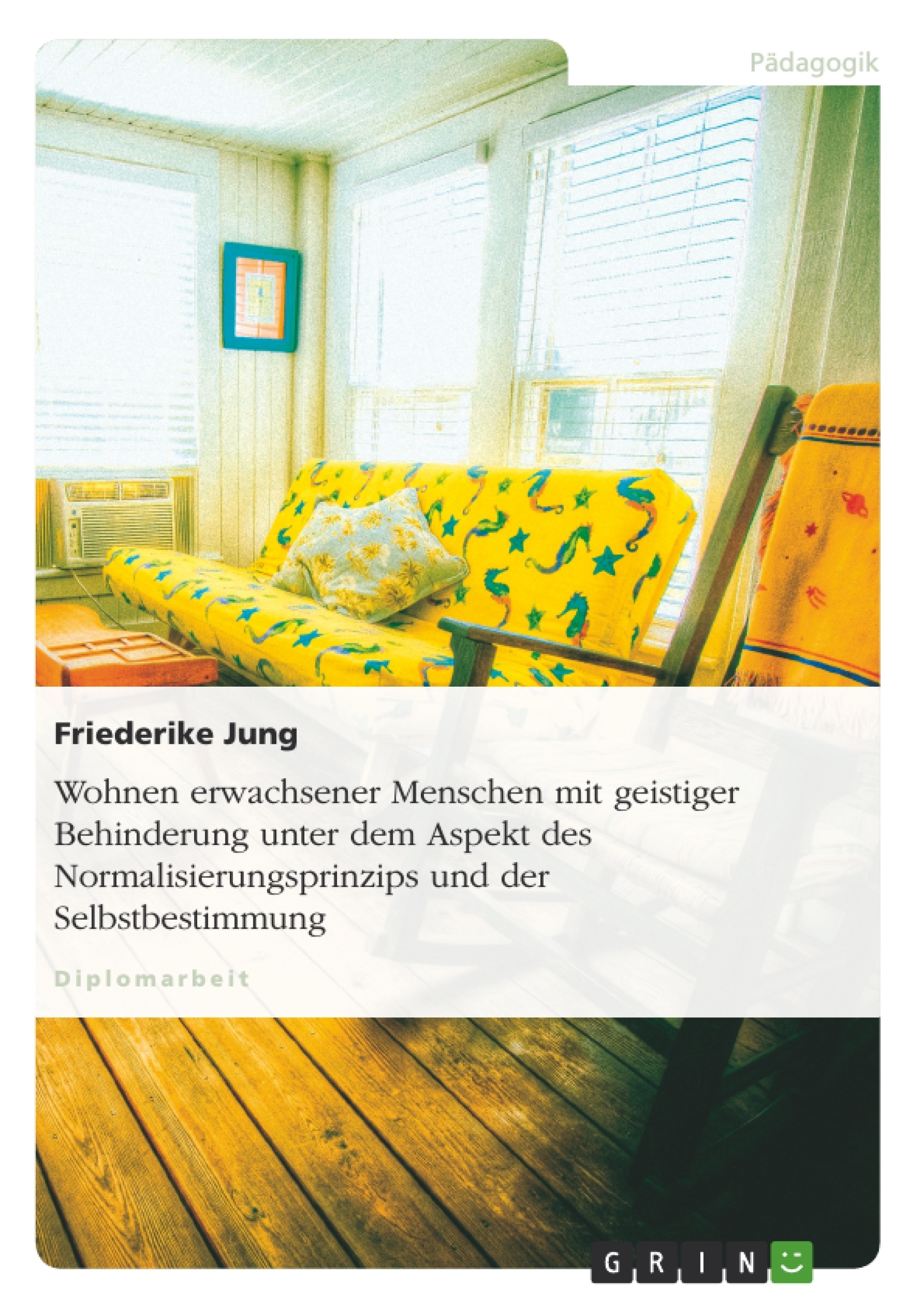In Kapitel 2 wird der Begriff der geistigen Behinderung umrissen. Ebenso werden Schwierigkeiten aufgezeigt, die sich im Zusammenhang mit seiner Definition ergeben. Es schließt sich die Beschreibung von wissenschaftlichen Definitionsansätzen an, welche sich auf unterschiedliche Weise dem Phänomen »geistige Behinderung« nähern. Darauf bezugnehmend wird der Wandel, welcher sich in den Sichtweisen zu geistiger Behinderung vollzieht, dargestellt. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der geistigen Behinderung beschließt dieses Kapitel.
Kapitel 3 wird mit der Definition des Wortes »Wohnen« begonnen. Nachfolgend wird die psychologische Bedeutsamkeit des Wohnens erläutert. Aspekte der Wohnqualität verdeutlichen dann den Zusammenhang von Wohnqualität und Lebensqualität. In Abgrenzung zum Wohnen im allgemeinen wird das Wohnen speziell in Verbindung mit geistiger Behinderung aufgezeigt. Ein historischer Abriß über die Unterbringung und das Wohnen von Menschen mit geistiger Behinderung seit der Neuzeit leitet von der Zeit der Anstaltsgründungen bis zu gegenwärtigen Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung über.
Ein Rückblick in die Geschichte der Umsetzung verschiedener Denkmodelle über geistige Behinderung ab 1933 eröffnet Kapitel 4. Zentraler Gegenstand dieses Kapitels ist dann die Schilderung des Normalisierungsprinzips in seiner Entstehung und weiteren Ausformulierung.
Das Paradigma der Selbstbestimmung ist Gegenstand von Kapitel 5.
Kapitel 6 verbindet die Kapitel 3, 4 und 5. Ausgewählte Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung werden unter dem Aspekt von Normalisierung und Selbstbestimmung betrachtet, wobei Wohnbedürfnisse zur Beurteilung hinzugezogen werden. Der Schwerpunkt dabei soll auf dem Normalisierungsprinzip als Grundvoraussetzung für ein normalisiertes und integriertes Leben von Menschen mit geistiger Behinderung liegen. Während drei Formen des Wohnens vorwiegend anhand von Literatur dargestellt werden, erfolgt die Betrachtung der vierten im Rahmen einer eigenen Beobachtungsstudie. Diese fällt im Vergleich zu den übrigen etwas umfangreicher aus.
Kapitel 7 beinhaltet eine Interpretation und Reflexion der insbesondere in Kapitel 6 gewonnenen Ergebnisse.
Kapitel 8 bildet das Fazit der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand und Motivation
- Struktur der Arbeit
- Geistige Behinderung
- Begriff
- Schwierigkeiten einer Definition
- Medizinisch-biologischer Ansatz
- Pränatal entstandene Formen
- Perinatal entstandene Formen
- Postnatal entstandene Formen
- Psychologischer Ansatz
- Soziologischer Ansatz
- Pädagogischer Ansatz
- Veränderte Sichtweisen
- Kritik am Begriff »geistige Behinderung«
- Zusammenfassung
- Das Wohnen
- Definition
- Die psychologische Bedeutsamkeit des Wohnens
- Lebensqualität durch Wohnqualität
- Gestaltung des Wohnraums
- Wohnzufriedenheit
- Ortsidentität - Heimat
- Wohnen und geistige Behinderung
- Historie der Unterbringung und des Wohnens von Menschen mit geistiger Behinderung in der Neuzeit
- Von der Zeit der Anstaltsgründungen im 19. Jahrhundert bis 1945
- Wohnformen nach 1945
- Gegenwärtige Wohnformen für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung
- Geschlossene Wohnformen
- Offene Wohnformen
- Situation, Zahlen und Verteilung
- Zusammenfassung
- Das Normalisierungsprinzip
- Geschichte der Umsetzung verschiedener Denkmodelle über geistige Behinderung
- Ideologie der Nationalsozialisten: 1933 - 1945
- Nachkriegszeit bis 1960er Jahre: Leitidee der Verwahrung
- 1960er bis Mitte 1990er Jahre: Leitidee der Förderung und beginnender Normalisierung
- Anfang 1990er Jahre: Leitidee der Selbstbestimmung
- Entstehung des Normalisierungsprinzips
- Die Anfänge des Normalisierungsprinzips
- Der Normalisierungsgedanke bei Bank-MIKKELSEN
- Der Normalisierungsgedanke bei NIRJE
- Strukturierung durch WOLFENSBERGER
- Rezeption des Normalisierungsprinzips in Deutschland
- Zusammenfassung
- Das Paradigma der Selbstbestimmung
- Das Verständnis von Selbstbestimmung
- Die Anfänge der Selbstbestimmung
- Die Independent-Living-Bewegung
- Self-Advocacy-Bewegung
- Konzepte zur Rolle des Helfenden
- Empowerment
- Das Assistenzkonzept
- Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Zusammenfassung
- Normalisierte Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung?
- Formen der Unterbringung und des Wohnens unter dem Normalisierungsaspekt
- Psychiatrische Einrichtungen
- Anstalten
- Familie
- Ambulant betreutes Wohnen
- Gruppengegliedertes Wohnen im Wohnhaus: Eine Beobachtungsstudie
- Zusammenfassung
- Interpretation und Reflexion der Ergebnisse
- Fazit
- Literatur
- TABELLENVERZEICHNIS
- Tab. 1: Leitbilder der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung nach 1945
- Tab. 2: Modell der Aufwertung der sozialen Rolle nach WOLFENSBERGER
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Wohnen erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung unter dem Aspekt des Normalisierungsprinzips und der Selbstbestimmung. Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung von Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext der Normalisierungsidee und des Selbstbestimmungsgedankens zu beleuchten. Dabei werden die historischen Entwicklungen, die verschiedenen Wohnformen und die aktuellen Herausforderungen im Bereich des Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung analysiert.
- Entwicklung des Begriffs der geistigen Behinderung
- Das Normalisierungsprinzip und seine Relevanz für das Wohnen
- Das Paradigma der Selbstbestimmung im Kontext des Wohnens
- Analyse verschiedener Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung
- Herausforderungen und Perspektiven für die Gestaltung inklusiver Wohnformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert den Gegenstand und die Motivation der Arbeit. Sie skizziert die Struktur der Arbeit und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der geistigen Behinderung. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zur Beschreibung der geistigen Behinderung vorgestellt, die sich aus medizinisch-biologischen, psychologischen, soziologischen und pädagogischen Perspektiven ergeben. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen des Begriffs und die Kritik an der Verwendung des Begriffs »geistige Behinderung«.
Kapitel 3 widmet sich dem Thema Wohnen. Es wird eine Definition des Wohnens gegeben und die psychologische Bedeutsamkeit des Wohnens für die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung herausgestellt. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Unterbringung und des Wohnens von Menschen mit geistiger Behinderung in der Neuzeit und stellt verschiedene gegenwärtige Wohnformen vor.
Kapitel 4 behandelt das Normalisierungsprinzip. Es wird die Geschichte der Umsetzung verschiedener Denkmodelle über geistige Behinderung dargestellt und die Entstehung des Normalisierungsprinzips erläutert. Die Arbeit beleuchtet die Rezeption des Normalisierungsprinzips in Deutschland und zeigt die Bedeutung des Prinzips für die Gestaltung von Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung auf.
Kapitel 5 widmet sich dem Paradigma der Selbstbestimmung. Es wird das Verständnis von Selbstbestimmung im Kontext der Behindertenhilfe erläutert und die Anfänge der Selbstbestimmungsbewegung dargestellt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Konzepte zur Rolle des Helfenden und zeigt die Bedeutung der Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung auf.
Kapitel 6 untersucht verschiedene Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung unter dem Aspekt des Normalisierungsprinzips. Es werden verschiedene Formen der Unterbringung und des Wohnens, wie psychiatrische Einrichtungen, Anstalten, Familie und ambulant betreutes Wohnen, vorgestellt und analysiert. Die Arbeit präsentiert eine Beobachtungsstudie zum gruppengegliederten Wohnen im Wohnhaus und diskutiert die Ergebnisse im Kontext der Normalisierungsidee.
Kapitel 7 interpretiert und reflektiert die Ergebnisse der Arbeit. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und die Implikationen für die Praxis der Behindertenhilfe diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die geistige Behinderung, das Wohnen, das Normalisierungsprinzip, die Selbstbestimmung, die Lebensqualität, die Wohnqualität, die Inklusion, die Wohnformen, die Unterbringung, die Behindertenhilfe, die Geschichte der Behindertenhilfe, die Entwicklung von Wohnformen, die Herausforderungen der Inklusion und die Perspektiven für die Gestaltung inklusiver Wohnformen.
- Quote paper
- Friederike Jung (Author), 2005, Wohnen erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung unter dem Aspekt des Normalisierungsprinzips und der Selbstbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129381