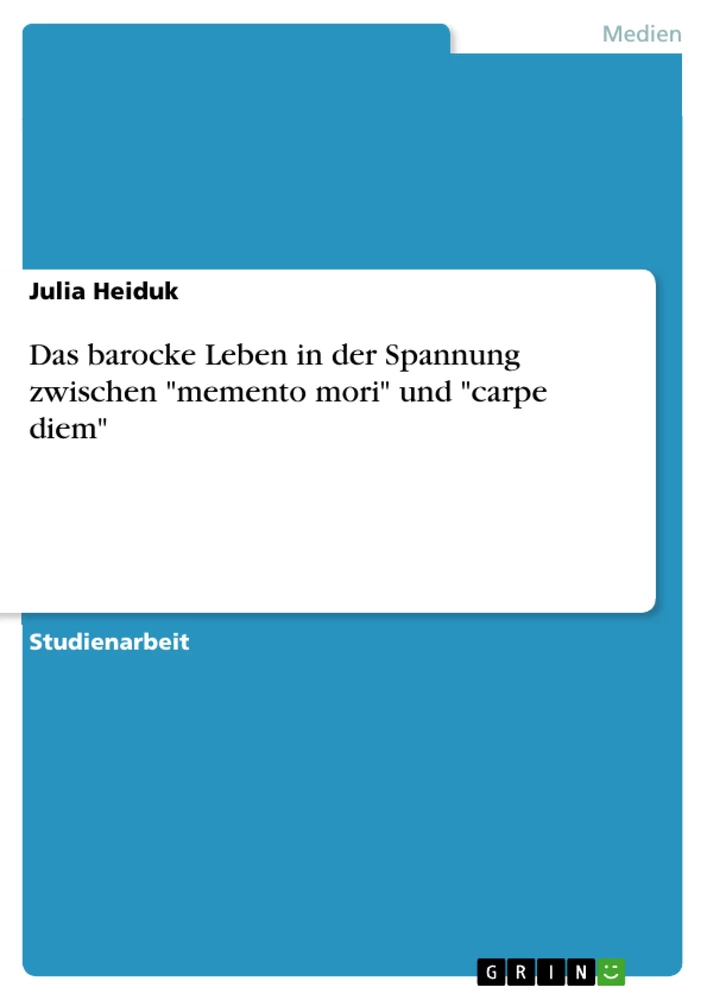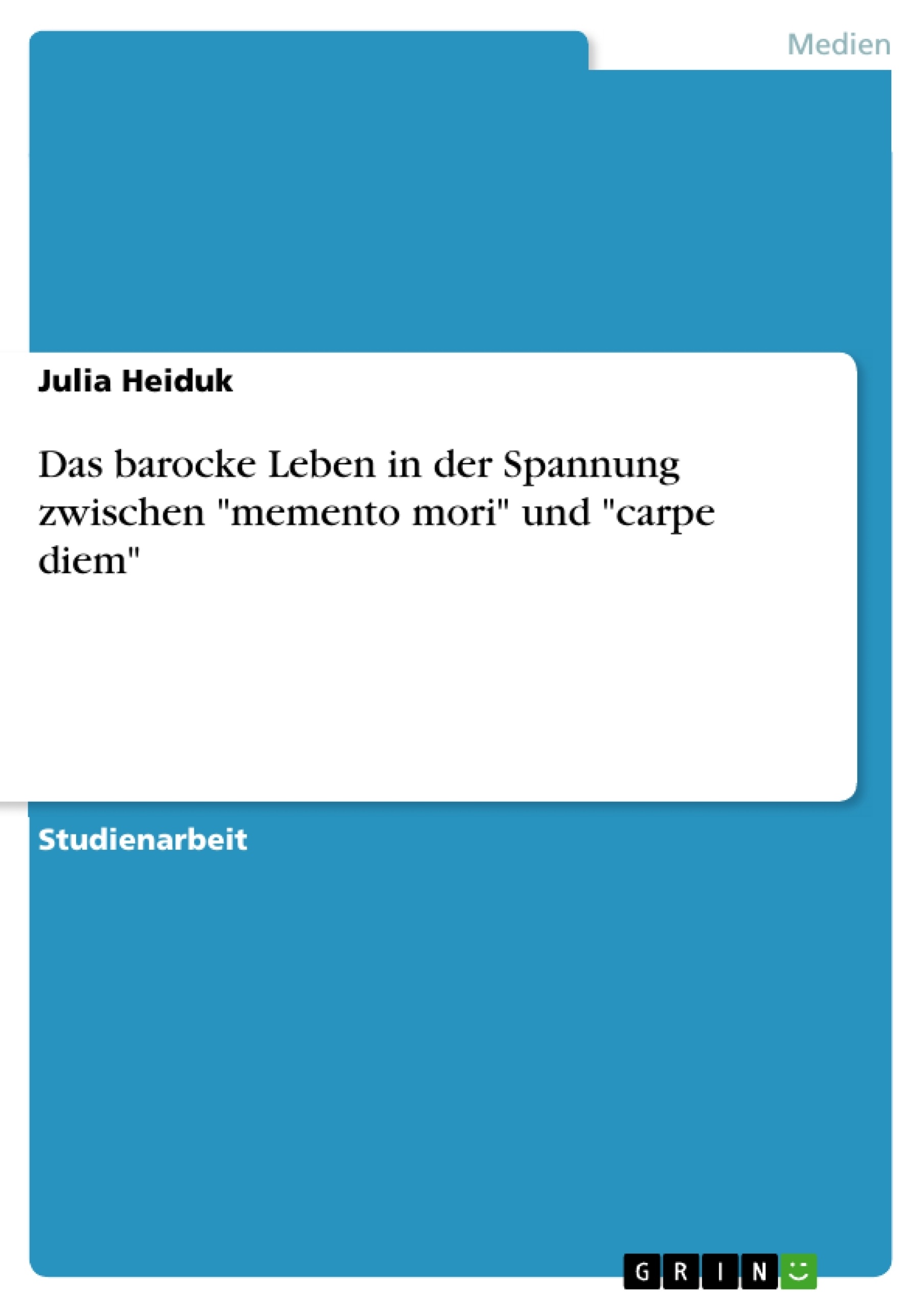Das Barock gilt als Zeitalter von Macht und Repräsentation.
Auf den ersten Blick kennzeichnen pure Lebensfreude und
überschwenglicher Weltgenuß diese Epoche. Erst auf den
zweiten Blick zeigen sich deutlich Zweifel am irdischen
Dasein, überall sind Zeichen von Tod und Jenseitsgedanken
zu sehen und zu spüren. Die adlige Gesellschaft sprüht nur
so vor Leben einerseits, andererseits beschäftigt man sich viel
mit dem Tod und seiner eigenen Sterblichkeit. Die Einstellungen
widersprechen sich völlig und scheinen sich zunächst
auszuschließen. Geht das eine Verhalten aus dem anderen
hervor, das Leben sehr bewußt zu genießen, es auszukosten
in dem Bewußtsein, daß es endlich und vergänglich ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Das Barock
- 1.1 Der Begriff Barock
- 1.2 Der geschichtliche Hintergrund des Barocks
- 1.3 Das Weltbild im Barock
- 1.4 Das Sterben im Barock
- 1.5 Der Totentanz
- 1.6 Die Embleme
- 2 Die Barockmalerei
- 2.1 Das Stilleben
- 2.2 Vanitas-Symbolik im Stilleben
- 2.3 Fortuna
- 2.4 Vanitas-Stilleben
- 2.5 Gedeckte Tisch-Stilleben, Mahlzeiten-Stilleben
- 2.6 Blumen-Stilleben
- 3 Die Barockdichtung
- 3.1 Vanitas-Gedanke in der Barockdichtung
- 3.2 Neuorientierung in der deutschen Dichtung
- 3.3 Sprachgesellschaften
- 3.4 Die Lyrik im Barock
- 3.5 Das Theater im Barock
- 3.6 Der Roman im Barock
- 4 Die Barockmusik
- 4.1 Der Vanitas-Gedanke in der Barockmusik
- 4.2 Neuerungen in der Barockmusik
- 4.3 Die Oper im Barock
- 4.4 Claudio Monteverdi
- 4.5 Georg Friedrich Händel
- 4.6 Johann Sebastian Bach
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das barocke Leben im Spannungsfeld zwischen der Maxime "carpe diem" und dem "memento mori". Sie beleuchtet das gegensätzliche Verhältnis von Lebensfreude und Todesbewusstsein in der Gesellschaft des 17. Jahrhunderts und analysiert die Ursachen dieses Widerspruchs. Anhand verschiedener Beispiele aus Malerei, Dichtung und Musik wird gezeigt, wie sich dieser Widerstreit in der Kunst und Kultur manifestierte.
- Das Spannungsverhältnis zwischen "carpe diem" und "memento mori" im Barock.
- Die Rolle des Todesgedankens in verschiedenen Kunstformen des Barocks.
- Die Symbolik von Vanitas-Motiven in der Malerei und Literatur.
- Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und der Pest auf das Weltbild der Menschen.
- Die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur im Barock.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale These der Arbeit: die paradoxe Koexistenz von Lebensgenuss und Todesbewusstsein im Barock. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen vor und kündigt die Methode an, anhand von Beispielen aus verschiedenen Bereichen (Malerei, Literatur, Musik) das Phänomen zu beleuchten.
1 Das Barock: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in den Barock. Es erörtert den Begriff "Barock" selbst, beleuchtet den historischen Hintergrund, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg und die daraus resultierende gesellschaftliche und kulturelle Situation. Der Einfluss des französischen Absolutismus und die Veränderungen im Weltbild durch wissenschaftliche Entdeckungen werden detailliert beschrieben. Das Kapitel legt den Fokus auf die paradoxe Kombination von Machtdemonstration und dem allgegenwärtigen Bewusstsein der Sterblichkeit.
2 Die Barockmalerei: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des "memento mori" und "carpe diem" in der Barockmalerei, insbesondere im Stilleben. Es beschreibt die Entwicklung des Stillebens, die Vanitas-Symbolik (Totenkopf, verblühte Blumen etc.), und deren Funktion als Ausdruck der gesellschaftlichen Zerrissenheit. Die Kapitel analysieren ausgewählte Werke verschiedener Künstler (Flegel, Heda, de Heem, Claesz, Kalf, Marrell, Bosschaert) und deren spezifische Interpretation des Themas.
3 Die Barockdichtung: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des "memento mori" und "carpe diem" in der Barockliteratur. Es beschreibt die Neuorientierung der deutschen Dichtung, die Entwicklung von Sprachgesellschaften, und die wichtigsten lyrischen Formen des Barocks. Die Arbeit analysiert die Werke bedeutender Autoren wie Gryphius (seine Sonette, die "Tränen des Vaterlandes"), Fleming, Silesius und andere, und untersucht deren Umgang mit den zentralen Themen des Barocks.
4 Die Barockmusik: Dieses Kapitel untersucht die musikalische Umsetzung der barocken Spannungen. Es beschreibt die Neuerungen in der Barockmusik, die Entwicklung der Oper, und analysiert die Werke von Monteverdi ("Orpheus"), Händel ("Alcina") und Bach ("Matthäuspassion", die "Kaffee-Kantate", "So oft ich meine Tabaks-Pfeife"). Das Kapitel betont, wie musikalische Mittel zur Darstellung von Affekten und dem Wechselspiel zwischen Lebensfreude und Todesbewusstsein eingesetzt wurden.
Schlüsselwörter
Barock, Carpe diem, Memento mori, Vanitas, Stilleben, Barockmalerei, Barockdichtung, Barockmusik, Dreißigjähriger Krieg, Tod, Vergänglichkeit, Symbolik, Allegorie, Emblem, Deutsche Literatur, Opitz, Gryphius, Monteverdi, Händel, Bach.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Barock – Carpe Diem und Memento Mori
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das barocke Leben im Spannungsfeld zwischen der Maxime "carpe diem" und dem "memento mori". Sie beleuchtet das gegensätzliche Verhältnis von Lebensfreude und Todesbewusstsein im 17. Jahrhundert und analysiert die Ursachen dieses Widerspruchs anhand von Beispielen aus Malerei, Dichtung und Musik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Spannungsverhältnis zwischen "carpe diem" und "memento mori" im Barock, die Rolle des Todesgedankens in verschiedenen Kunstformen, die Symbolik von Vanitas-Motiven, die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und der Pest, sowie die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur im Barock.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über den Barock allgemein, ein Kapitel über die Barockmalerei (insbesondere Stilleben und Vanitas-Symbolik), ein Kapitel über die Barockdichtung und ein Kapitel über die Barockmusik. Jedes Kapitel analysiert die jeweilige künstlerische Ausdrucksform im Kontext des "carpe diem" und "memento mori"-Themas.
Welche Künstler und Autoren werden behandelt?
In der Arbeit werden verschiedene Künstler der Barockmalerei wie Flegel, Heda, de Heem, Claesz, Kalf, Marrell und Bosschaert analysiert. Aus der Barockdichtung werden Autoren wie Gryphius (mit seinen Sonetten und den "Tränen des Vaterlandes"), Fleming und Silesius behandelt. In der Betrachtung der Barockmusik werden Monteverdi ("Orpheus"), Händel ("Alcina") und Bach ("Matthäuspassion", "Kaffee-Kantate", "So oft ich meine Tabaks-Pfeife") genannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Barock, Carpe diem, Memento mori, Vanitas, Stilleben, Barockmalerei, Barockdichtung, Barockmusik, Dreißigjähriger Krieg, Tod, Vergänglichkeit, Symbolik, Allegorie, Emblem, Deutsche Literatur, Opitz, Gryphius, Monteverdi, Händel und Bach.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit beleuchtet das Phänomen des Spannungsverhältnisses zwischen Lebensgenuss und Todesbewusstsein anhand von Beispielen aus verschiedenen Bereichen (Malerei, Literatur, Musik). Die Methode besteht in der detaillierten Analyse ausgewählter Werke und ihrer spezifischen Interpretation des Themas.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist die paradoxe Koexistenz von Lebensgenuss und Todesbewusstsein im Barock. Die Arbeit untersucht, wie sich dieser Widerstreit in der Kunst und Kultur manifestierte.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit analysiert?
Konkrete Beispiele umfassen Vanitas-Stilleben in der Malerei, Gryphius' Sonette und "Tränen des Vaterlandes" in der Literatur, sowie Monteverdis "Orpheus", Händels "Alcina" und Bachs Werke ("Matthäuspassion", "Kaffee-Kantate", "So oft ich meine Tabaks-Pfeife") in der Musik. Die Arbeit analysiert auch die Symbolik von Totentanz und Emblemen.
- Quote paper
- Julia Heiduk (Author), 2006, Das barocke Leben in der Spannung zwischen "memento mori" und "carpe diem", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129354