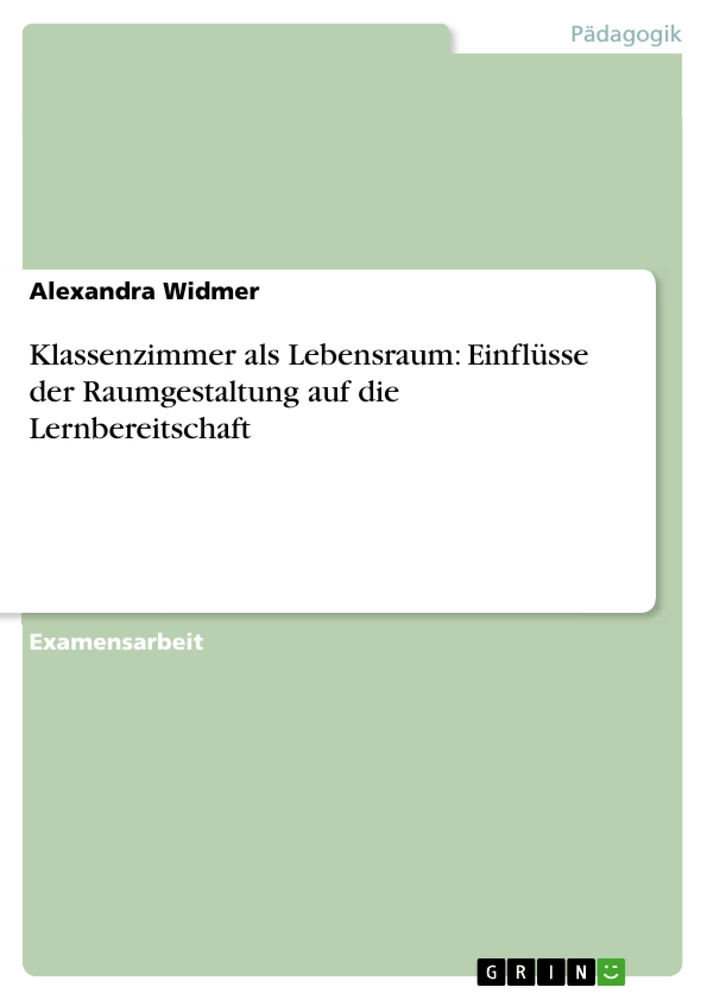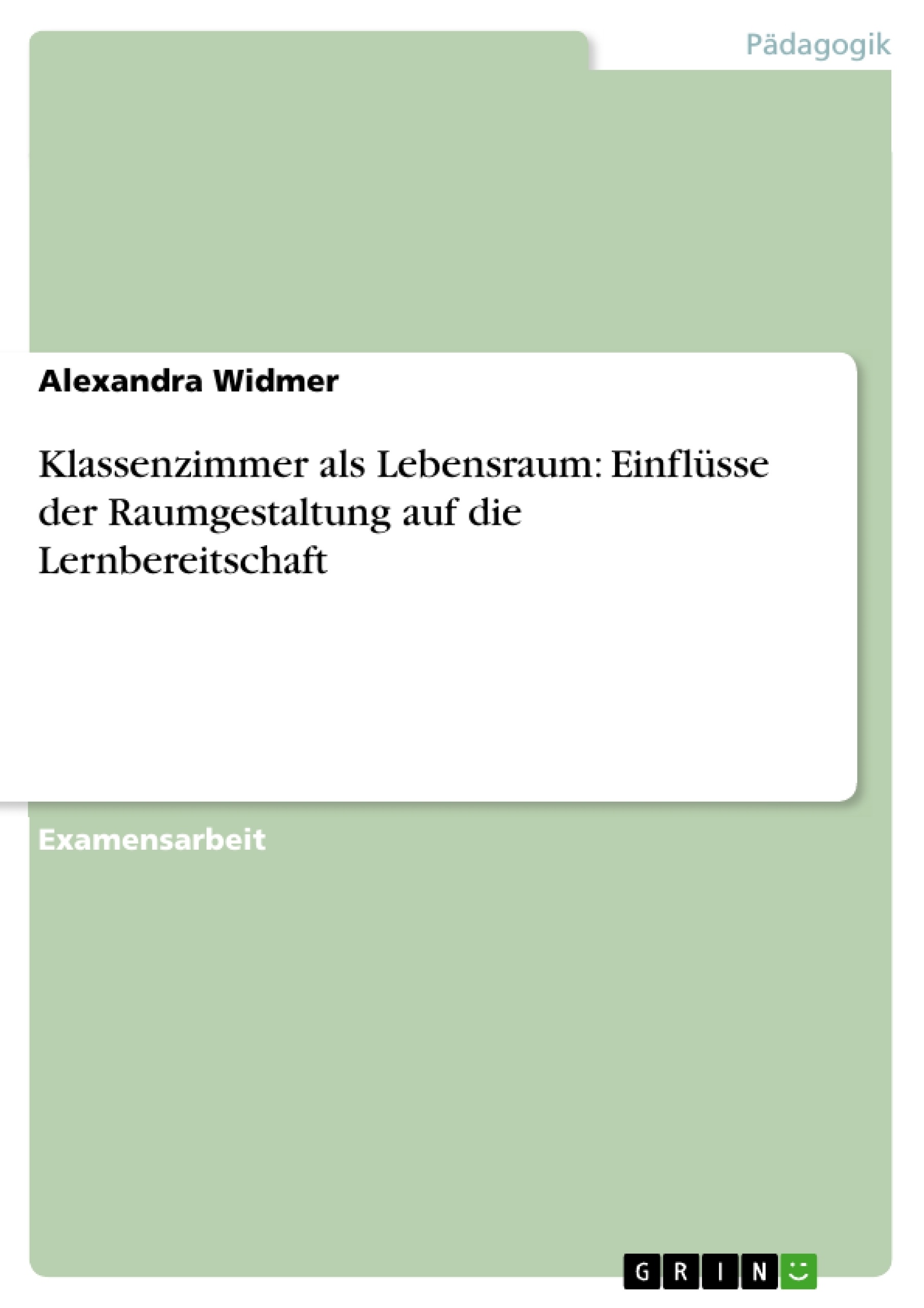„Ich hasse Klassenzimmer, die erinnern mich an meine Schulzeit.“
Für mich wäre es die absolute Horrorvorstellung, dass eine/r meiner SchülerInnen sich einmal so äußern würde. Im Volksmund sagt man doch immer so schön: „Den Kindern gehört die Zukunft.“ Ich denke aber, dass wir durch den Umgang mit unseren Kindern diese Zukunft wesentlich mitgestalten.
Kinder haben eine ganz natürliche Lebensfreude und Energie. Sie bewegen sich mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit, der die meisten Erwachsenen nur träumen können. Sie leben zunächst ohne irgendeine Konvention oder Verpflichtung und machen sich keine Gedanken darüber, wie ihr Umfeld auf sie und ihr Verhalten reagiert. Ihr Instinkt bestimmt ihre Handlungsweisen. Wie lange die Kinder diese naturgegebenen Eigenschaften beibehalten und sie ausleben können, liegt zu einem gewissen Teil bei uns, die die Kinder auf ihrem Weg, erwachsen zu werden, begleiten und deshalb sollte ihnen unsere Aufmerksamkeit gelten. Man muss Kindern die Möglichkeit geben, ihre natürlichen Charaktereigenschaften nicht unterdrücken zu müssen.
Ich denke, wir müssen genau das Gegenteil erreichen. Pädagogen sollten die individuellen Charaktere jedes einzelnen Kindes fördern. Die Umwelt muss dem Kind die Möglichkeit geben, seine Freude zu behalten, zu wachsen, sich zu entfalten, sich nicht eingeengt oder bedrängt zu fühlen und sich entwickeln zu können – eine kindgerechte Umgebung ist die Grundlage dafür.
Das Elternhaus der Kinder ist die erste Instanz, die erreichen sollte, dass die Kinder ein Gefühl dafür erhalten, sich seinen Anlagen gemäß zu verhalten. Hier kann eine Lehrperson eigentlich gar keinen Einfluss ausüben, sondern allerhöchstens eine beratende Funktion übernehmen. Mir ist aufgefallen, dass es hierfür immer vermehrter Elternratgeber und Literatur gibt, was mir zeigt, dass sich sowohl die Eltern, wie auch die Experten damit auseinander setzen und auch miteinander kommunizieren. Die kann dann beispielsweise so klingen:
„Zuerst sollten Sie überprüfen, ob die äußeren Bedingungen und das Lernumfeld Ihres Kindes wirklich optimal sind: von A wie Arbeitsplatz bis Z wie Zeiteinteilung.“
Das ist eine positive Entwicklung an der die Pädagogen anknüpfen können, denn nach dem Elternhaus folgen als nächste Ebene direkt der Kindergarten und die Schule. Die liegt dann wiederum im Entscheidungsbereich von KintergärtnerInnen und LehrerInnen, wie die Umgebung in diesen Bereichen zu gestalten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Der (Lebens)raum
- Der Raum
- Der „gelebte“ Raum
- Kinder und ihr Lebensraum
- Veränderungen im Leben der Kinder
- Der Raum
- Der Klassenraum als Lernfaktor
- Das Klassenzimmer
- Das Klassenzimmer als Lernumgebung
- Die „Lernumgebung“
- Lernumgebung im Klassenzimmer
- Die Lernumgebung bei einigen ausgewählten Reformpädagogen
- Rudolf Steiner (1861 – 1925)
- Maria Montessori (1870 – 1952)
- Peter Petersen (1884 – 1952)
- Celestin Freinet (1896 – 1966)
- Der Raum als Lernfaktor
- Der pädagogische Hintergrund des Lernraumes
- Einflüsse des Klassenraums auf die Schülerinnen
- Das Verhalten
- Die Lernbereitschaft
- Klassenraumgestaltung
- Gestaltung von Grundschulklassenzimmern
- Wichtige Faktoren bei der grundsätzlichen Ausstattung
- Die Größe und die Form
- Die Farbgestaltung
- Das Licht / Die Fenster und die Beleuchtung
- Der Bodenbelag
- Die Tische und die Stühle
- Die Sitzordnung
- Das Raumklima
- Die Akustik
- Die ästhetische Gestaltung
- Die Pflanzen
- Wichtige Faktoren bei der grundsätzlichen Ausstattung
- Interessenvertretungen bei der Klassenraumgestaltung
- Gründe für die großen Unterschiede unter den Klassenzimmern
- Mitgestaltung der Kinder
- Gestaltung von Grundschulklassenzimmern
- Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“
- Vorbereitung der Studie
- Empirische Sozialforschung
- Methoden der empirischen Sozialforschung
- Reaktive Verfahren
- Der Fragebogen
- Die Erstellung des Fragebogens
- Drei idealtypische Phasen im Forschungsablauf
- Entstehungzusammenhang
- Verwendungszusammenhang
- Begründungszusammenhang
- Vorbereitung der Studie
- Auswertung der Studie „Mein Klassenzimmer“
- Mein Klassenzimmer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler. Ziel ist es, theoretische Erkenntnisse mit empirischen Daten aus einer Schülerbefragung zu verknüpfen, um ein optimales Klassenraumkonzept zu entwickeln, welches das Wohlbefinden und den Lernerfolg der Kinder fördert.
- Der (Lebens-)Raum als Einflussfaktor auf die Psyche und das Verhalten von Kindern
- Der Klassenraum als Lernumgebung: Gestaltungsmerkmale und deren Wirkung
- Vergleich verschiedener pädagogischer Ansätze zur Raumgestaltung
- Empirische Untersuchung der Schülerwünsche und -erfahrungen bezüglich ihrer Klassenzimmer
- Entwicklung eines optimierten Klassenraumkonzeptes basierend auf Theorie und Empirie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Die Arbeit entstand aus dem persönlichen Interesse der Autorin an der Lernumgebung und Klassenraumgestaltung, basierend auf eigenen Erfahrungen in Schulen und Praktika. Ein beobachteter Widerspruch zwischen der Bedeutung der Raumgestaltung für das Lernen und deren Unterdrückung in manchen Schulen motivierte die Autorin zu dieser Untersuchung. Die Arbeit kombiniert theoretische Überlegungen mit einer empirischen Studie, die die Wünsche und Erfahrungen von Grundschulkindern zu ihren Klassenzimmern erfasst.
Einleitung: Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung des Klassenzimmers als Lebensraum für Grundschulkinder, die dort einen Großteil ihres Tages verbringen. Sie kritisiert den oft bestehenden Widerspruch zwischen dem Anspruch moderner Pädagogik auf angenehme Lernatmosphäre und der oft unzureichenden Raumgestaltung. Die Autorin betont die Notwendigkeit, die Lernumgebung aktiv mitzugestalten und an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.
Der (Lebens)raum: Dieses Kapitel erörtert den Raum im Allgemeinen und dessen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Es werden verschiedene Perspektiven (erkenntnistheoretisch, verhaltenstheoretisch, psychotherapeutisch, psychosomatisch, sozialpsychologisch) vorgestellt, um die Bedeutung des Raumes für die kindliche Entwicklung zu belegen. Es wird betont, dass Räume nicht neutral sind und eine aktive Gestaltung erforderlich ist.
Der Klassenraum als Lernfaktor: Dieses Kapitel definiert den Klassenraum als primären Lern- und Aufenthaltsort von Grundschulklassen. Es werden die Anforderungen an einen kindgerechten Lernraum, die Bedeutung der Lernumgebung und -atmosphäre, sowie die Ansätze verschiedener Reformpädagogen (Steiner, Montessori, Petersen, Freinet) hinsichtlich der Raumgestaltung detailliert erläutert. Die Autorin hebt die Bedeutung des pädagogischen Hintergrundes der Raumgestaltung hervor.
Klassenraumgestaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Gestaltung von Grundschulklassenzimmern. Es werden wichtige Faktoren wie Größe und Form, Farbgestaltung, Lichtverhältnisse, Bodenbelag, Möbel (Tische und Stühle), Sitzordnung, Raumklima, Akustik, ästhetische Gestaltung und die Rolle von Pflanzen ausführlich diskutiert. Die verschiedenen Interessen der an der Raumgestaltung beteiligten Akteure (Schulträger, Eltern, Lehrer, Schüler, Hausmeister, Reinigungskräfte, Schulleitung) werden beleuchtet. Der Einfluss der Mitgestaltung durch die Kinder auf das Wohlbefinden und das Verhalten wird hervorgehoben.
Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“: Dieses Kapitel beschreibt die Vorbereitung und Durchführung einer empirischen Studie mit 312 Grundschulkindern. Es erläutert die Methodik (Fragebogen) und die theoretischen Grundlagen der empirischen Sozialforschung. Der Fragebogen wird detailliert vorgestellt.
Schlüsselwörter
Klassenraumgestaltung, Lernumgebung, Lernbereitschaft, Grundschule, Reformpädagogik, Empirische Sozialforschung, Schülerbefragung, Raumklima, Farbpsychologie, Wohlbefinden, Mitgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler. Sie verbindet theoretische Erkenntnisse mit empirischen Daten einer Schülerbefragung, um ein optimales Klassenraumkonzept zu entwickeln, das Wohlbefinden und Lernerfolg fördert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den (Lebens-)Raum als Einflussfaktor auf Kinder, den Klassenraum als Lernumgebung, verschiedene pädagogische Ansätze zur Raumgestaltung (Steiner, Montessori, Petersen, Freinet), eine empirische Untersuchung der Schülerwünsche und -erfahrungen, und die Entwicklung eines optimierten Klassenraumkonzeptes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Vorwort, Einleitung, Der (Lebens)raum, Der Klassenraum als Lernfaktor, Klassenraumgestaltung, Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“, Auswertung der Studie „Mein Klassenzimmer“, Mein Klassenzimmer und Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Wie ist die empirische Studie aufgebaut?
Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“ basiert auf einem Fragebogen, der an 312 Grundschulkinder verteilt wurde. Die Methodik stützt sich auf Prinzipien der empirischen Sozialforschung, inklusive reaktiver Verfahren. Die Studie umfasst die Phasen Entstehungzusammenhang, Verwendungszusammenhang und Begründungszusammenhang.
Welche Faktoren der Klassenraumgestaltung werden betrachtet?
Wichtige Faktoren der Klassenraumgestaltung sind Größe und Form des Raumes, Farbgestaltung, Lichtverhältnisse, Bodenbelag, Möbel (Tische und Stühle), Sitzordnung, Raumklima, Akustik, ästhetische Gestaltung und die Rolle von Pflanzen. Die Interessen verschiedener Akteure (Schulträger, Eltern, Lehrer, Schüler etc.) werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Reformpädagogen werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ansätze von Rudolf Steiner, Maria Montessori, Peter Petersen und Celestin Freinet hinsichtlich der Raumgestaltung und deren Auswirkungen auf das Lernen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Klassenraumgestaltung, Lernumgebung, Lernbereitschaft, Grundschule, Reformpädagogik, Empirische Sozialforschung, Schülerbefragung, Raumklima, Farbpsychologie, Wohlbefinden, Mitgestaltung.
Welche Ziele verfolgt die Autorin mit dieser Arbeit?
Die Autorin verfolgt das Ziel, theoretische Erkenntnisse über den Einfluss der Raumgestaltung auf das Lernen mit empirischen Daten zu verbinden, um ein optimiertes Klassenraumkonzept zu entwickeln, das das Wohlbefinden und den Lernerfolg der Kinder verbessert.
Wie wird der Fragebogen in der Studie eingesetzt?
Der Fragebogen dient als Instrument zur Erfassung der Wünsche und Erfahrungen der Grundschulkinder bezüglich ihrer Klassenzimmer. Seine Erstellung und die damit verbundenen methodischen Überlegungen werden detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der theoretischen Analyse und der empirischen Studie zusammen und gibt Empfehlungen für eine optimale Klassenraumgestaltung, die das Wohlbefinden und die Lernbereitschaft der Kinder fördert. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Fazit" enthalten.
- Quote paper
- Lehrerin Alexandra Widmer (Author), 2006, Klassenzimmer als Lebensraum: Einflüsse der Raumgestaltung auf die Lernbereitschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129225