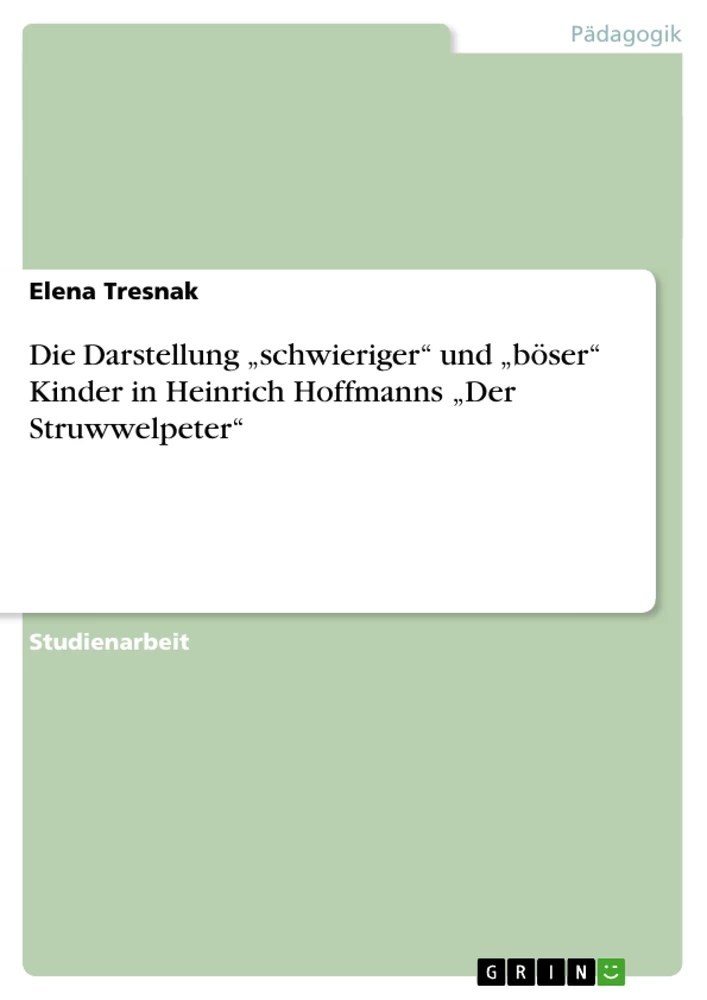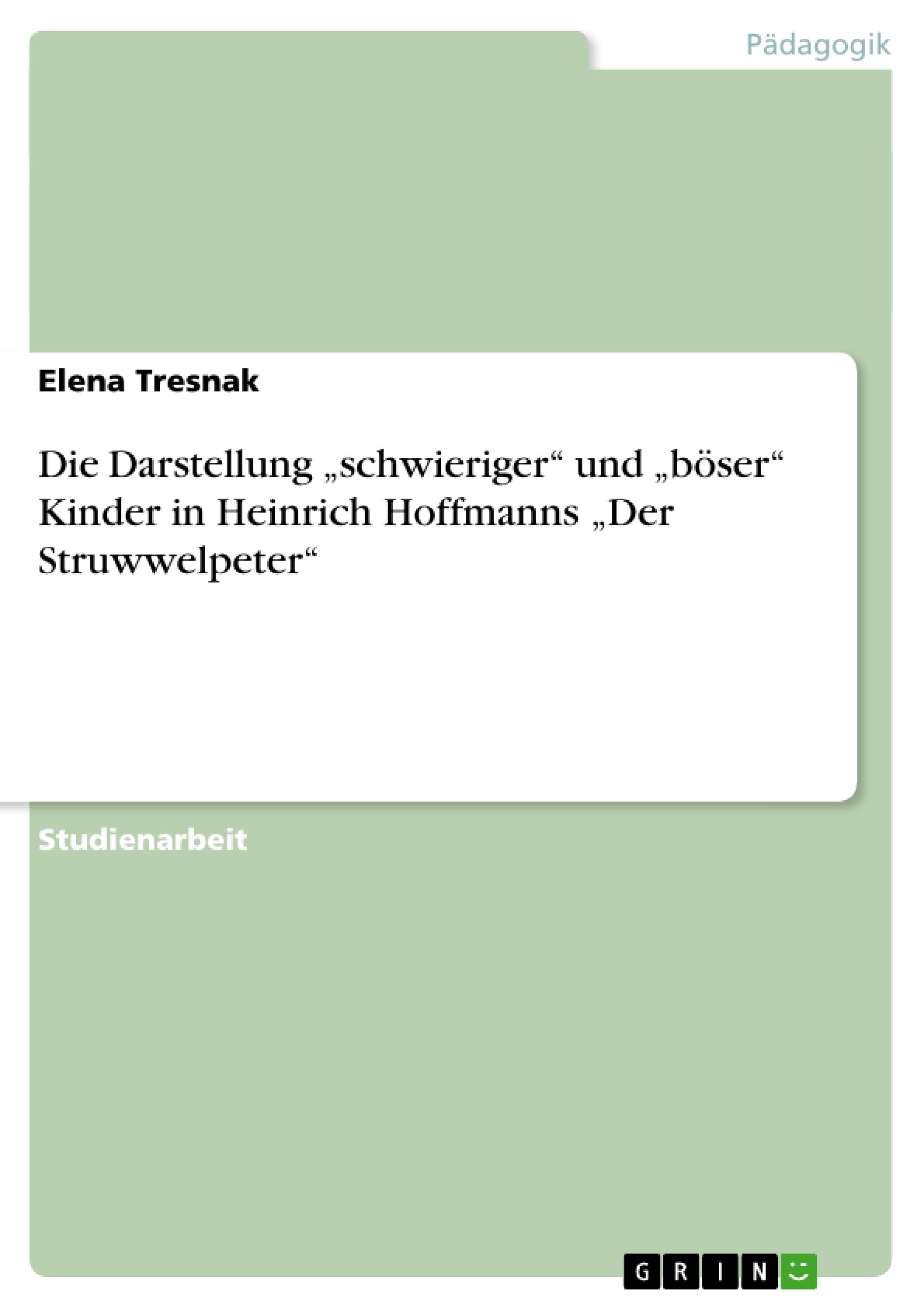„Sieh einmal, hier steht er, pfui, der Struwwelpeter!“ Es wird in Deutschland wohl kaum einen Erwachsenen geben, dem diese Zeilen und die dazu gehörigen Bilder nicht aus eigener Kindheit in Erinnerung geblieben wären und auch viele Kinder und Jugendliche unserer Generation wissen diese Verse noch zuzuordnen. Und auch wenn die im „Struwwelpeter“ formulierten bürgerlichen Erziehungsziele längst nicht mehr unserer Zeit entsprechen, ist Hoffmanns Werk längst zu einem Klassiker deutscher Kinderliteratur geworden. In dieser Ausarbeitung geht es mir jedoch nicht darum, Gründe für die Popularität des Hoffmannschen „Struwwelpeter“ nachzuvollziehen, sondern den Blick vielmehr auf die Protagonisten in seinem Buch, d.h. die Kinder zu fokussieren.
Im Rahmen unseres Seminars „Pathologie der Erziehung II“ haben wir uns unter anderem mit dem Thema „schwierige“ und „böse“ Kinder beschäftigt. Ich möchte nun anhand von Hoffmanns Werk, das er 1844 verfasste, exemplarisch darstellen, wie um die Jahrhundertmitte im Allgemeinen literarisch mit dem Thema „schwierige“ Kinder umgegangen wurde.
Den Ausgangspunkt der Hausarbeit bildet meine These, die davon ausgeht, dass die Darstellung „unartiger“ und „störrischer“ Kinder im „Struwwelpeter“ und die vermittelten Erziehungsinhalte Ausdruck einer repressiven und nicht mehr zeitgemäßen Pädagogik sind. Um diese These zu veri-, bzw. falsifizieren, ist es nötig, sowohl das Buch selbst zu analysieren als auch die „äußeren“, also die gesellschaftlichen Umstände näher zu betrachten.
Deshalb habe ich meinen Hauptteil in zwei Abschnitte gegliedert. In den einführenden Informationen stelle ich zunächst den Autor und die Entstehungsgeschichte des „Struwwelpeter“ vor und werfe anschließend einen kurzen Blick auf die Rezeptionsgeschichte des Werkes.
Der zweite Abschnitt des Hauptteils trägt die Überschrift „schwierige“ und „böse“ Kinder. Hier stelle ich zuerst den Inhalt des Hoffmannschen Werkes, d.h. die einzelnen Geschichten über die Kinder mitsamt ihrem („Fehl“)-Verhalten“ vor.
Im nächsten Punkt setze ich mich mit den wichtigsten Erziehungszielen der bürgerlichen Gesellschaftsordnung von 1850 auseinander und vergleiche diese mit den im „Struwwelpeter“ vermittelten pädagogischen Inhalten.
Der letzte Punkt des Hauptteils bildet die Interpretation zweier repräsentativer Geschichten des „Struwwelpeters“. Hier werde ich die Hoffmannsche Darstellungsweise „schwieriger“ und „böser“ Kinder detailliert analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema, Aufbau, Motivation
- These
- Hauptteil
- Einführende Informationen
- Autor und Entstehungsgeschichte des „Struwwelpeter“
- Die Rezeptionsgeschichte des Buches
- „Schwierige“ und „böse“ Kinder
- Darstellung „schwieriger“ und „böser“ Kinder im „Struwwelpeter“
- Die bürgerliche Gesellschaftsordnung um 1850 und ihre Erziehungsinhalte
- Interpretation und Analyse einzelner Geschichten
- Schluss
- Zusammenfassung und Verifizieren, bzw. Falsifizieren o.g. These
- LITERATURLISTE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ aus pädagogischer Sicht und untersucht, wie das Buch mit dem Thema „schwierige“ Kinder umging. Die Arbeit zielt darauf ab, die im „Struwwelpeter“ vermittelten Erziehungsinhalte zu analysieren und zu bewerten, ob sie Ausdruck einer repressiven und nicht mehr zeitgemäßen Pädagogik sind.
- Darstellung „schwieriger“ und „böser“ Kinder im „Struwwelpeter“
- Erziehungsinhalte des „Struwwelpeter“ im Kontext der bürgerlichen Gesellschaftsordnung um 1850
- Analyse der Darstellungsweise „schwieriger“ und „böser“ Kinder in ausgewählten Geschichten
- Bewertung der pädagogischen Inhalte des „Struwwelpeter“
- Rezeption und Einfluss des „Struwwelpeter“ auf die deutsche Kinderliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die These vor, dass die Darstellung „unartiger“ und „störrischer“ Kinder im „Struwwelpeter“ und die vermittelten Erziehungsinhalte Ausdruck einer repressiven und nicht mehr zeitgemäßen Pädagogik sind.
Der Hauptteil beginnt mit einführenden Informationen über den Autor Heinrich Hoffmann und die Entstehungsgeschichte des „Struwwelpeter“. Anschließend wird die Rezeptionsgeschichte des Buches beleuchtet, die zeigt, dass es seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1845 zu einem Klassiker der deutschen Kinderliteratur geworden ist.
Im zweiten Abschnitt des Hauptteils werden die einzelnen Geschichten des „Struwwelpeter“ vorgestellt und die Darstellung „schwieriger“ und „böser“ Kinder analysiert. Es wird gezeigt, dass die Kinder in den Geschichten oft für ihr „Fehlverhalten“ bestraft werden, was als Ausdruck einer repressiven Pädagogik interpretiert werden kann.
Im nächsten Punkt werden die wichtigsten Erziehungsziele der bürgerlichen Gesellschaftsordnung von 1850 vorgestellt und mit den im „Struwwelpeter“ vermittelten pädagogischen Inhalten verglichen. Es wird deutlich, dass die im Buch vermittelten Erziehungsinhalte stark von den damaligen gesellschaftlichen Normen geprägt waren.
Der letzte Punkt des Hauptteils beinhaltet die Interpretation zweier repräsentativer Geschichten des „Struwwelpeters“, nämlich die Geschichte des „Struwwelpeters“ und die des „bösen Friederichs“. Die Analyse zeigt, dass Hoffmann die „schwierigen“ und „bösen“ Kinder in seinen Geschichten oft als Warnbeispiele für andere Kinder darstellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Struwwelpeter“, Heinrich Hoffmann, Kinderliteratur, Pädagogik, bürgerliche Gesellschaftsordnung, Erziehungsinhalte, „schwierige“ Kinder, „böse“ Kinder, Repression, Moral, Warnbeispiele, Rezeption, Klassiker.
- Arbeit zitieren
- Elena Tresnak (Autor:in), 2005, Die Darstellung „schwieriger“ und „böser“ Kinder in Heinrich Hoffmanns „Der Struwwelpeter“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/128958