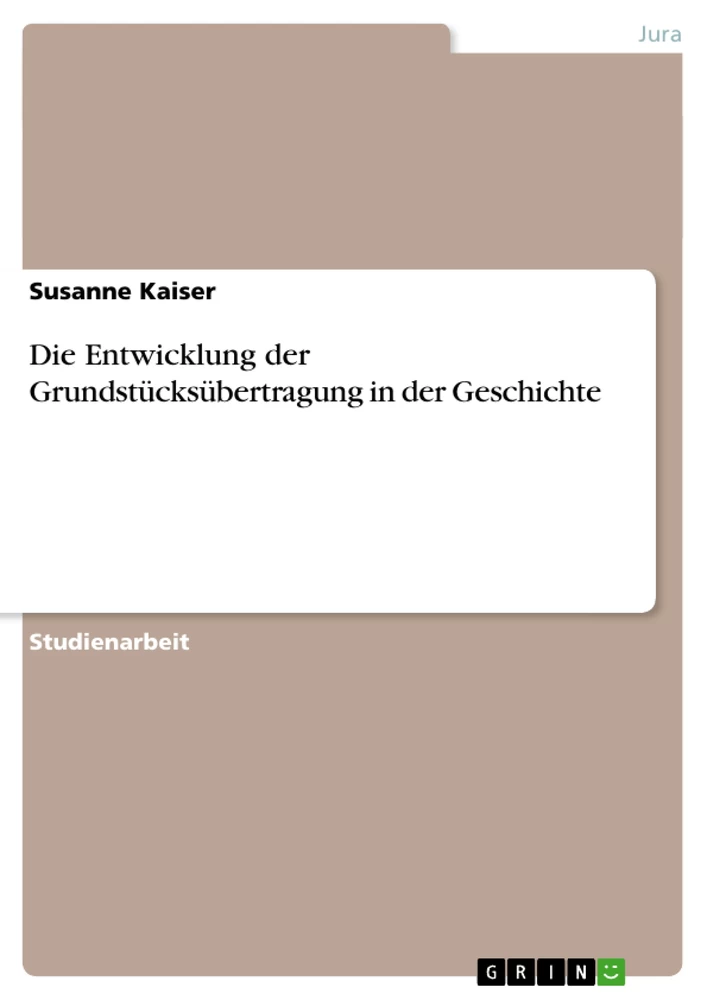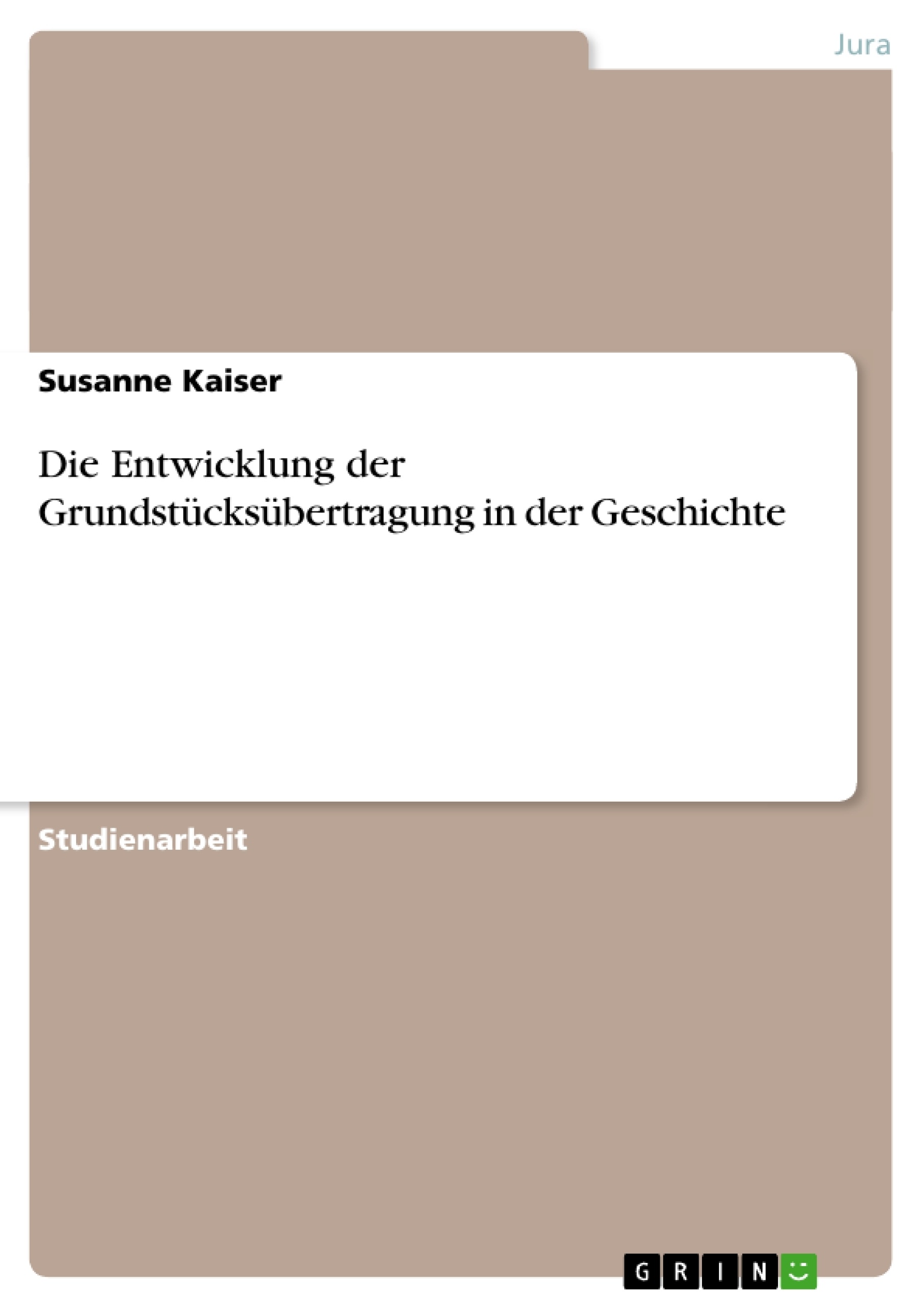Die Bedeutung von Grundstücken und deren Übertragung ist für die heutige Gesellschaft von fast allumfassender Bedeutung und unterlag in der Geschichte der Menschheit ständigen Veränderungen.
Solche sollen in der vorliegenden Arbeit dargestellt werden. Diese Abhandlung wurde im Rahmen eines Rechtsgeschichtlichen Seminars mit dem Titel Schauplätze des Verfahrens verfasst. Zu dieser Zeit stand das Ackerland allen Genossen innerhalb einer Gemeinschaft zu und konnte daher auch frei von jedem genutzt werden. Nach und nach wurde von dem ständigen Wechsel des Lebensraumes abstand genommen und das Sesshaft werden nahm bei den unterschiedlichen Stämmen stark zu, wodurch sich aber auch die dauerhafte Verwendung des Bodens durchsetzen musste. Trotz all dieser Veränderungen im Lebenswandel der Menschen war die rechtsgeschäftliche Einigung und die Übertragung von Grundstücken immer noch eine Ausnahme, da jeder neu entstehende Hof ausreichend Land zugeteilt bekam, um den Genossen und seine Familie zu ernähren. Ein Grundstückserwerb oder gar eine Veräußerung waren daher zu dieser Zeit überflüssig und entwickelten sich erst langsam nach und nach aus der Nutzungs-übertragung. Bei dieser Verteilung wurde Land frei übergeben, um wachsenden Familien eine ausreichende Versorgung zu ermöglichen. Es ist zwar geklärt, dass es hierbei bestimmte öffentliche Handlungen gab, wie die Übergabe des Landstückes vor allen Mitgliedern der Gemeinschaft, jedoch sind keine genauen Formen der Nutzungs-übertragung bekannt, da es an urkundlichen Aufzeichnungen fehlt. Auf Grund dieser Veränderungen nahm in der Folgezeit auch die Grundstücksübertragung zu. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Grundstücksübereignung vor der Zeit der Volksrechte
- III. Die Grundstücksübertragung im frühen Mittelalter
- 1. Die Übereignung der Grundstücke bei den Germanen
- a) Sala
- b) Investitura
- aa) Apprehensionsakt
- bb) Auflassung
- (1) Erdscholle
- (2) Festuca
- (3) Wadium
- (4) Andalangus
- (5) Halm
- (6) Urkunde
- (7) Zaunsprung
- (8) Zeichen für Grundstücksübereignungen von Kirchengrundstücken
- (9) Das Pars – Pro – Toto – Symbol
- (10) Zwischenergebnis
- c) Grundstücksübertragung bei den Germanen und ihre römische Grundlage
- 2. Die weitere Entwicklung im Frühen Mittelalter
- 3. Die Bedeutung von Klöstern für die Grundstücksübertragung im Frühen Mittelalter
- 4. Die Entwicklung von Lehen im Frühen Mittelalter
- 5. Zwischenergebnis über die Entwicklung im Frühen Mittelalter
- 1. Die Übereignung der Grundstücke bei den Germanen
- IV. Die Entwicklung der Grundstücksübertragung im Hoch- und Spätmittelalter
- 1. Die gerichtliche Auflassung
- 2. Die Entwicklung der Grundstücksübertragung in den Städten
- 3. Das Lehnrecht auf dem Lande
- 4. Der Höhepunkt und der Ausklang des Mittelalters, sowie der Übergang zur Neuzeit
- V. Grundstücksübertragung in der Neuzeit
- 1. Veränderungen im 18. Jahrhundert
- 2. Veränderungen im 19. Jahrhundert
- 3. Rückbesinnung und erneute Aufnahme von früheren Errungenschaften
- V. Die heutigen Verhältnisse seit Beginn des 20. Jahrhunderts
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung der Grundstücksübertragung in Deutschland von der vorrömischen Zeit bis ins 20. Jahrhundert nachzuzeichnen und die dabei stattfindenden Rechtsänderungen zu analysieren. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Methoden der Grundstücksübertragung, den sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Bedeutung von Rechtsinstituten wie dem Lehnwesen und dem Grundbuch.
- Entwicklung der Grundstücksübertragung bei den Germanen
- Einfluss des römischen Rechts auf die germanische Praxis
- Bedeutung des Lehnswesens für den Grundbesitz
- Entstehung und Entwicklung des Grundbuchs
- Die Bauernbefreiung und ihre Folgen für den Grundstücksverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Grundstücksübertragung ein und betont deren historische Bedeutung und ständigen Wandel. Sie kündigt die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung an.
II. Die Grundstückübereignung vor der Zeit der Volksrechte: Dieses Kapitel beschreibt die Situation vor der Entwicklung von festen Rechtsordnungen. Ackerland stand der Gemeinschaft zur Verfügung. Mit zunehmender Sesshaftigkeit entstand ein Bedürfnis nach geregelter Landnutzung und -übertragung, die anfänglich jedoch eher die Ausnahme bildete, da genügend Land für alle vorhanden war. Die Übergabe von Land geschah in Form öffentlicher Handlungen, deren genaue Ausgestaltung jedoch aufgrund fehlender schriftlicher Quellen unklar bleibt.
III. Die Grundstücksübertragung im frühen Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die Grundstücksübertragung bei den Germanen, die sich in die "Sala" (schuldrechtliche Einigung) und die "Investitura" (Besitzübertragung) gliederte. Die "Investitura" umfasste den Apprehensionsakt und die Auflassung. Verschiedene Symbole wie Erdschollen, Festuca, Wadium und Andalangus wurden bei der Auflassung verwendet. Das Kapitel untersucht auch den Einfluss des römischen Rechts, insbesondere unter Kaiser Konstantin, auf die germanische Grundstücksübertragung und die Rolle von Klöstern beim Landbesitz. Es beleuchtet die Entstehung des Lehnswesens, die Pflichten von Lehnsherren und Vasallen, sowie die Umwandlung von Allod in Lehen und die Integration der Bauern in das Lehnsystem.
IV. Die Entwicklung der Grundstücksübertragung im Hoch- und Spätmittelalter: Dieses Kapitel behandelt die zunehmende Bedeutung der gerichtlichen Auflassung vor der freiwilligen Gerichtsbarkeit und die damit verbundenen Prozeduren, einschließlich des Erbenlaubs. Es beschreibt die Entwicklung der Grundstücksübertragung in den Städten, mit der Entstehung von Vorläufern des Grundbuchs und dem Rückgang symbolischer Handlungen. Das Kapitel analysiert auch das Lehnrecht auf dem Lande, die Mehrfachberechtigung an Grund und Boden (dominium directum und utile), die verschiedenen Arten des Lehnerwerbs (Ersterwerb, Erbgang, Ersitzung), und die verschiedenen Lehnsarten. Der Höhepunkt und Ausklang des Lehnsystems im späten Mittelalter werden ebenfalls thematisiert.
V. Grundstücksübertragung in der Neuzeit: Das Kapitel behandelt die Veränderungen in der Grundstücksübertragung während der Neuzeit, beginnend mit der Allodifikation im 18. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Reformen des 19. Jahrhunderts, insbesondere der Bauernbefreiung und dem Regulierungsedikt von 1811. Die Kapitel analysiert die Probleme der Bauern nach der Befreiung und die Entwicklung von Alternativen wie der Allmende. Die Wiederentdeckung und Erweiterung des Grundbuchsystems in Sachsen und Preußen wird ebenfalls behandelt, einschließlich der Einführung des Abstraktionsprinzips.
Schlüsselwörter
Grundstücksübertragung, Germanenrecht, Römisches Recht, Lehnwesen, Allod, Investitura, Auflassung, Grundbuch, Bauernbefreiung, Allodifikation, Abstraktionsprinzip, Sachsenspiegel, Erbenlaub, Immobiliarsachenrecht, Eigentum, Besitz.
Häufig gestellte Fragen zur historischen Entwicklung der Grundstücksübertragung in Deutschland
Was behandelt dieses Dokument?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Grundstücksübertragung in Deutschland, von der vorrömischen Zeit bis ins 20. Jahrhundert. Es analysiert die verschiedenen Methoden der Grundstücksübertragung, die sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Bedeutung von Rechtsinstituten wie dem Lehnwesen und dem Grundbuch.
Welche Epochen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Grundstücksübertragung in der vorrömischen Zeit, im frühen Mittelalter, im Hoch- und Spätmittelalter und in der Neuzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
Welche Methoden der Grundstücksübertragung werden beschrieben?
Es werden verschiedene Methoden beschrieben, darunter die bei den Germanen üblichen "Sala" (schuldrechtliche Einigung) und "Investitura" (Besitzübertragung) mit ihren jeweiligen Unterformen wie Apprehensionsakt und Auflassung (unter Verwendung von Symbolen wie Erdschollen, Festuca, Wadium etc.). Die gerichtliche Auflassung im Hoch- und Spätmittelalter, die Entwicklung in den Städten und die Veränderungen in der Neuzeit mit der Allodifikation und den Reformen des 19. Jahrhunderts werden ebenfalls detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielte das römische Recht?
Das Dokument untersucht den Einfluss des römischen Rechts auf die germanische Praxis der Grundstücksübertragung, insbesondere unter Kaiser Konstantin.
Welche Bedeutung hatte das Lehnwesen?
Das Lehnwesen wird als wichtiges Rechtsinstitut für den Grundbesitz analysiert, einschließlich der Entstehung, Entwicklung, verschiedener Lehnsarten und des Übergangs vom Allod zum Lehen. Die Pflichten von Lehnsherren und Vasallen sowie die Integration der Bauern in das Lehnsystem werden beleuchtet.
Wie wird die Entwicklung des Grundbuchs beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Grundbuchs, beginnend mit Vorläufern im Hochmittelalter bis hin zur Wiederentdeckung und Erweiterung in Sachsen und Preußen in der Neuzeit, einschließlich der Einführung des Abstraktionsprinzips.
Welche Rolle spielte die Bauernbefreiung?
Die Bauernbefreiung und ihre Folgen für den Grundstücksverkehr werden analysiert, einschließlich der Probleme der Bauern nach der Befreiung und der Entwicklung von Alternativen wie der Allmende.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Grundstücksübertragung, Germanenrecht, Römisches Recht, Lehnwesen, Allod, Investitura, Auflassung, Grundbuch, Bauernbefreiung, Allodifikation, Abstraktionsprinzip, Sachsenspiegel, Erbenlaub, Immobiliarsachenrecht, Eigentum, Besitz.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Es gliedert sich in Kapitel, die die Entwicklung der Grundstücksübertragung in den verschiedenen historischen Epochen chronologisch behandeln.
- Quote paper
- Susanne Kaiser (Author), 2008, Die Entwicklung der Grundstücksübertragung in der Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/128677