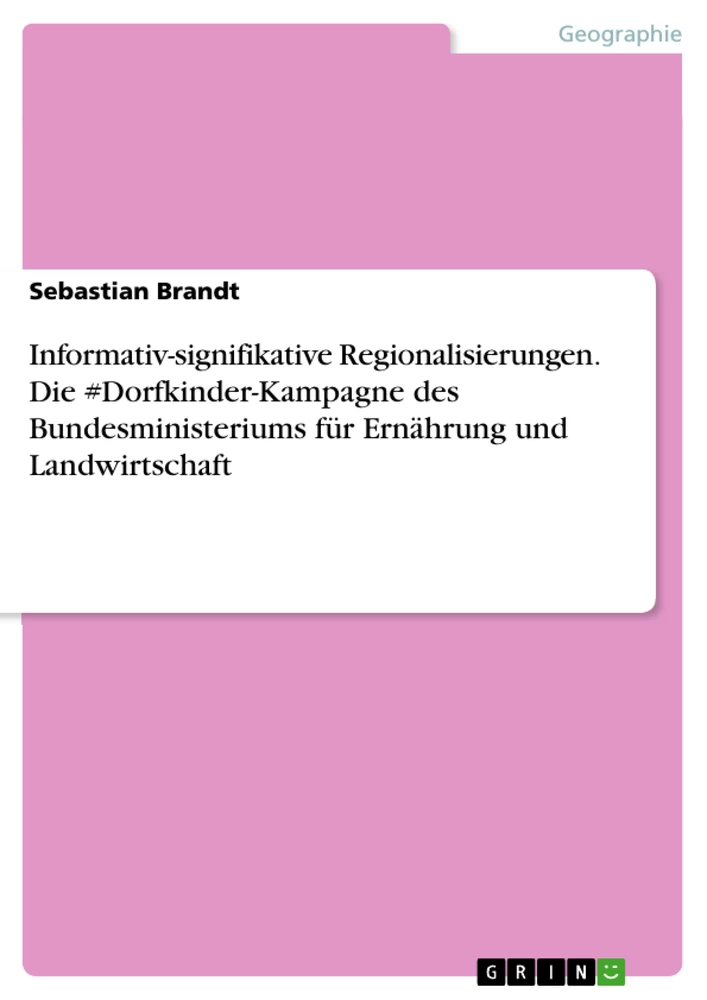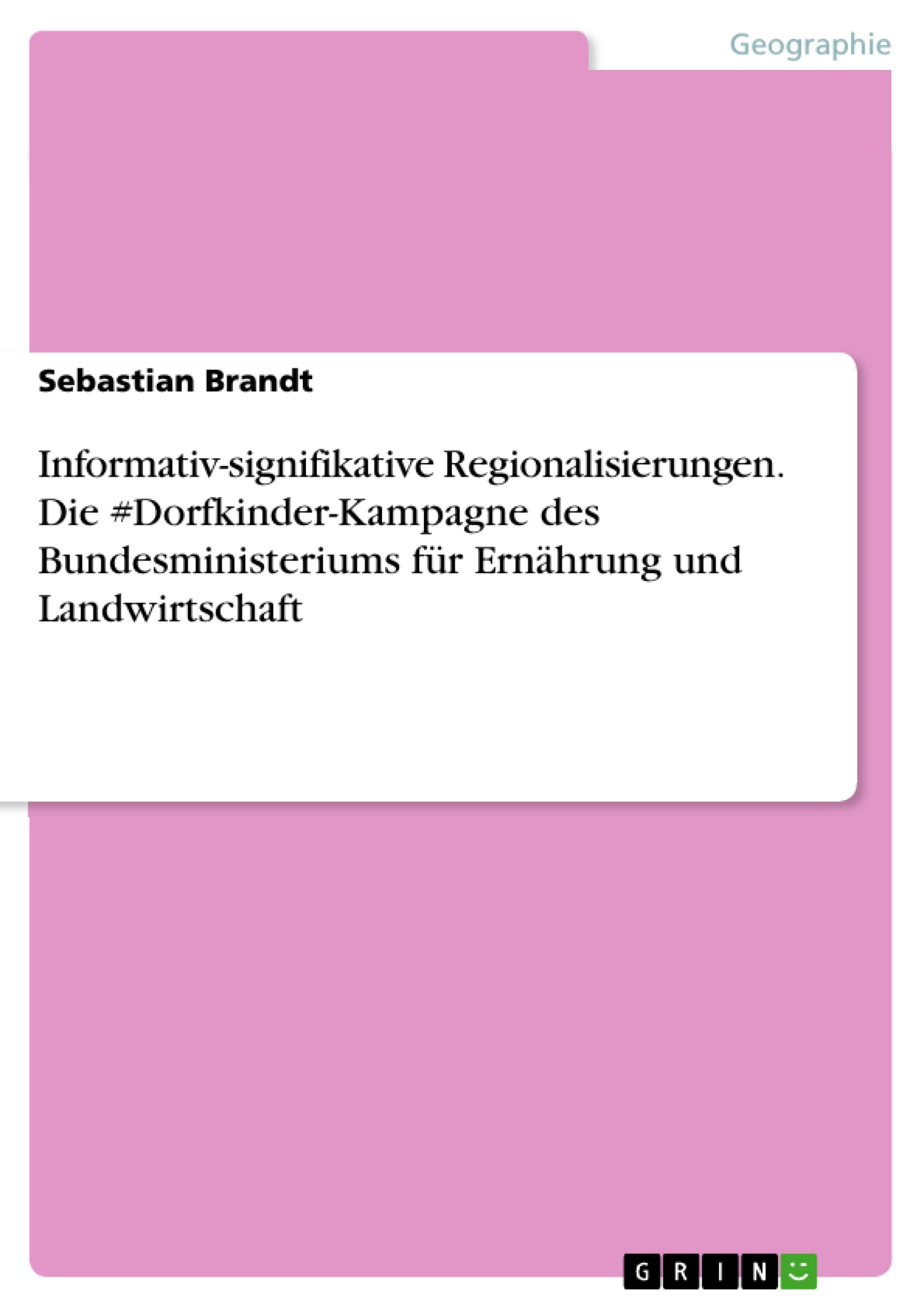Die Arbeit setzt sich mit der #Dorfkinder-Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auseinander. Dabei sind folgende Fragen aus der Sozialgeographie relevant: Welche Implikationen bringt der Raum als solches für unser Handeln überhaupt mit sich? Welche Räume erlangen wie und unter welchen Voraussetzungen Bedeutung? Wie sind die vielfältigen Informationsflüsse, denen wir ausgesetzt sind, daran beteiligt?
Wir leben in einer globalisierten und vernetzten Welt, in der unser alltägliches Handeln in vielen Lebensbereichen immer weniger Notwendigkeit an unsere unmittelbare, räumliche Umwelt geknüpft ist, zum Beispiel durch moderne Kommunikations- oder Transportmöglichkeiten. Regionale Traditionen verlieren an Bedeutung und wir sind durch viele Alltagspraktiken in Globalisierungsprozesse eingebunden, was vermuten lassen könnte, dass Räumlichkeit, zumindest lokal, durch ihre scheinbare Überwindbarkeit an Bedeutung verliert. Gleichzeitig ist es uns aber wie nie zuvor möglich unterschiedlichste Weltbilder oder Bezüge zu unserer Umwelt zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen
- Informativ-signifikative Regionalisierungen
- Geographien der Information
- Geographien symbolischer Aneignungen
- #Dorfkinder - so stärkt das BMEL das Leben auf dem Land
- #Dorfkinder-Kampagne als Forschungsgegenstand der Geographien der Information und Geographien symbolischer Aneignung
- #Dorfkinder - Geographien der Information
- #Dorfkinder - Geographien symbolischer Aneignungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen und analysiert den Einfluss von Informationsflussen auf die Bedeutungskonstitution von Räumen anhand der #Dorfkinder-Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ziel ist es, die Entstehung und Verbreitung von Regionalisierungen in der spät-modernen Gesellschaft zu untersuchen und dabei insbesondere den Zusammenhang zwischen Informationsmedien, symbolischen Aneignungen und Wiederverankerungsprozessen zu beleuchten.
- Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen
- Informativ-signifikative Regionalisierungen
- Geographien der Information
- Geographien symbolischer Aneignungen
- Wiederverankerungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Forschungsstand zur Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen vor und führt in das Thema der Arbeit ein. Das Kapitel „Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierung“ erläutert die Theorie von Benno Werlen und stellt die drei Haupttypen von Regionalisierungen - produktiv-konsumtive, normativ-politische und informativ-signifikative Regionalisierungen - vor. Im Kapitel „Informativ-signifikative Regionalisierungen“ werden die beiden Bereiche „Geographien der Information“ und „Geographien symbolischer Aneignung“ näher beleuchtet. Es werden die Mechanismen und Folgen der Informationsübermittlung sowie die Konstruktion von symbolischen Bedeutungen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen, insbesondere mit informativ-signifikativen Regionalisierungen, Geographien der Information, Geographien symbolischer Aneignungen, Wiederverankerung, Informationsflüsse, Bedeutungskonstitution und symbolische Bezüge. Die #Dorfkinder-Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft dient als Fallbeispiel für die empirische Untersuchung dieser Themen.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Brandt (Autor:in), 2022, Informativ-signifikative Regionalisierungen. Die #Dorfkinder-Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1285457