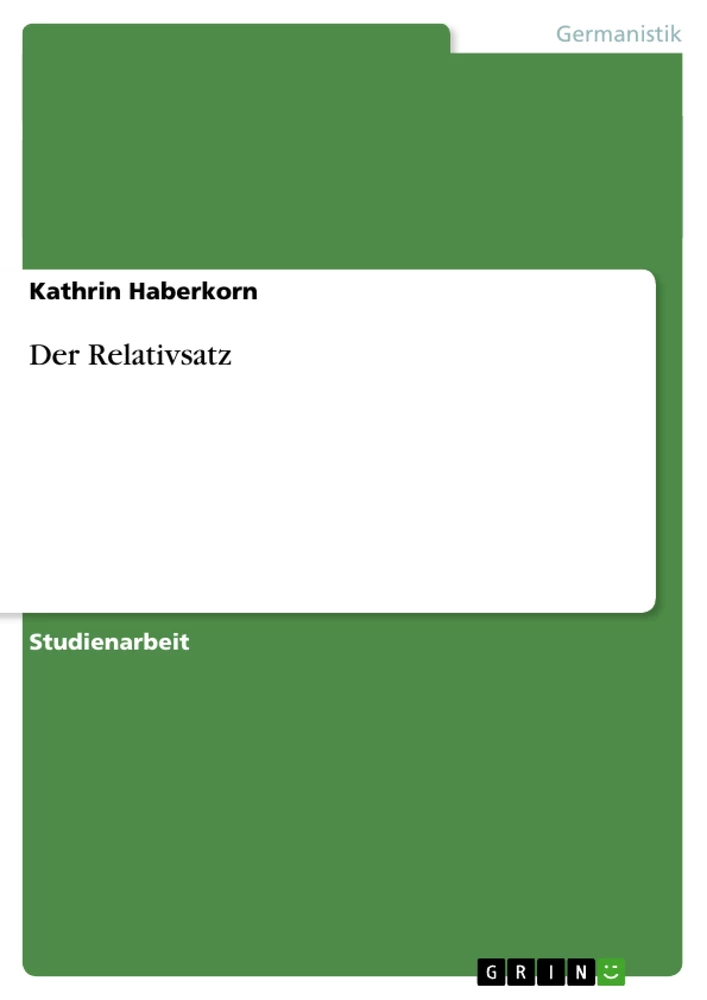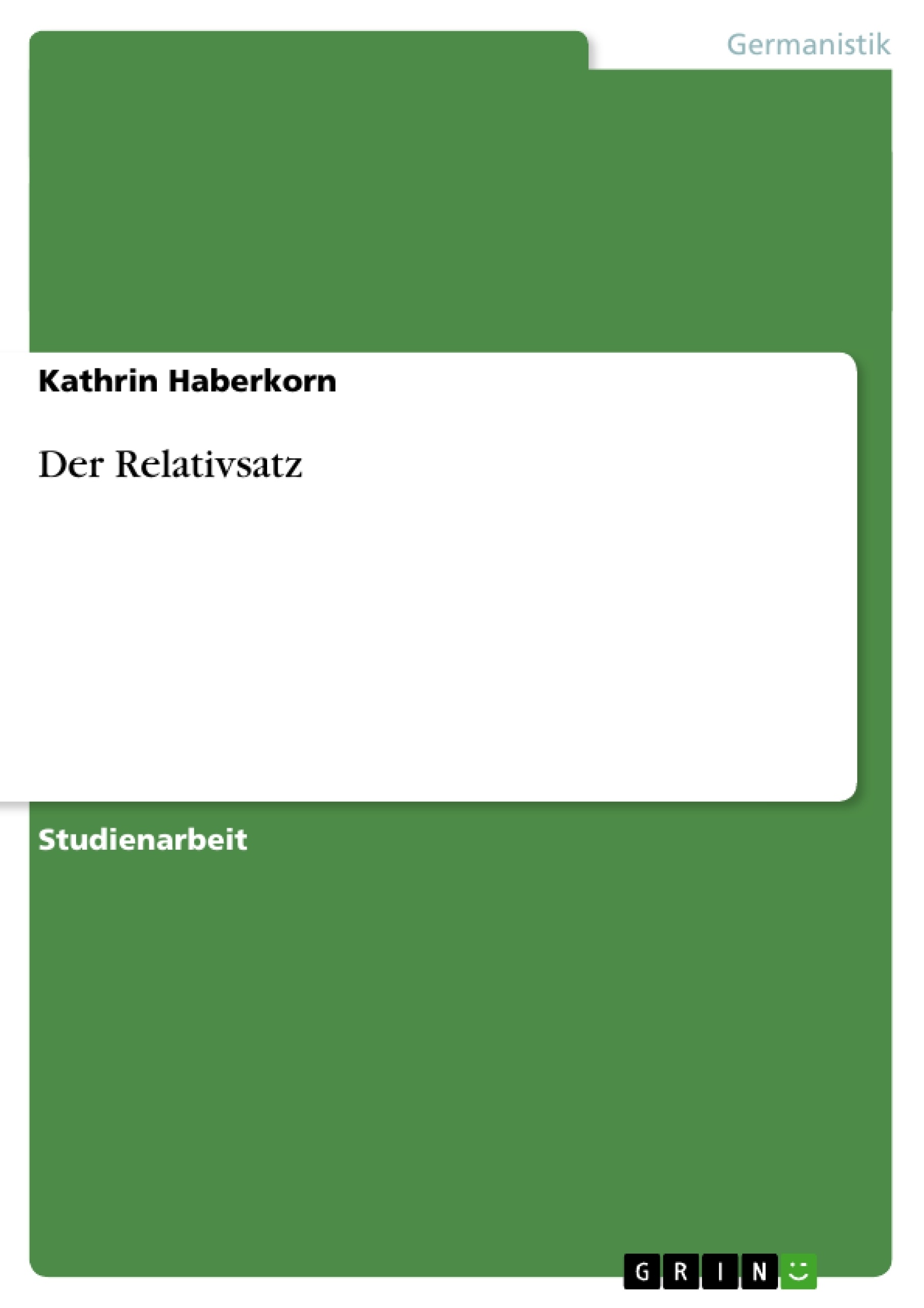Das Deutsche verfügt über eine Vielzahl von Nebensätzen. Einen wichtigen Nebensatztypus stellt der Relativsatz dar, der in der folgenden Arbeit näher untersucht werden soll. Zunächst folgt eine knappe Darstellung der Relativadverbien und Relativpronomina, mit deren Hilfe Relativsätze eingeleitet werden. Nach einer kleinen Abhandlung der freien Relativsätze erfolgt die an den DUDEN angelehnte Unterscheidung zwischen nicht notwendigen und notwendigen Relativsätzen. An die Differenzierung von restriktiven und appositiven Relativsätzen schließt sich die Darstellung der Relativsätze im Einzelnen an. Abschließend werden Probleme bei der Bildung von Relativsätzen untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführendes
- 2. Allgemeines zum Relativsatz
- 2.1. Relativadverbien
- 2.2. Relativpronomen
- 3. Freie Relativsätze
- 4. Nicht notwendige und notwendige Relativsätze
- 4.1. nicht notwendig
- 4.2. notwendig
- 5. Restriktive Relativsätze und nicht-restriktive Relativsätze
- 5.1. restriktiv
- 5.2. nicht-restriktiv
- 6. Die Relativsätze im Einzelnen
- 6.1. uncharakterisiert
- 6.2. modal
- 6.3 lokal
- 6.4. kausal, instrumental und temporal
- 7. Relativsätze und die Probleme bei ihrer Bildung
- 7.1. Stellung des Relativsatzes im Satzgefüge
- 7.2. Der Anschluss mit das oder was
- 7.3. Anschluss von Relativsätzen mit einleitenden Relativadverbien
- 7.4. Kongruenz beim relativischen Anschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Relativsatz im Deutschen. Ziel ist es, verschiedene Typen von Relativsätzen zu beschreiben und die Probleme bei ihrer Bildung zu beleuchten.
- Klassifizierung von Relativsätzen (restriktiv, nicht-restriktiv, notwendig, nicht notwendig)
- Unterscheidung und Anwendung von Relativpronomen und Relativadverbien
- Analyse der syntaktischen Funktion und Stellung von Relativsätzen
- Beschreibung der Kongruenzprobleme im relativen Anschluss
- Probleme bei der Bildung von Relativsätzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführendes: Die Einleitung führt in das Thema Relativsätze ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Bedeutung des Relativsatzes als wichtiger Nebensatztyp im Deutschen hervorgehoben und die Struktur der folgenden Kapitel kurz angerissen. Der Fokus liegt auf der Ankündigung einer detaillierten Untersuchung der Relativadverbien und Relativpronomen, der freien Relativsätze, sowie der Unterscheidung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Relativsätzen. Die Arbeit kündigt abschließend eine Analyse der Probleme bei der Bildung von Relativsätzen an.
2. Allgemeines zum Relativsatz: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Definition des Relativsatzes nach Duden, charakterisiert durch die Einleitung mittels Relativpronomen oder Relativadverb. Es betont die gemeinsame Stelle zwischen Haupt- und Nebensatz, die die Verbindung herstellt. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Typen und Aspekten der Relativsätze.
3. Freie Relativsätze: [Dieses Kapitel benötigt mehr Kontext aus dem Originaltext für eine adäquate Zusammenfassung.]
4. Nicht notwendige und notwendige Relativsätze: Dieses Kapitel differenziert zwischen nicht notwendigen und notwendigen Relativsätzen, basierend auf dem Duden. Es wird die Unterscheidung zwischen beiden Satztypen erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für das Verständnis der Satzstruktur und der semantischen Beziehungen wird hervorgehoben. Die Kapitelteile 4.1 und 4.2 behandeln jeweils die einzelnen Kategorien detailliert.
5. Restriktive Relativsätze und nicht-restriktive Relativsätze: Dieses Kapitel behandelt die Unterscheidung zwischen restriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzen. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Interpretation des Satzinhalts und die syntaktische Struktur wird erläutert. Die Kapitelteile 5.1 und 5.2 befassen sich detailliert mit den Eigenschaften und Funktionen der jeweiligen Satztypen.
6. Die Relativsätze im Einzelnen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Kategorien von Relativsätzen nach ihren semantischen Eigenschaften, wie uncharakterisiert, modal, lokal, kausal, instrumental und temporal. Es analysiert die spezifischen Merkmale und die Funktionen dieser Relativsatztypen im Satzgefüge. Die Unterkapitel 6.1-6.4 gehen detailliert auf die einzelnen Kategorien ein.
7. Relativsätze und die Probleme bei ihrer Bildung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen bei der Bildung von Relativsätzen. Es analysiert die Stellung des Relativsatzes im Satzgefüge, die Probleme beim Anschluss mit "das" oder "was", den Anschluss von Relativsätzen mit einleitenden Relativadverbien, sowie die Kongruenz beim relativischen Anschluss. Die Unterkapitel 7.1-7.4 widmen sich jeweils einem dieser Problemfelder im Detail.
Schlüsselwörter
Relativsatz, Relativpronomen, Relativadverb, Restriktiv, Nicht-restriktiv, Notwendig, Nicht notwendig, Satzgefüge, Kongruenz, Deutsche Grammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: "Relativsätze im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Relativsätze im Deutschen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Arten von Relativsätzen, darunter freie Relativsätze, notwendige und nicht notwendige Relativsätze, restriktive und nicht-restriktive Relativsätze. Es werden Relativpronomen und Relativadverbien erklärt und die syntaktische Funktion und Stellung von Relativsätzen im Satzgefüge analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf den Problemen bei der Bildung von Relativsätzen, wie z.B. Kongruenzprobleme im relativen Anschluss und die korrekte Verwendung von "das" oder "was".
Welche Arten von Relativsätzen werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen freien, notwendigen und nicht notwendigen, sowie restriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzen. Zusätzlich werden Relativsätze nach ihren semantischen Eigenschaften kategorisiert (uncharakterisiert, modal, lokal, kausal, instrumental und temporal).
Was sind die Zielsetzungen des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, verschiedene Typen von Relativsätzen zu beschreiben und die Probleme bei ihrer Bildung zu beleuchten. Es soll ein besseres Verständnis der deutschen Grammatik und der korrekten Verwendung von Relativsätzen vermitteln.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument besteht aus sieben Kapiteln: 1. Einführendes; 2. Allgemeines zum Relativsatz; 3. Freie Relativsätze; 4. Nicht notwendige und notwendige Relativsätze; 5. Restriktive Relativsätze und nicht-restriktive Relativsätze; 6. Die Relativsätze im Einzelnen; und 7. Relativsätze und die Probleme bei ihrer Bildung.
Welche Probleme bei der Bildung von Relativsätzen werden behandelt?
Das Dokument behandelt Probleme wie die Stellung des Relativsatzes im Satzgefüge, den Anschluss mit "das" oder "was", den Anschluss von Relativsätzen mit einleitenden Relativadverbien und Kongruenzprobleme beim relativischen Anschluss.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Relativsatz, Relativpronomen, Relativadverb, Restriktiv, Nicht-restriktiv, Notwendig, Nicht notwendig, Satzgefüge, Kongruenz, Deutsche Grammatik.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für alle gedacht, die ihr Wissen über Relativsätze im Deutschen vertiefen möchten, insbesondere für Studierende der Linguistik und Germanistik.
- Quote paper
- Kathrin Haberkorn (Author), 2007, Der Relativsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/128471