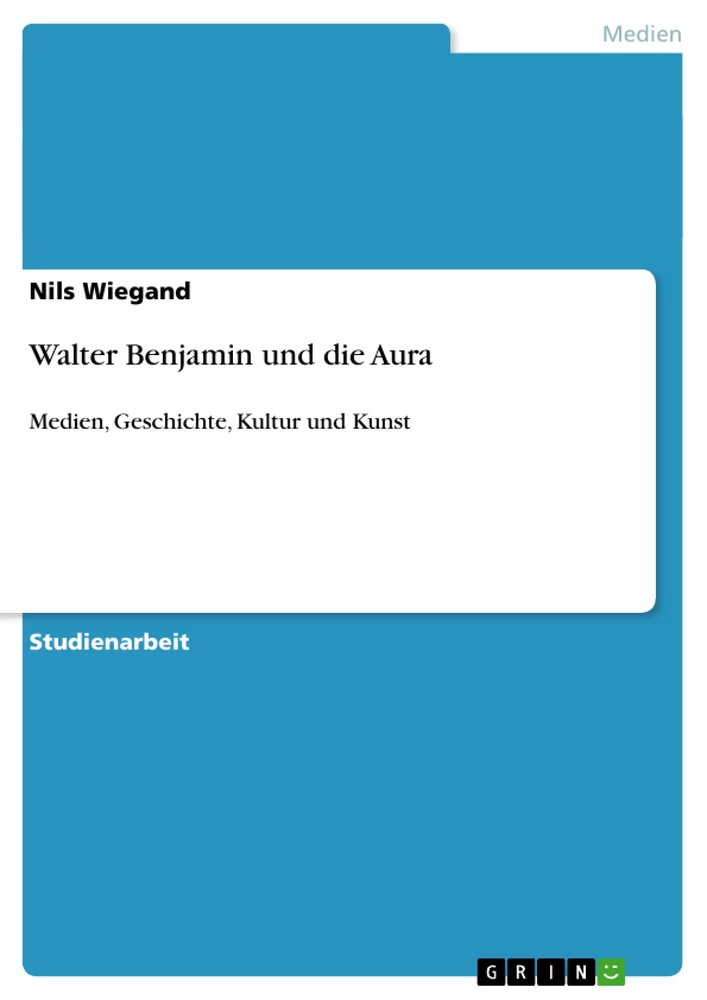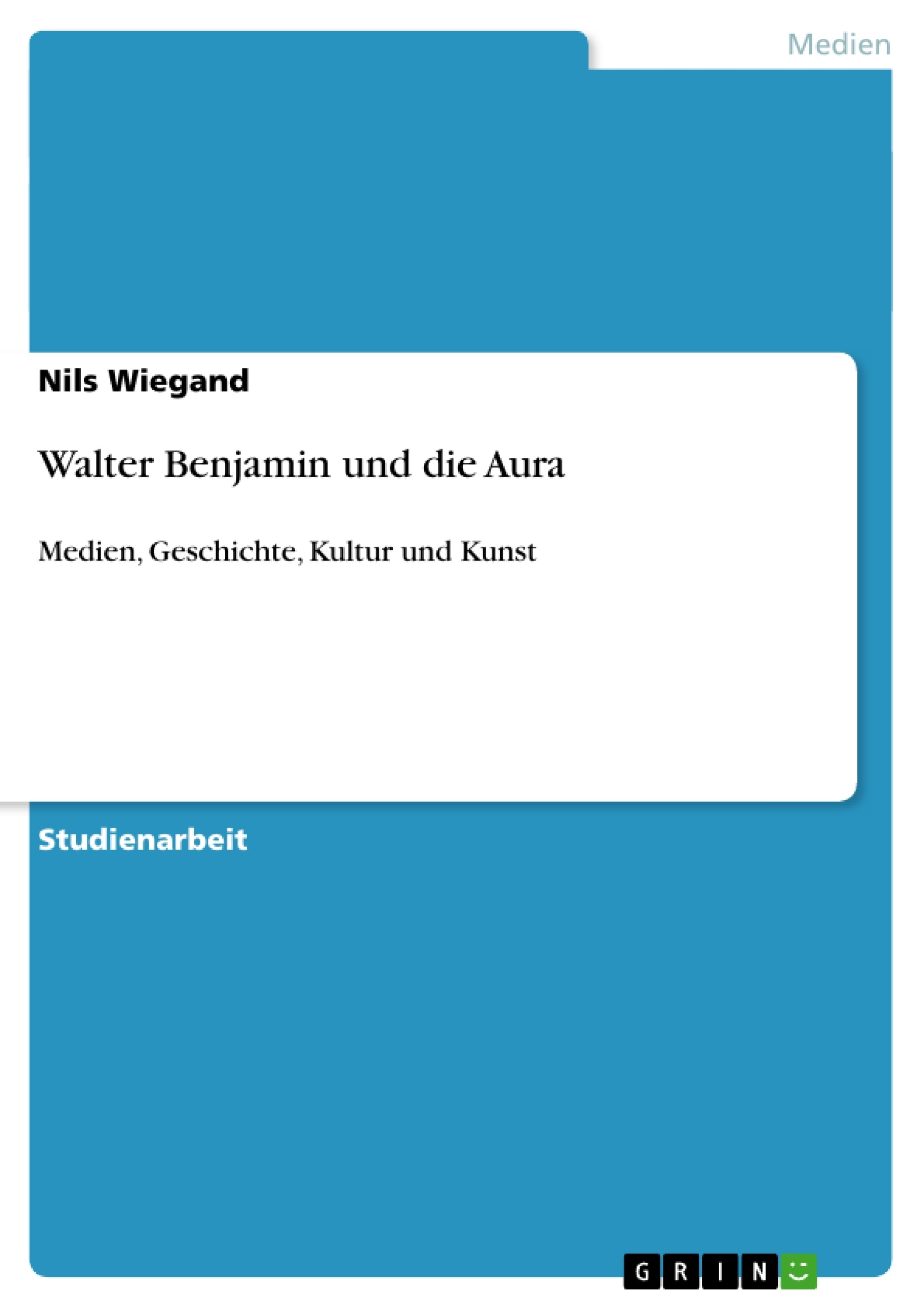Der Begriff der Aura nimmt in Walter Benjamins Werk eine besondere Stellung ein, die gemäß kunsthistorischer Fragestellungen sowie ihrer kultur- und medientheoretischen Implikaturen zu problematisieren ist. Daher soll anhand einer kurzen Rekapitulation der Diskussion um den Begriff der Aura das kulturtheoretische Problemfeld angesprochen werden. Benjamins Betrachtung der Geschichte der Fotografie wird als Folie der Erörterung seines Kulturkonzept sowie seiner historisch-materialistischen Betrachtungsweise herangezogen. Dabei ist der Begriff der Aura trotz der konsistenten Formulierung der "fernen Nähe" immer wieder unterschiedlichen Bestimmungen unterworfen, die anhand einer Analyse von Sol LeWitts "Serial Project No.1 (ABCD)" (1966) angezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Benjamin als Kulturtheoretiker und historischer Materialist
- Der Medienwechsel des 19. Jahrhunderts
- Kult und Kultur, Zivilisation und Fortschritt
- Historischer Materialismus
- Massen
- Verlust der Aura als historische Chance
- Nahe Ferne – ferne Nähe: Kleine Geschichte der Photographie
- Originalität und Emanzipation: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
- Zertrümmerung der Aura im Chockerlebnis: Über einige Motive bei Baudelaire
- Kunstreproduzierende Fotografie und auf Reproduzierbarkeit angelegte Kunstwerke
- Sol LeWitt, Serial Project No. 1 (ABCD), 1966.
- Einige Anmerkungen zum Minimalismus
- Auf Reproduzierbarkeit angelegte Artefakte
- Kunstreproduzierende Fotografie
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Walter Benjamins kunsthistorische Fragestellungen und deren kultur- und medientheoretische Implikationen. Im Fokus steht die Diskussion um den Aura-Begriff im Kontext der Fotografiegeschichte und Benjamins historisch-materialistischer Betrachtungsweise. Die Analyse beleuchtet die Entwicklung kultureller Wahrnehmungsweisen und den Einfluss der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst und Gesellschaft.
- Benjamins Aura-Konzept und seine Entwicklung
- Der Einfluss der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst
- Die Geschichte der Fotografie und ihre medientheoretischen Implikationen
- Benjamins historisch-materialistische Methode
- Analyse eines Fallbeispiels (Sol LeWitts Serial Project No. 1)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage, die sich mit der Analyse von Walter Benjamins kunsthistorischen Fragestellungen und deren kultur- und medientheoretischen Implikationen befasst. Sie führt den Aura-Begriff ein und kündigt die Heranziehung von Benjamins Schriften zur Fotografie und Baudelaire an, um dessen Kulturkonzept und historisch-materialistische Perspektive zu erörtern. Die Analyse von Sol LeWitts Serial Project No. 1 (ABCD), 1966, wird als Fallbeispiel angekündigt, um die verschiedenen Ebenen von Benjamins Aura-Konzept zu veranschaulichen.
Benjamin als Kulturtheoretiker und historischer Materialist: Dieses Kapitel untersucht Benjamins Werk als Beitrag zur Kulturtheorie und zum historischen Materialismus. Es analysiert den Medienwechsel des 19. Jahrhunderts im Kontext der technischen Reproduzierbarkeit von Kunstwerken, die Auswirkungen auf die Wahrnehmung und den Kulturbegriff. Benjamins Auseinandersetzung mit dem Mythos der langen Belichtungszeiten in der frühen Fotografie und die damit verbundene Diskussion um die mimetischen Funktionen von Malerei und Fotografie werden kritisch beleuchtet. Der Fokus liegt auf Benjamins materialistischer Perspektive, die den "Kampf um Marktanteile" innerhalb der Kulturgüter im Zentrum der Debatte um die Fotografie als Kunst sieht.
Verlust der Aura als historische Chance: Dieses Kapitel befasst sich mit Benjamins Konzept des Aura-Verlustes als historischer Chance. Es analysiert seine "Kleine Geschichte der Photographie" und den Aufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", um die Veränderungen der Wahrnehmung im Kontext der technischen Reproduktion zu untersuchen. Der Aufsatz "Über einige Motive bei Baudelaire" wird herangezogen, um die Zertrümmerung der Aura im "Schockerlebnis" zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Reproduzierbarkeit für die Emanzipation und die Veränderung des Verhältnisses von Original und Kopie.
Kunstreproduzierende Fotografie und auf Reproduzierbarkeit angelegte Kunstwerke: Dieses Kapitel analysiert Sol LeWitts Serial Project No. 1 (ABCD), 1966 als Fallbeispiel, um die medientheoretischen, kunsthistorischen und kulturtheoretischen Aspekte im Zusammenhang mit der Reproduzierbarkeit von Kunst zu untersuchen. Der Minimalismus wird im Kontext der auf Reproduzierbarkeit angelegten Artefakte diskutiert. Die Analyse beleuchtet die Rolle der Fotografie als kunstreproduzierendes Medium und die Implikationen dieser Tatsache für das Verständnis von Kunst im Zeitalter der technischen Reproduktion.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Aura, Fotografie, technische Reproduzierbarkeit, Kunstwerk, historischer Materialismus, Kulturtheorie, Medienwechsel, Moderne, Wahrnehmung, Sol LeWitt, Minimalismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Walter Benjamins kunsthistorischen Fragestellungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Walter Benjamins kunsthistorische Fragestellungen und deren kultur- und medientheoretische Implikationen. Der Fokus liegt auf dem Aura-Begriff im Kontext der Fotografiegeschichte und Benjamins historisch-materialistischer Betrachtungsweise. Analysiert wird die Entwicklung kultureller Wahrnehmungsweisen und der Einfluss der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst und Gesellschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Benjamins Aura-Konzept und dessen Entwicklung, den Einfluss der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst, die Geschichte der Fotografie und ihre medientheoretischen Implikationen, Benjamins historisch-materialistische Methode und eine Analyse von Sol LeWitts Serial Project No. 1 als Fallbeispiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Benjamin als Kulturtheoretiker und historischen Materialisten, ein Kapitel zum Verlust der Aura als historische Chance, ein Kapitel zu kunstreproduzierender Fotografie und auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerken, eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte von Benjamins Theorie im Kontext der technischen Reproduzierbarkeit und der Fotografie.
Wie wird Benjamins Aura-Konzept behandelt?
Benjamins Aura-Konzept wird im Kontext der Fotografiegeschichte und seiner historisch-materialistischen Perspektive analysiert. Die Arbeit untersucht, wie sich die Aura durch die technische Reproduzierbarkeit verändert und welche Auswirkungen dies auf die Wahrnehmung von Kunst und Gesellschaft hat. Der Verlust der Aura wird dabei nicht nur als negativ, sondern auch als historische Chance betrachtet.
Welche Rolle spielt die Fotografie in der Arbeit?
Die Fotografie spielt eine zentrale Rolle als Beispiel für die technische Reproduzierbarkeit von Kunstwerken. Die Arbeit untersucht Benjamins "Kleine Geschichte der Photographie" und analysiert den Einfluss der Fotografie auf die Wahrnehmung und den Kulturbegriff. Die medientheoretischen Implikationen der Fotografie werden im Zusammenhang mit Benjamins Theorie detailliert untersucht.
Welche Bedeutung hat der historische Materialismus in dieser Arbeit?
Benjamins historisch-materialistische Methode bildet die Grundlage der Analyse. Die Arbeit betrachtet die kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die die Entwicklung der Kunst und die Wahrnehmung von Kunst beeinflussen. Der "Kampf um Marktanteile" innerhalb der Kulturgüter wird als wichtiger Aspekt der Debatte um die Fotografie als Kunst gesehen.
Welche Rolle spielt Sol LeWitts Serial Project No. 1?
Sol LeWitts Serial Project No. 1 (ABCD), 1966 dient als Fallbeispiel, um die verschiedenen Ebenen von Benjamins Aura-Konzept und die Implikationen der Reproduzierbarkeit für das Verständnis von Kunst im Zeitalter der technischen Reproduktion zu veranschaulichen. Es wird im Kontext des Minimalismus und der auf Reproduzierbarkeit angelegten Artefakte diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Walter Benjamin, Aura, Fotografie, technische Reproduzierbarkeit, Kunstwerk, historischer Materialismus, Kulturtheorie, Medienwechsel, Moderne, Wahrnehmung, Sol LeWitt, Minimalismus.
- Arbeit zitieren
- Nils Wiegand (Autor:in), 2009, Walter Benjamin und die Aura, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127537