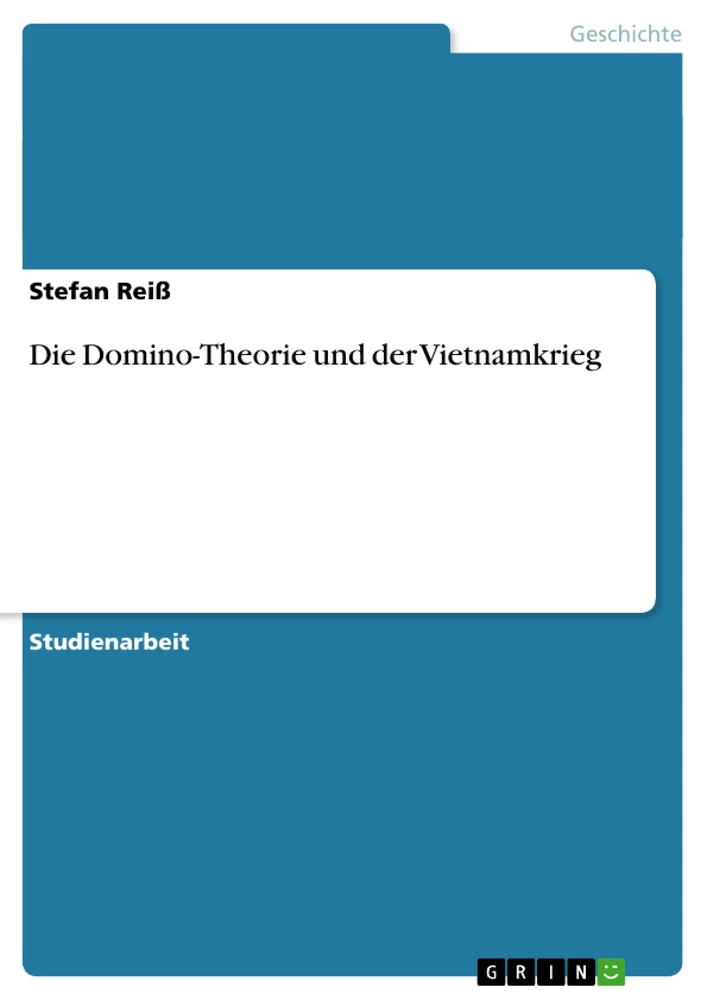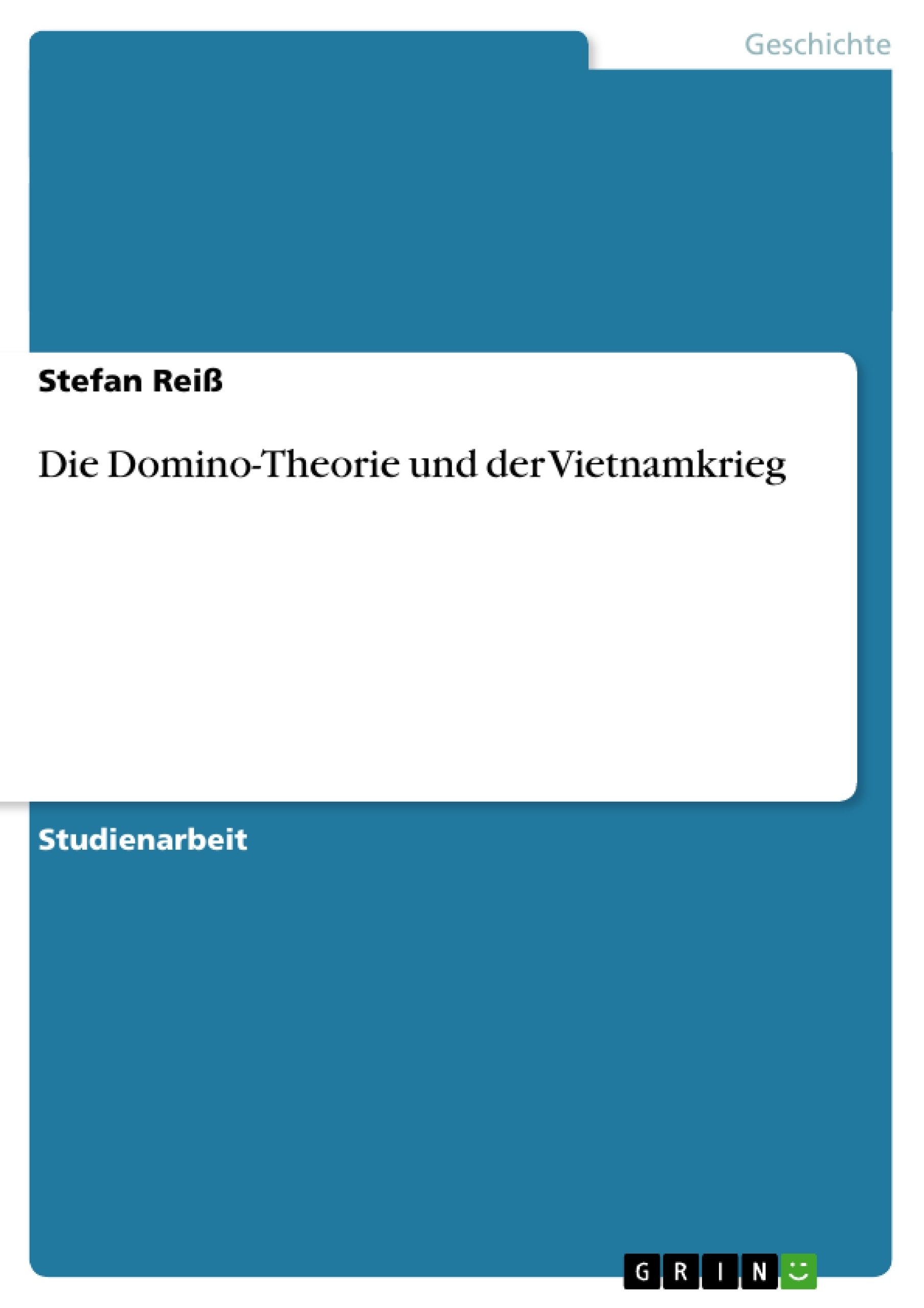Kein Krieg im 20. Jahrhundert dauerte so lange an wie derjenige in Vietnam, der zunächst als ein Befreiungskampf der Vietnamesen von der französischen Kolonialherrschaft begann, das Land teilte und schließlich als Auseinandersetzung zwischen dem kommunistischen Norden und dem kapitalistischen Süden bis zum militärischen Engagement der USA gipfelte. Der Glaube an die Notwendigkeit eines Eingreifens der USA gegen eine befürchtete fortschreitende Ausdehnung des Kommunismus – und damit auch die unterstellte Expansion des Einflussbereichs der Sowjetunion – generierte sich in den Reihen der verantwortlichen Strategen schon in den frühen Phasen des kalten Krieges. Eine Argumentationsbasis der Befürworter war die sogenannte „Domino-Theorie“. Sobald in einem Land der Kommunismus zur Staatsform werde, wären auch dessen umliegende Länder durch die populistische Strahlkraft dieser Ideologie gefährdet, ihre auf eine kapitalistische Wirtschaftsform basierende freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verlieren. Sie drohten zu Gunsten des Kommunismus umzufallen, sich somit des geostrategischen Einflusses der USA zu entziehen und innerhalb des Ostblockes in Gegnerschaft zur westlichen Welt zu geraten. Dieses Szenario gelte es auch im Falle Indochinas aktiv abzuwenden.
Dabei zeigen aber die tatsächlichen Gegebenheiten in Vietnam und die desaströsen Erfahrungen der USA in diesem Konflikt nicht nur in der Rückschau sehr deutlich, wie eindimensional die Domino-Theorie gedacht wurde. Die vermessene Vereinfachung der wahren Komplexität des Indochina-Konfliktes war nicht nur ein entscheidender Grund für die Niederlage der USA, sondern entzog auch der Legitimation eines gewaltsamen Eingreifens jede Grundlage. Dies anhand der Darstellung der Verhältnisse in Vietnam und des internationalen Kontextes dieses Krieges, sowie einer darin einfließenden Kritik an der Dominotheorie zu zeigen, ist Gegenstand dieser Arbeit. Des Weiteren wird auf die sogenannte Phase der Vietnamisierung dieses Konfliktes eingegangen, in der die USA in den 1970ern lange vergeblich versuchten, aus diesem das ganze Land traumatisierenden Krieg ohne Gesichtsverlust wieder herauszukommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Argumentationsgrundlagen für die Domino-Theorie
- Die Intervention in Vietnam
- Die Fehleinschätzungen der USA
- Vietnam
- Der internationale Kontext
- Der Rückzug aus dem Krieg
- Die Vietnamisierung
- Das Pariser Abkommen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Domino-Theorie und ihre Rolle in der amerikanischen Vietnampolitik. Sie untersucht die Argumentationsgrundlagen der Theorie, die Fehleinschätzungen der USA in Bezug auf Vietnam und den internationalen Kontext des Krieges, sowie die Versuche der USA, sich aus dem Krieg zurückzuziehen. Die Arbeit beleuchtet die Komplexität des Indochina-Konflikts und kritisiert die eindimensionale Sichtweise der Domino-Theorie.
- Die Domino-Theorie als Argumentationsgrundlage für die amerikanische Intervention in Vietnam
- Die Fehleinschätzungen der USA in Bezug auf die politische und soziale Realität in Vietnam
- Die Rolle des internationalen Kontextes im Indochina-Konflikt
- Die Vietnamisierung des Krieges und der Rückzug der USA
- Die Kritik an der Domino-Theorie und ihre Auswirkungen auf die amerikanische Vietnampolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Vietnamkrieg als einen langwierigen Konflikt dar, der von der französischen Kolonialherrschaft über Vietnam bis zum militärischen Engagement der USA reichte. Die Domino-Theorie, die die Ausbreitung des Kommunismus befürchtete, spielte eine zentrale Rolle in der amerikanischen Entscheidung, in den Krieg einzugreifen. Die Arbeit argumentiert, dass die Domino-Theorie die Komplexität des Konflikts vereinfachte und zu Fehleinschätzungen der USA führte.
Das zweite Kapitel untersucht die Argumentationsgrundlagen der Domino-Theorie. Es wird argumentiert, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg von einem offensiven Expansionscharakter des Ostblocks überzeugt waren und die Bedrohung durch den Kommunismus überschätzten. Die USA sahen sich in der Pflicht, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern und unterstützten daher Frankreich im Indochinakrieg.
Das dritte Kapitel beschreibt die amerikanische Intervention in Vietnam. Die USA engagierten sich zunächst mit Finanzhilfen für Frankreich, später mit direkter militärischer Unterstützung für Südvietnam. Die Versuche der USA, den Konflikt zu beeinflussen, führten schließlich zu einem massiven militärischen Eingreifen ab 1965.
Das vierte Kapitel analysiert die Fehleinschätzungen der USA in Bezug auf Vietnam. Die USA gingen davon aus, dass die südvietnamesische Bevölkerung eine westliche Lebensweise bevorzugte und den Kommunismus ablehnte. Diese Annahme erwies sich als falsch, da die vietnamesische Bevölkerung vor allem von der kolonialen Fremdherrschaft befreit werden wollte. Die USA unterschätzten die Motivation der Vietcong und die Popularität von Ho Chi Minh.
Das fünfte Kapitel behandelt den Rückzug der USA aus dem Krieg. Die USA versuchten in den 1970er Jahren, den Krieg durch die Vietnamisierung zu beenden, indem sie die Verantwortung für den Krieg an Südvietnam übergaben. Dieser Versuch scheiterte jedoch, und die USA zogen sich schließlich 1973 aus dem Krieg zurück.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Domino-Theorie, den Vietnamkrieg, die amerikanische Vietnampolitik, die Fehleinschätzungen der USA, die politische und soziale Realität in Vietnam, der internationale Kontext des Krieges, die Vietnamisierung, der Rückzug der USA und die Kritik an der Domino-Theorie.
- Quote paper
- Stefan Reiß (Author), 2009, Die Domino-Theorie und der Vietnamkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127507