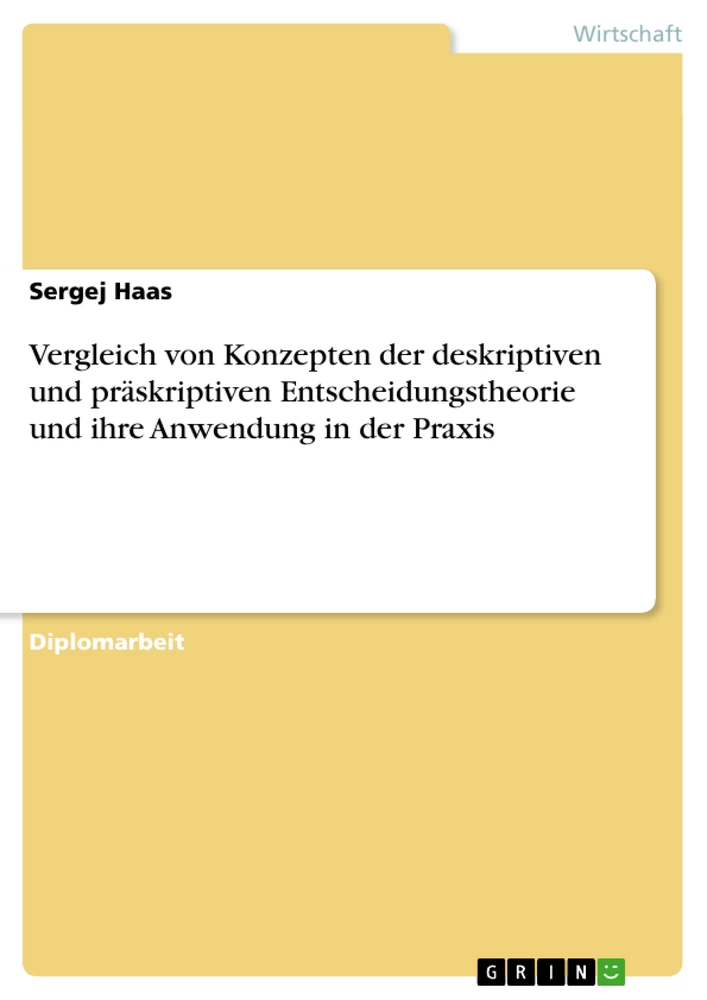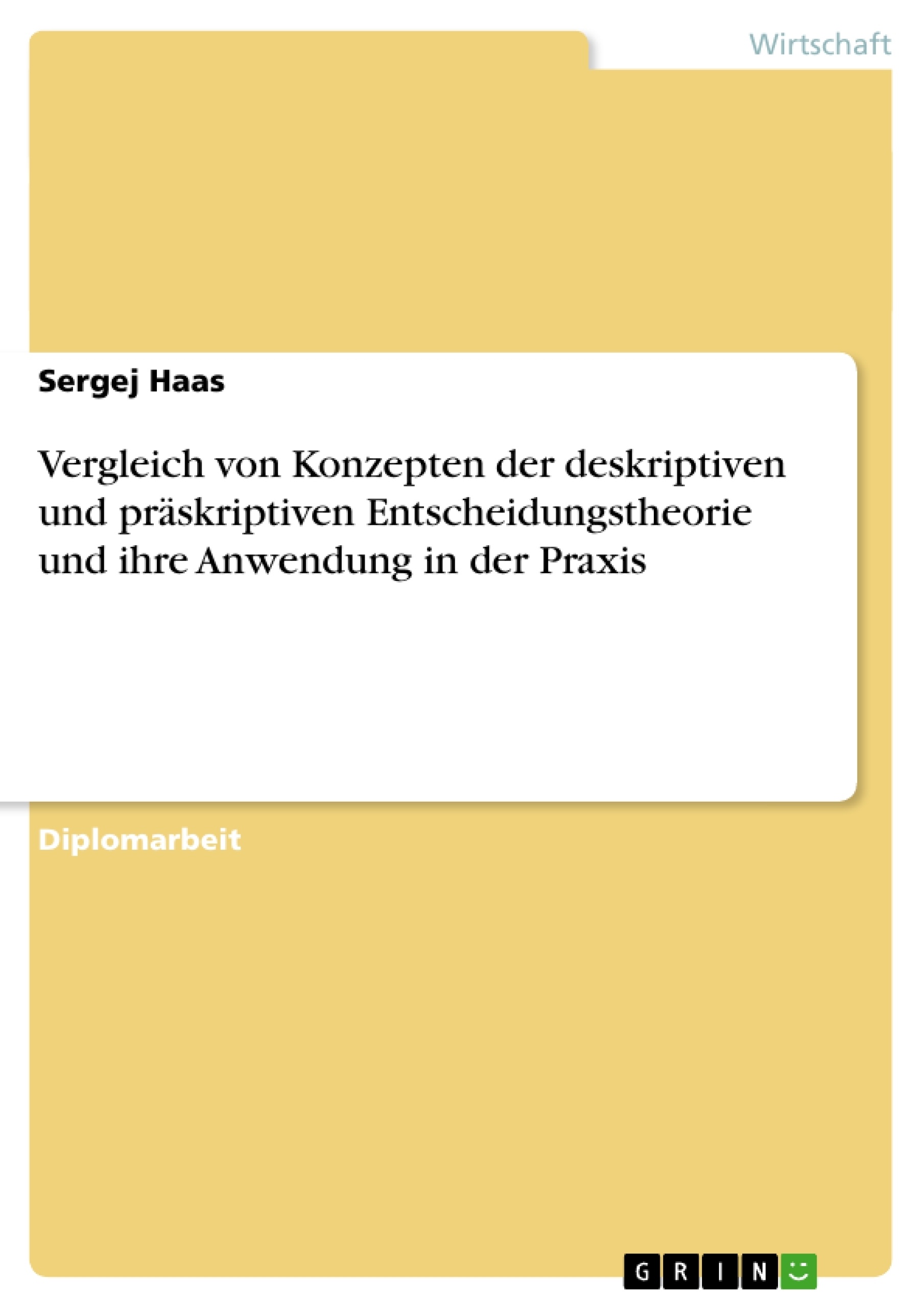In vielen Entscheidungssituationen ist der Mensch mit seinem sogenannten gesunden Menschenverstand oft überfordert. Dies kann an der Unsicherheit der Zukunft oder an der Komplexität der Entscheidungssituation liegen. Vor diesem Hintergrund sind viele Entscheidungsregeln entwickelt worden, um die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Betrachten wir die psychologische Perspektive, so kalkulieren Menschen im Allgemeinen bei der Frage, welche Entscheidung sie treffen sollen, nicht so, wie es die Entscheidungsregeln vorschreiben. Sie beurteilen Situationen und wählen Optionen im Rahmen ihrer beschränkten kognitiven Kapazität sowie auf der Basis ihrer Erfahrungen und Ziele.
Betrachtet man diese zwei Grundrichtungen der Entscheidungsfindung, so kann zwischen einer präskriptiven und einer deskriptiven Entscheidungstheorie unterschieden werden. Präskriptiv ist eine Entscheidungstheorie, die es besagt, wie man sich verhalten bzw. welche Alternativen man wählen sollte, wenn man bestimmte Grundvoraussetzungen (Axiome) rationalen Denkens für richtig hält. Sie liefert formalisierte Regeln und Verfahren zur Strukturierung und Verarbeitung von Information und sieht ihre Aufgabe darin, Menschen bei schwierigen Entscheidungen zu unterstützen. Demgegenüber sieht die deskriptive Entscheidungsforschung ihre Aufgabe darin, das tatsächliche menschliche Entscheidungsverhalten zu beschreiben. Sie nutzt Daten aus der empirischen Beobachtung und leitet daraus Rückschlüsse auf das zukünftige Verhalten. Diese Daten sollen es ermöglichen, das reale Entscheidungsverhalten der Menschen zu verstehen, um auf dieser Grundlage dann Vorhersagen treffen und damit Entscheidungen verbessern zu können.
Beide Ansätze sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Einerseits bezieht sich die präskriptive Theorie durchaus auf reales, d.h. beobachtetes Verhalten. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, zunächst das menschliche Verhalten im Bereich der Entscheidungen zu verstehen, bevor man die Entscheidungsfindung zu verbessern versucht. Andererseits kann deskriptive Forschung aus den präskriptiven Modellen „rationalen“ Verhaltens neue Anregungen für empirische Fragestellungen gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist die Berücksichtigung beider Richtungen in der Betriebswirtschaft notwendig.
Ziel der Arbeit ist demnach, das Wechselspiel von Präskription („Wie sollten Entscheidungsprozesse verlaufen?“) und Deskription („Wie verlaufen Entscheidungsprozesse in der Realität?“) deutlich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Entscheidungsforschung
- Der Begriff der Entscheidung und die Klassifikation von Entscheidungssituationen
- Art und Umfang des kognitiven Aufwandes
- Visualisierung von Entscheidungssituationen
- Rationalität
- Entscheiden unter Sicherheit
- Entscheidungsregeln der präskriptiven Entscheidungsforschung
- Entscheidungsregeln der deskriptiven Entscheidungsforschung
- Ein Resümee
- Entscheiden unter Unsicherheit
- Entscheidungstypen
- Entscheidungsregeln der präskriptiven Entscheidungsforschung
- Entscheidungen bei Ungewissheit
- Entscheidungen bei Risiko
- Erwartungswertprinzip
- Erwartungsnutzentheorie
- Das µ – σ Kriterium
- Die SEU-Theorie
- Ansätze der deskriptiven Entscheidungsforschung
- Die Prospect-Theorie
- Theorien mit emotionalen Komponenten
- Decision-Field-Theorie
- Non-konsequentialistische Theorien
- Kognitive Heuristiken
- Ein Resümee
- Gruppenentscheidungen
- Gruppenentscheidungen aus Sicht der präskriptiven Entscheidungsforschung
- Gruppenentscheidungen aus Sicht der deskriptiven Entscheidungsforschung
- Ein Resümee
- Anwendung in der Praxis
- Portfolio-Theorie von Markowitz
- Verhalten der Teilnehmer an den Finanzmärkten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit vergleicht Konzepte der deskriptiven und präskriptiven Entscheidungstheorie und untersucht deren Anwendung in der Praxis. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Ansätze aufzuzeigen und ein besseres Verständnis für die Komplexität realer Entscheidungssituationen zu entwickeln.
- Vergleich präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorien
- Analyse von Entscheidungsregeln unter Sicherheit und Unsicherheit
- Einbezug kognitiver Aspekte und emotionaler Einflüsse auf Entscheidungen
- Anwendung der Theorien im Kontext von Finanzmärkten (Portfolio-Theorie)
- Untersuchung von Gruppenentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Entscheidungsfindung ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert den Vergleich zwischen präskriptiven und deskriptiven Ansätzen und hebt die Relevanz des Themas für die Wirtschaftswissenschaften hervor. Der Fokus liegt auf der Lücke zwischen theoretischen Modellen und realem Entscheidungsverhalten.
Grundlagen der Entscheidungsforschung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Entscheidungsforschung dar. Es definiert den Begriff der Entscheidung, klassifiziert Entscheidungssituationen und beleuchtet den kognitiven Aufwand, der mit verschiedenen Entscheidungsprozessen verbunden ist. Die Visualisierung von Entscheidungssituationen wird ebenso behandelt wie das Konzept der Rationalität, das als Grundlage für viele präskriptive Modelle dient. Die Kapitelteile bilden die Basis für die folgenden Kapitel, in denen die verschiedenen Entscheidungsregeln und -modelle im Detail erklärt werden.
Entscheiden unter Sicherheit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Entscheidungssituationen, in denen die Konsequenzen aller Handlungsalternativen bekannt sind. Es werden verschiedene Entscheidungsregeln der präskriptiven und deskriptiven Entscheidungsforschung vorgestellt und verglichen. Die Analyse zeigt die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze auf und illustriert, wie diese in der Praxis angewendet werden können. Der Vergleich verdeutlicht, dass präskriptive Modelle zwar optimale Entscheidungen vorschlagen, aber oft von realem Verhalten abweichen.
Entscheiden unter Unsicherheit: Dieses Kapitel erweitert die Betrachtung auf Entscheidungssituationen, in denen die Konsequenzen der Handlungsalternativen unsicher sind. Es werden verschiedene Entscheidungsregeln vorgestellt, darunter das Erwartungswertprinzip, die Erwartungsnutzentheorie, das µ-σ-Kriterium und die SEU-Theorie (Subjective Expected Utility). Des Weiteren werden deskriptive Ansätze wie die Prospect-Theorie, Theorien mit emotionalen Komponenten, die Decision-Field-Theorie und nicht-konsequentialistische Theorien diskutiert. Die Zusammenfassung der verschiedenen Modelle veranschaulicht die Herausforderungen der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit und den Unterschied zwischen normativen und deskriptiven Ansätzen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der unterschiedlichen Herangehensweisen an die Bewertung von Risiko und Ungewissheit.
Gruppenentscheidungen: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse von Gruppenentscheidungen, wobei sowohl präskriptive als auch deskriptive Ansätze betrachtet werden. Es untersucht die verschiedenen Methoden der Gruppenentscheidung, die Herausforderungen bei der Konsensfindung und die Rolle von individuellen Präferenzen. Der Vergleich der Ansätze zeigt, wie präskriptive Modelle versuchen, optimale Gruppenentscheidungen zu strukturieren, während deskriptive Modelle das tatsächliche Verhalten von Gruppen in Entscheidungsprozessen beschreiben und erklären. Die Bedeutung von Kommunikationsstrukturen und Einflüssen der Gruppendynamik wird herausgestellt.
Anwendung in der Praxis: Dieses Kapitel zeigt die Anwendung der vorgestellten Theorien in der Praxis, konkret am Beispiel der Portfolio-Theorie von Markowitz und dem Verhalten von Teilnehmern an den Finanzmärkten. Es analysiert, wie die Modelle genutzt werden können, um rationale Investitionsentscheidungen zu treffen, und beleuchtet gleichzeitig die Abweichungen zwischen theoretischen Vorhersagen und realem Marktverhalten. Die Anwendung der Theorien auf reale Fälle veranschaulicht die Grenzen der Modelle und die Komplexität der Entscheidungsfindung in dynamischen Märkten. Der Vergleich zwischen Theorie und Praxis hebt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Entscheidungsfindung hervor.
Schlüsselwörter
Deskriptive Entscheidungstheorie, Präskriptive Entscheidungstheorie, Entscheidungsregeln, Sicherheit, Unsicherheit, Risiko, Erwartungsnutzentheorie, Prospect-Theorie, Kognitive Heuristiken, Gruppenentscheidungen, Portfolio-Theorie, Finanzmärkte, Rationalität.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Deskriptive und Präskriptive Entscheidungstheorie
Was ist der Hauptgegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit vergleicht Konzepte der deskriptiven und präskriptiven Entscheidungstheorie und untersucht deren Anwendung in der Praxis. Der Fokus liegt auf der Analyse der Stärken und Schwächen beider Ansätze und dem Verständnis der Komplexität realer Entscheidungssituationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Entscheidungsfindung unter Sicherheit und Unsicherheit, verschiedene Entscheidungsregeln (präskriptiv und deskriptiv), kognitive Aspekte und emotionale Einflüsse auf Entscheidungen, Gruppenentscheidungen und die Anwendung der Theorien im Kontext von Finanzmärkten (z.B. Portfolio-Theorie von Markowitz).
Welche Theorien werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem das Erwartungswertprinzip, die Erwartungsnutzentheorie, das µ-σ-Kriterium, die SEU-Theorie, die Prospect-Theorie, Theorien mit emotionalen Komponenten, die Decision-Field-Theorie und nicht-konsequentialistische Theorien. Es werden sowohl präskriptive als auch deskriptive Ansätze zu Entscheidungsfindung unter Sicherheit und Unsicherheit beleuchtet.
Wie werden präskriptive und deskriptive Entscheidungstheorien verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze anhand ihrer Stärken und Schwächen, indem sie zeigt, wie präskriptive Modelle optimale Entscheidungen vorschlagen, aber oft vom realen Verhalten abweichen. Der Fokus liegt auf der Lücke zwischen theoretischen Modellen und dem tatsächlichen Entscheidungsverhalten.
Welche Rolle spielen kognitive Aspekte und emotionale Einflüsse?
Die Arbeit berücksichtigt den Einfluss kognitiver Aspekte und emotionaler Einflüsse auf Entscheidungen. Deskriptive Ansätze wie die Prospect-Theory werden behandelt, um das reale Entscheidungsverhalten besser zu verstehen, das oft von rationalen Modellen abweicht.
Wie werden Gruppenentscheidungen behandelt?
Die Arbeit analysiert Gruppenentscheidungen aus sowohl präskriptiver als auch deskriptiver Perspektive. Es werden verschiedene Methoden der Gruppenentscheidung, Herausforderungen bei der Konsensfindung und die Rolle individueller Präferenzen untersucht.
Welche praktische Anwendung wird gezeigt?
Die Arbeit zeigt die praktische Anwendung der Theorien anhand der Portfolio-Theorie von Markowitz und dem Verhalten von Teilnehmern an den Finanzmärkten. Sie analysiert, wie Modelle zur Unterstützung rationaler Investitionsentscheidungen genutzt werden können und beleuchtet gleichzeitig die Abweichungen zwischen theoretischen Vorhersagen und realem Marktverhalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deskriptive Entscheidungstheorie, Präskriptive Entscheidungstheorie, Entscheidungsregeln, Sicherheit, Unsicherheit, Risiko, Erwartungsnutzentheorie, Prospect-Theorie, Kognitive Heuristiken, Gruppenentscheidungen, Portfolio-Theorie, Finanzmärkte, Rationalität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen der Entscheidungsforschung, Entscheiden unter Sicherheit und Unsicherheit, Gruppenentscheidungen, eine Anwendung in der Praxis und abschließende Schlüsselwörter. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
- Quote paper
- Sergej Haas (Author), 2009, Vergleich von Konzepten der deskriptiven und präskriptiven Entscheidungstheorie und ihre Anwendung in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127479