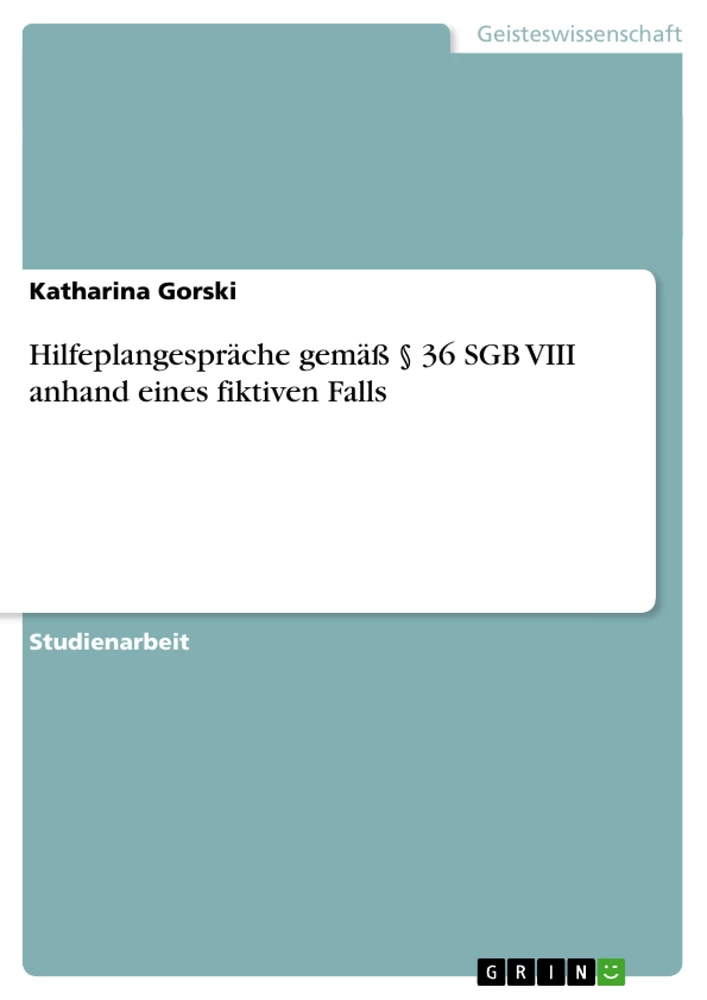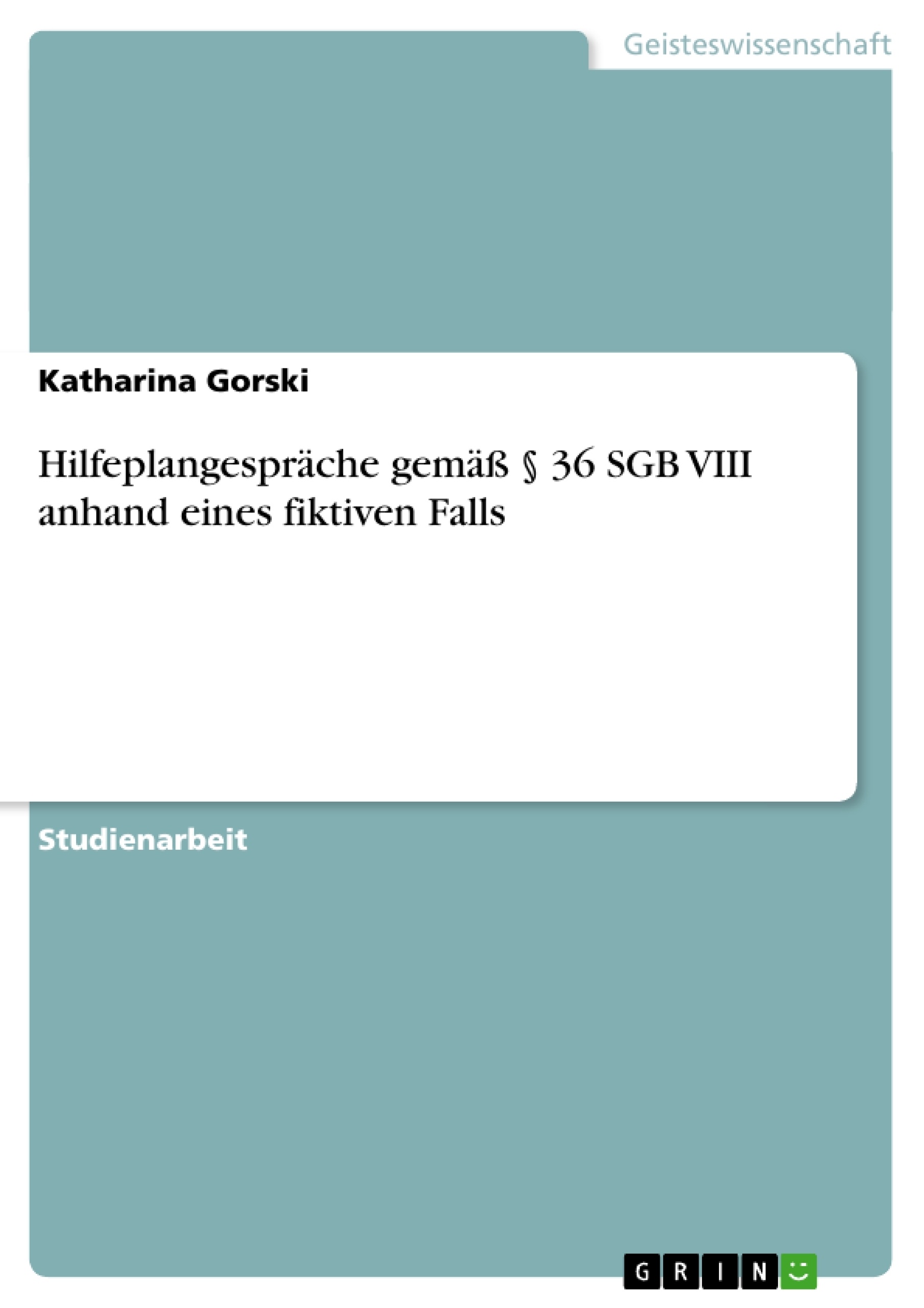Das Seminar „Verfahrensqualität durch Hilfeplanung“ bezog sich auf das Sozialgesetzbuch VIII, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, und hierbei speziell auf Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII. Es wurden grundlegende Merkmale der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII erläutert. Durch ein Planspiel über zwei fiktive Fallgeschichten sollten die Studierenden konkret erfahren, wie eine Hilfeplanung vonstatten geht. Dazu konnte sich das Plenum in Arbeitsgruppen aufteilen. Nach einer Einführung in das Thema „Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII“ wird ein Fall in der folgenden Ausarbeitung näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII
- Fallgeschichte - Der Fall Esther
- Esthers Mutter
- Ablauf der Plangespräche
- Erstes Gespräch - Abklärung mit der Familie
- Zweites Gespräch - Hilfeplangespräch
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII anhand eines Fallbeispiels. Ziel ist es, den Ablauf und die beteiligten Akteure eines Hilfeplangesprächs zu verdeutlichen und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften, den Sorgeberechtigten und dem Kind zu beleuchten.
- Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
- Der Ablauf von Hilfeplangesprächen
- Die Rolle der Sorgeberechtigten und des Kindes
- Zusammenarbeit der Fachkräfte
- Dokumentation des erzieherischen Bedarfs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII ein und beschreibt den Kontext des Seminars „Verfahrensqualität durch Hilfeplanung“. Sie kündigt die detaillierte Erläuterung eines Fallbeispiels an, um das Verständnis für den praktischen Ablauf der Hilfeplanung zu vertiefen. Der Bezug zum Sozialgesetzbuch VIII und die Bedeutung der Hilfen zur Erziehung werden kurz angerissen.
Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII: Dieses Kapitel erläutert die rechtlichen Grundlagen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII. Es definiert den Anspruch auf Hilfe zur Erziehung und betont die Notwendigkeit einer subjektiv empfundenen und sachlich nachvollziehbaren Angewiesenheit auf pädagogische Hilfe. Das Kapitel beschreibt den Prozess der Hilfeplanung, beginnend mit der Meldung des Hilfebedarfs bis hin zum Erstellung des Hilfeplans und dem abschließenden Bewilligungsbescheid. Es betont die Bedeutung der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte und die Mitwirkung der Sorgeberechtigten und des Kindes. Die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der gewählten Hilfeart wird als essentieller Bestandteil des kontinuierlichen Prozesses hervorgehoben. Die Notwendigkeit der Zustimmung der Sorgeberechtigten und die Rolle der Beteiligten als „Koproduzenten der Dienstleistung“ werden betont. Der Hilfeplan wird als „Planungsinstrument“ zur bestmöglichen Hilfe im Einzelfall positioniert, mit dem Ziel der planvollen Verständigung über den erzieherischen Bedarf und die Zielsetzung der Hilfe. Die Dokumentation der Vorstellungen und Erwartungen der Betroffenen und die fachliche Selbstkontrolle des Jugendamts werden als wichtige Aspekte genannt.
Fallgeschichte - Der Fall Esther: Dieses Kapitel präsentiert den Fall der fünfjährigen Esther und ihres Bruders Michael. Es beschreibt die Verhaltensauffälligkeiten Esthers, den problematischen familiären Hintergrund mit der alkohol- und tablettensüchtigen Mutter und die Gefährdung des Kindeswohls. Die Kapitel skizziert Esthers schwierige Lebensumstände von Geburt an, geprägt von Konflikten der Eltern, zeitweiliger Unterbringung in einer Pflegefamilie und einer ungünstigen häuslichen Umgebung. Die unzureichende elterliche Versorgung, insbesondere die emotionale Vernachlässigung, wird als zentrales Problem dargestellt.
Schlüsselwörter
Hilfeplanung, § 36 SGB VIII, Hilfe zur Erziehung, Kindeswohl, Jugendamt, Hilfeplangespräch, Sorgeberechtigte, Fachkräfte, Zusammenarbeit, Verhaltensauffälligkeiten, Fallbeispiel, Entscheidungsfindung, Dokumentation, Kontinuierliche Überprüfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII - Fallbeispiel Esther
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung analysiert die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII anhand eines konkreten Fallbeispiels (Esther). Sie beleuchtet den Ablauf der Hilfeplanung, die beteiligten Akteure und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Fachkräften, Sorgeberechtigten und dem Kind.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die rechtlichen Grundlagen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, der Ablauf von Hilfeplangesprächen, die Rolle der Sorgeberechtigten und des Kindes, die Zusammenarbeit der Fachkräfte, die Dokumentation des erzieherischen Bedarfs und die kontinuierliche Überprüfung der Maßnahmen.
Wie ist die Ausarbeitung strukturiert?
Die Ausarbeitung enthält eine Einleitung, eine detaillierte Beschreibung der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, eine Fallstudie über Esther, eine Zusammenfassung des Ablaufs der Plangespräche und eine abschließende Zusammenfassung. Schlüsselwörter und ein Inhaltsverzeichnis erleichtern die Navigation.
Was ist der Fall Esther?
Der Fall Esther beschreibt die Situation eines fünfjährigen Mädchens mit Verhaltensauffälligkeiten, das in einem familiären Umfeld mit einer alkohol- und tablettensüchtigen Mutter aufwächst. Die Ausarbeitung zeigt die Herausforderungen der Hilfeplanung in einem solchen Kontext auf, wobei die Gefährdung des Kindeswohls im Vordergrund steht.
Wie läuft ein Hilfeplangespräch ab?
Die Ausarbeitung beschreibt den Ablauf exemplarisch anhand von zwei Gesprächen: Ein erstes Gespräch zur Abklärung mit der Familie und ein zweites Gespräch, das dem eigentlichen Hilfeplangespräch dient. Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird hierbei hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Sorgeberechtigten und das Kind?
Sorgeberechtigte und das Kind sind aktive Mitwirkende im Hilfeplanungsprozess. Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Perspektiven sind entscheidend für die Gestaltung des Hilfeplans. Die Ausarbeitung betont die Bedeutung der Zustimmung der Sorgeberechtigten und die Rolle aller Beteiligten als „Koproduzenten der Dienstleistung“.
Welche rechtlichen Grundlagen sind relevant?
Die rechtlichen Grundlagen der Hilfeplanung werden im Detail anhand von § 36 SGB VIII erläutert. Der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung und die Notwendigkeit einer subjektiv empfundenen und sachlich nachvollziehbaren Angewiesenheit auf pädagogische Hilfe werden definiert.
Wie wird der erzieherische Bedarf dokumentiert?
Die Ausarbeitung betont die Wichtigkeit der Dokumentation des erzieherischen Bedarfs. Dies beinhaltet die Dokumentation der Vorstellungen und Erwartungen der Betroffenen sowie die fachliche Selbstkontrolle des Jugendamts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Hilfeplanung, § 36 SGB VIII, Hilfe zur Erziehung, Kindeswohl, Jugendamt, Hilfeplangespräch, Sorgeberechtigte, Fachkräfte, Zusammenarbeit, Verhaltensauffälligkeiten, Fallbeispiel, Entscheidungsfindung, Dokumentation, kontinuierliche Überprüfung.
- Quote paper
- Katharina Gorski (Author), 2005, Hilfeplangespräche gemäß § 36 SGB VIII anhand eines fiktiven Falls, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127289