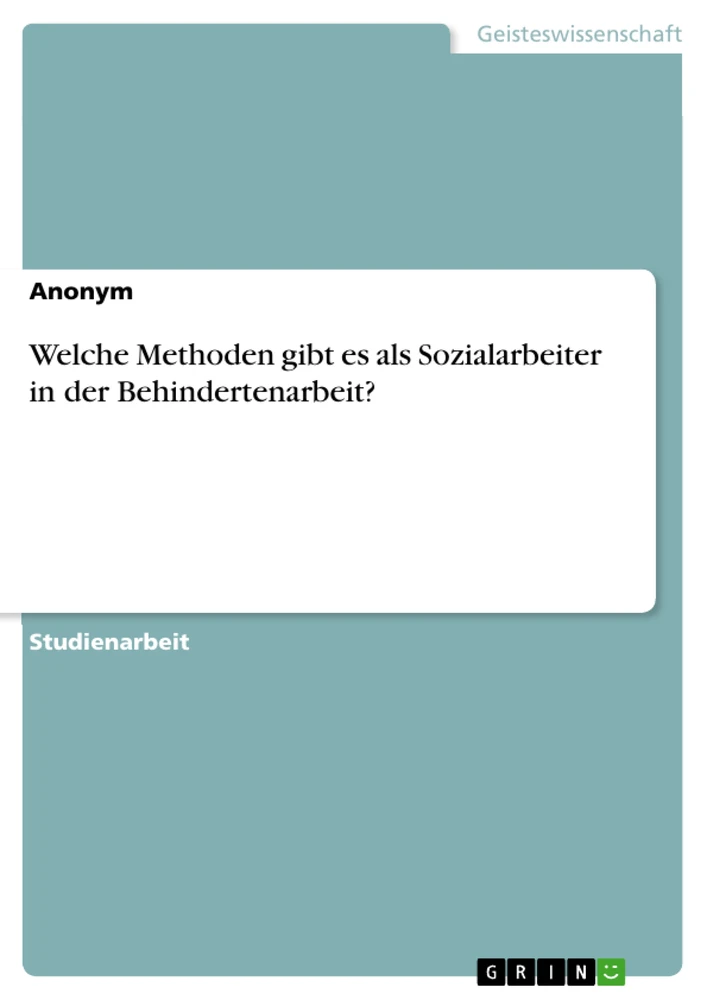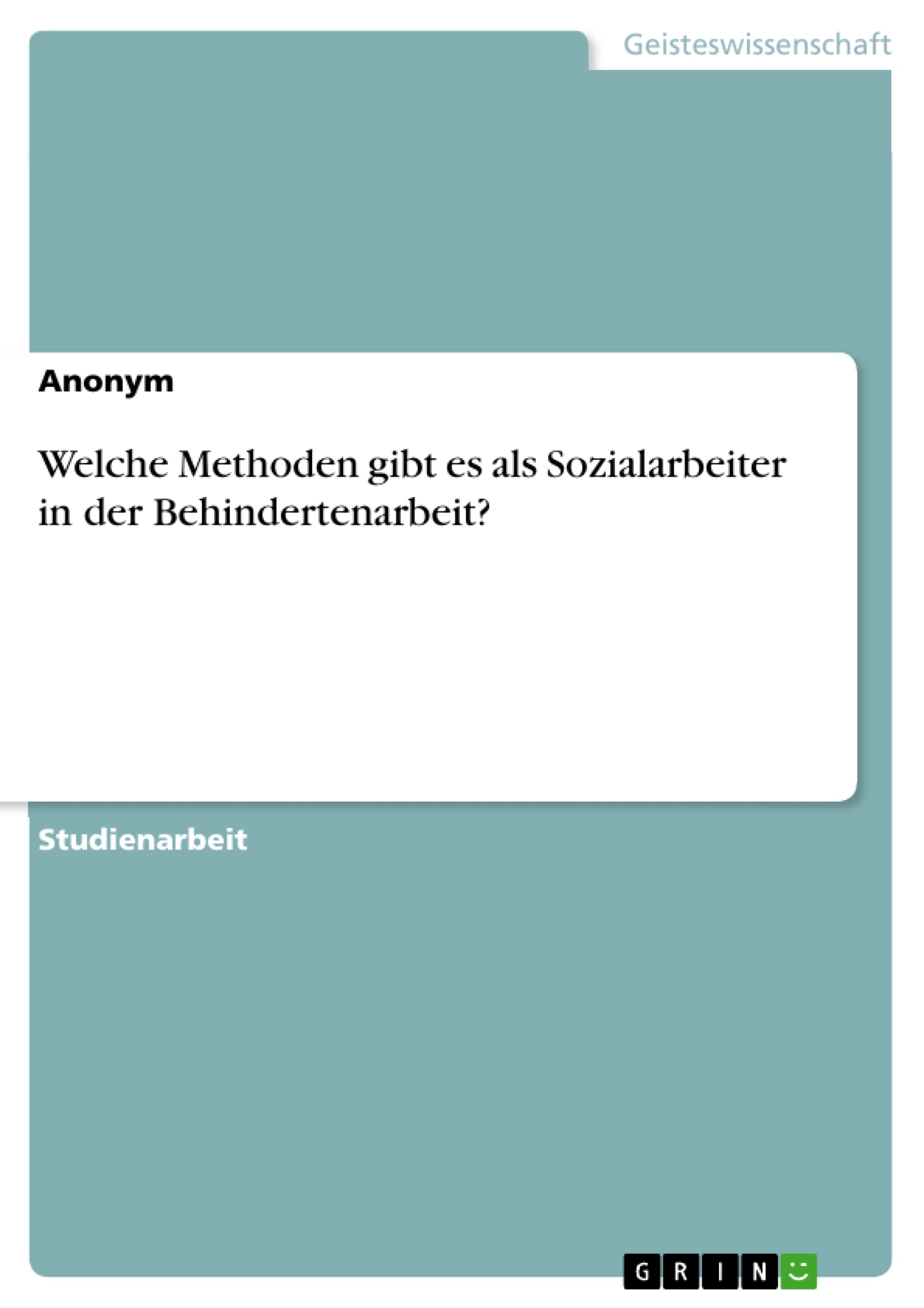Im ersten Abschnitt meiner Hausarbeit nehme ich eine ausführliche Begriffsdefinition zur geistigen Behinderung vor. Der Hauptteil meiner Arbeit beschäftigt sich mit der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe und welche Arbeitsformen es hierbei gibt. Ich werde die Form der Erlebnispädagogik, des Gentle Teachings sowie das Soziale Kompetenztraining hierzu vorstellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Hausarbeit ist das Normalisierungsprinzip sowie die Selbstbestimmung und das Konzept des Empowerments. Inhaltlich komme ich dann zu meinem letzten Punkt und beziehe mich beim Empowerment ebenfalls auf die Soziale Arbeit. Abschließend ziehe ich dann noch mein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe
- 3.1 Erlebnispädagogik
- 3.2 Gentle Teaching
- 3.3 Soziales Kompetenztraining
- 4. Das Normalisierungsprinzip
- 4.1 Erfolg und Kritik des Normalisierungsprinzips
- 4.2 Selbstbestimmung und Empowerment
- 4.3 Empowerment in der Behindertenhilfe
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit im Kontext geistiger Behinderung. Ziel ist es, das Wissen über angewandte Arbeitsformen zu erweitern und zu vertiefen. Die Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse.
- Definition geistiger Behinderung und unterschiedliche Perspektiven darauf
- Methoden der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe (Erlebnispädagogik, Gentle Teaching, Soziales Kompetenztraining)
- Das Normalisierungsprinzip und seine Bedeutung
- Selbstbestimmung und Empowerment im Kontext geistiger Behinderung
- Die Rolle des Empowerments in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund und die Motivation der Autorin, sich mit der Thematik der Sozialen Arbeit bei geistiger Behinderung auseinanderzusetzen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf eine Definition geistiger Behinderung, die Vorstellung verschiedener Methoden der Sozialen Arbeit und die Erörterung des Normalisierungsprinzips und des Empowerments konzentriert. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des Wissens über die Arbeit mit geistig behinderten Menschen.
2. Definition: Dieses Kapitel widmet sich der vielschichtigen Definition des Begriffs „geistige Behinderung“. Es werden medizinisch-juristische, pädagogische und sozialwissenschaftliche Perspektiven beleuchtet, wobei die Grenzen und Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition herausgestellt werden. Die Autorin zeigt, dass der Begriff nicht nur medizinische Aspekte umfasst, sondern auch soziale und individuelle Faktoren wie das subjektive Erleben der Behinderung und die gesellschaftliche Einbettung berücksichtigt werden müssen. Die Kapitel diskutiert die Definitionen nach ICD-10 und DSM-IV, inklusive der unterschiedlichen Schweregrade geistiger Behinderung und deren Auswirkungen auf den Alltag Betroffener. Abschließend werden vier Faktoren (biologische, lern- und entwicklungspsychologische, kontextuelle und die Selbst- und Fremdwahrnehmung) vorgestellt, die zur umfassenden Betrachtung geistiger Behinderung beitragen. Die Interaktion dieser Faktoren wird betont, um zu verdeutlichen, dass eine geistige Behinderung nicht allein auf eine einzelne Ursache zurückzuführen ist.
3. Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe: Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe. Er stellt die Erlebnispädagogik, Gentle Teaching und das Soziale Kompetenztraining vor. Es werden die jeweiligen Ansätze, Zielsetzungen und Methoden der drei unterschiedlichen pädagogischen Interventionen beschrieben und miteinander verglichen. Die Kapitel analysiert, wie diese Methoden die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung fördern und welche Rolle die jeweiligen Methoden für eine inklusive Gesellschaft spielen.
4. Das Normalisierungsprinzip: Dieses Kapitel behandelt das Normalisierungsprinzip, seine Erfolge und Kritikpunkte, Selbstbestimmung und Empowerment im Kontext geistiger Behinderung. Es werden die Kernelemente des Normalisierungsprinzips erläutert und seine Bedeutung für die inklusive Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung diskutiert. Die Autorin reflektiert kritische Aspekte des Prinzips und stellt den Zusammenhang zu Selbstbestimmung und Empowerment her, unterstreicht die Bedeutung von Empowerment in der Behindertenhilfe und zeigt auf, wie dieses Konzept die Teilhabe und die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung verbessern kann.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Erlebnispädagogik, Gentle Teaching, Soziales Kompetenztraining, Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung, Empowerment, Inklusion, Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Soziale Arbeit bei geistiger Behinderung
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Sozialen Arbeit im Kontext geistiger Behinderung. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition geistiger Behinderung aus verschiedenen Perspektiven, eine Darstellung verschiedener Methoden der Sozialen Arbeit (Erlebnispädagogik, Gentle Teaching, Soziales Kompetenztraining), eine Auseinandersetzung mit dem Normalisierungsprinzip inklusive Kritik und einer Betrachtung von Selbstbestimmung und Empowerment in diesem Kontext. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab und enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe.
Welche Methoden der Sozialen Arbeit werden behandelt?
Die Hausarbeit untersucht drei Methoden der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe: Erlebnispädagogik, Gentle Teaching und Soziales Kompetenztraining. Für jede Methode werden Ansatz, Zielsetzung und Methodik beschrieben und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf der Förderung von Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung.
Wie wird der Begriff „geistige Behinderung“ definiert?
Das Kapitel „Definition“ beleuchtet den Begriff „geistige Behinderung“ aus medizinisch-juristischen, pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Es werden die Definitionen nach ICD-10 und DSM-IV diskutiert, inklusive der unterschiedlichen Schweregrade. Die Hausarbeit betont, dass der Begriff nicht nur medizinische Aspekte, sondern auch soziale und individuelle Faktoren sowie die gesellschaftliche Einbettung berücksichtigt werden muss. Vier Faktoren (biologische, lern- und entwicklungspsychologische, kontextuelle und die Selbst- und Fremdwahrnehmung) werden vorgestellt, um eine umfassende Betrachtung zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt das Normalisierungsprinzip?
Die Hausarbeit analysiert das Normalisierungsprinzip, seine Erfolge und seine Kritikpunkte. Es wird der Zusammenhang zum Empowerment und zur Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung hergestellt. Die Bedeutung des Normalisierungsprinzips für inklusive Teilhabe wird diskutiert.
Was versteht die Hausarbeit unter Empowerment?
Die Hausarbeit betont die Bedeutung von Empowerment in der Behindertenhilfe. Es wird gezeigt, wie dieses Konzept die Teilhabe und die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung verbessern kann. Der Zusammenhang zwischen Empowerment, Selbstbestimmung und dem Normalisierungsprinzip wird deutlich herausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Die Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Geistige Behinderung, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Erlebnispädagogik, Gentle Teaching, Soziales Kompetenztraining, Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung, Empowerment, Inklusion, Teilhabe.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist die Erweiterung und Vertiefung des Wissens über angewandte Arbeitsformen der Sozialen Arbeit im Kontext geistiger Behinderung. Die Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse.
Welche Kapitel beinhaltet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition geistiger Behinderung, Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe (mit Unterkapiteln zu Erlebnispädagogik, Gentle Teaching und Sozialem Kompetenztraining), Das Normalisierungsprinzip (mit Unterkapiteln zu Erfolg und Kritik, Selbstbestimmung und Empowerment in der Behindertenhilfe) und Fazit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Welche Methoden gibt es als Sozialarbeiter in der Behindertenarbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1270063