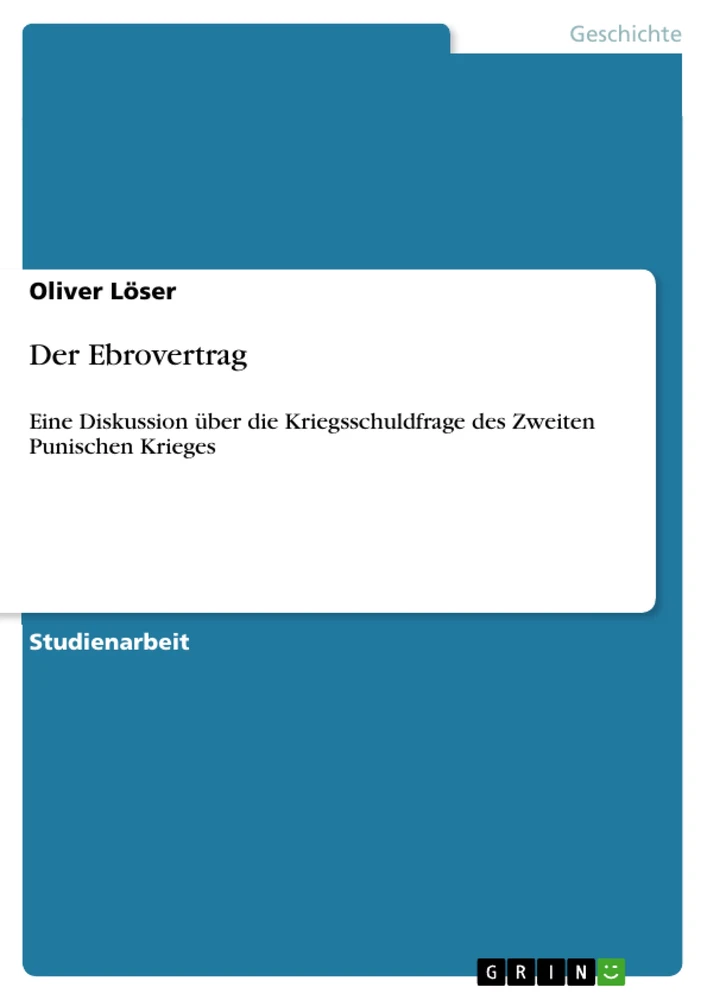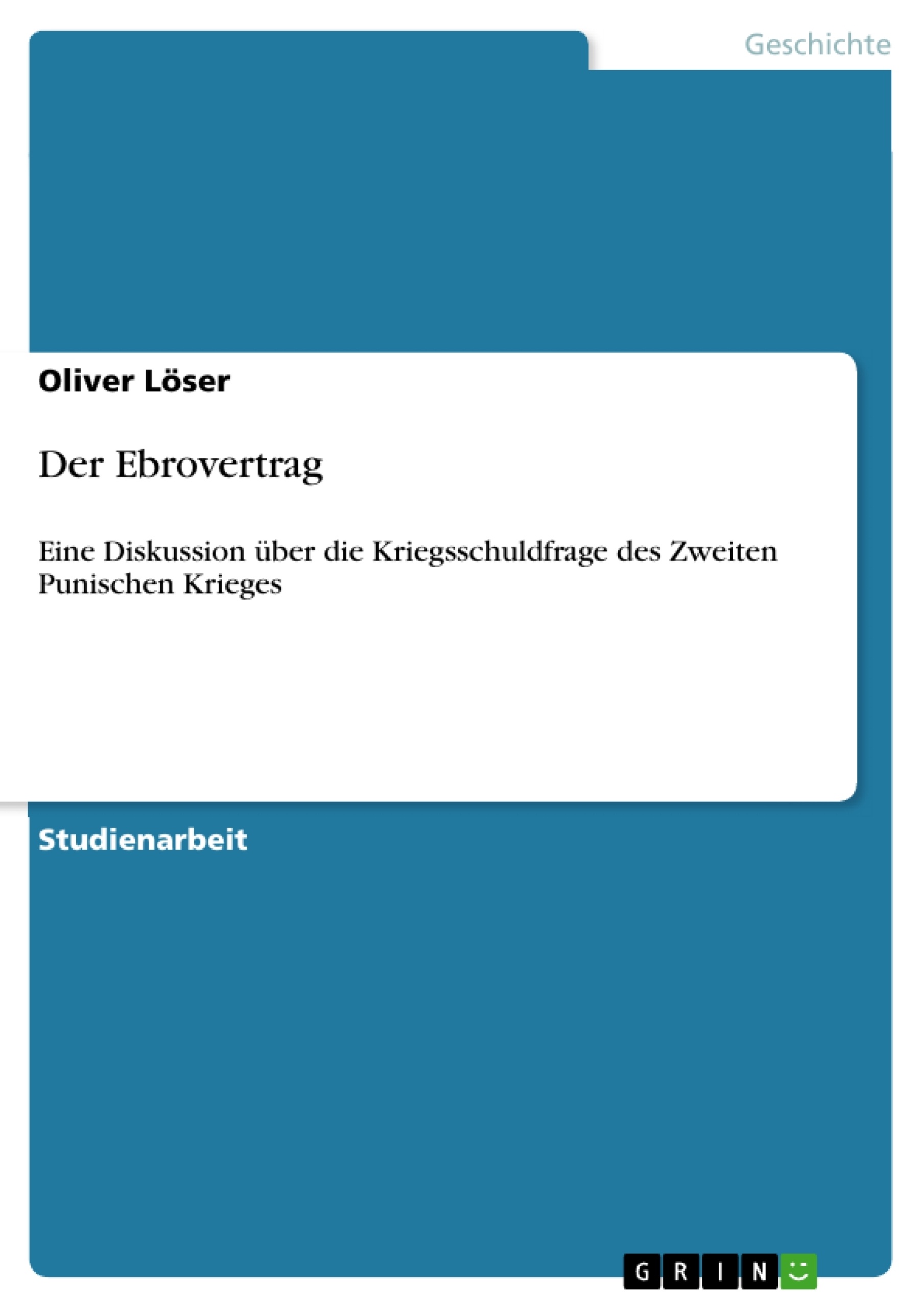Seit ihrer Niederlage im ersten Punischen Krieg gegen Rom 241, sahen sich die Karthager den Ansprüchen der neuen Großmacht im zentralen Mittelmeer ausgesetzt. Rom legte den Punieren gewaltige Kriegskontributionen auf, bemächtigte sich fast aller Karthagischen Besitzungen im Mittelmeer und zwang so die Nordafri-kanische Großmacht, sich nach neuen Einnahmequellen umzusehen. Das folgende Karthagische Engagement in Spanien kumulierte schließlich im Angriff auf Sagunt im Jahre 219, und dem Zug Hannibals nach Italien im Frühjahr 218.
Die Diskussion um die Kriegsschuldfrage setzte bereits mit Fabius Pictor ein. Dieser Römische Senator sah „als erste die Belagerung von Sagunt durch die Karthager, als zweite ihre vertragswidrige Überschreitung des [...] Iberos [Ebro] genannten Flusses“ als Kriegsursachen an.
Hier kommt zum ersten Mal der sogenannte Ebrovertrag von 226 zwischen Rom und Karthago ins Spiel. Als gesichert gilt, daß der Ebro als Nordgrenze des Karthagischen Einflußgebietes in Spanien fixiert wurde. Doch schon an der Frage nach der Lage des Ebro scheiden sich auch heute noch die Geister. Und wie stand
es mit der Gültigkeit des Vertrages? Den Römern galt er als verbindliches Dokument, der Karthagische Rat jedoch verweigerte dem Werk die Anerkennung, „als entweder gar nicht abgeschlossen [...], oder als unverbindlich für sie selbst“. Und was hatte es mit der berühmt, berüchtigten Saguntklausel auf sich? Eine Erfindung der Römischen Annalisten, um das Vorgehen Hannibals gegen diese Stadt, welcher die „Freiheit belassen werden“ sollte, als cassus belli darzustellen? Aus welchen Gründen wurde der Vertag geschlossen? Als Rückversicherung der Römer für die Dauer ihres Kampfes gegen die Kelten Oberitaliens, als offizielle Anerkennung der Karthagischen Position in Spanien?
Diese Fragen gilt es im Verlauf dieser Arbeit zu klären. Das Thema erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit unter den modernen Historikern, und alle Meinungen darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Dennoch sollen unterschiedliche Kontoversen zu Wort kommen, und beurteilt werden.
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Quellenlage zum Thema, es folgt eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse bis 226, insbesondere das Wirken der Barkiden in Spanien, und schließlich die Diskussion über den Ebrovertrag selbst, sowie seine Rolle bei den Verhandlungen unmittelbar vor Kriegsausbruch.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellenlage
- Die Karthagischen und Griechischen Geschichtsschreiber
- Die Römische Geschichtsschreibung
- Karthagos Niederlage im ersten Punischen Krieg
- Der Friedensvertrag von 241
- Der Libysche Krieg und die Wegnahme Sardiniens
- Die Barkiden in Spanien
- Die ersten Jahre in Spanien unter Hamilkar
- Hasdrubal als Nachfolger Hamilkars in Spanien
- Die Römischen Aktionen in Übersee zwischen 1. und 2. punischen Krieg
- Der Keltenkrieg in Oberitalien (232-222)
- Das Römische Eingreifen in Illyrien ab 219
- Der Ebrovertrag
- Die Datierung des Vertrages
- Die Überlieferungen und Inhalte des Ebrovertrages
- Die Saguntklausel und die Beziehungen zwischen Rom und Sagunt
- Die Darstellung des Polybios
- Die Darstellung des Livius
- Die Lokalisierung des Flusses Ebro
- Die Gründe des Vertragsabschlusses
- Die Diplomatie Roms und Karthagos in den Jahren 221-219
- Die Belagerung von Sagunt 219
- Die Kriegserklärung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Ebrovertrag, einem Abkommen zwischen Rom und Karthago aus dem Jahr 226 v. Chr., und dessen Rolle im Vorfeld des zweiten Punischen Krieges. Ziel ist es, die Hintergründe des Vertragsabschlusses zu beleuchten, die Inhalte des Ebrovertrages zu analysieren und die Frage nach der Kriegsschuld im zweiten Punischen Krieg zu diskutieren.
- Die Quellenlage zum Ebrovertrag und die unterschiedlichen Perspektiven der römischen und karthagischen Geschichtsschreibung
- Die Rolle der Barkiden in Spanien und die Expansion Karthagos
- Die Bedeutung des Ebrovertrages als Grenzvertrag und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Rom und Karthago
- Die Saguntklausel und die Frage nach ihrer Gültigkeit
- Die diplomatischen Verhandlungen zwischen Rom und Karthago vor dem Ausbruch des zweiten Punischen Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges für die Geschichte Roms heraus. Sie beleuchtet die Rolle Hannibals und die Vorgeschichte des Konflikts, die mit der Niederlage Karthagos im ersten Punischen Krieg begann. Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit, die Kriegsschuldfrage, und die Bedeutung des Ebrovertrages in diesem Zusammenhang heraus.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Quellenlage zum zweiten Punischen Krieg und dem Ebrovertrag. Es werden die wichtigsten antiken Historiker, die sich mit diesem Thema befasst haben, vorgestellt, darunter Polybios, Livius und Fabius Pictor. Die unterschiedlichen Perspektiven der römischen und karthagischen Geschichtsschreibung werden beleuchtet und die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Ereignisse aufgrund der tendenziösen Darstellung der Quellen werden aufgezeigt.
Das dritte Kapitel behandelt die Niederlage Karthagos im ersten Punischen Krieg und die Folgen für die Karthager. Es werden der Friedensvertrag von 241 und der Libysche Krieg sowie die Wegnahme Sardiniens durch Rom beschrieben. Dieses Kapitel zeigt die schwierige Situation der Karthager nach dem ersten Punischen Krieg und die Notwendigkeit, neue Einnahmequellen zu finden, auf.
Das vierte Kapitel widmet sich den Barkiden in Spanien und ihrer Expansion. Es werden die ersten Jahre unter Hamilkar und die Herrschaft von Hasdrubal als Nachfolger Hamilkars in Spanien beschrieben. Dieses Kapitel beleuchtet die strategische Bedeutung Spaniens für Karthago und die wachsende Bedrohung für Rom durch die karthagische Expansion.
Das fünfte Kapitel beschreibt die römischen Aktionen in Übersee zwischen dem ersten und zweiten Punischen Krieg. Es werden der Keltenkrieg in Oberitalien und das römische Eingreifen in Illyrien behandelt. Dieses Kapitel zeigt die wachsende Macht Roms und seine Expansion im Mittelmeerraum auf.
Das sechste Kapitel analysiert den Ebrovertrag. Es werden die Datierung des Vertrages, die Überlieferungen und Inhalte des Ebrovertrages sowie die Saguntklausel und ihre Bedeutung für die Beziehungen zwischen Rom und Sagunt diskutiert. Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Ebrovertrages und die Frage nach seiner Gültigkeit.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Diplomatie Roms und Karthagos in den Jahren 221-219. Es werden die Belagerung von Sagunt 219 und die Kriegserklärung durch Rom behandelt. Dieses Kapitel zeigt die Eskalation des Konflikts zwischen Rom und Karthago und die Rolle des Ebrovertrages in diesem Zusammenhang auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Ebrovertrag, den zweiten Punischen Krieg, die Kriegsschuldfrage, die Barkiden, die Beziehungen zwischen Rom und Karthago, die Saguntklausel, die Expansion Karthagos, die römische Expansion, die Quellenlage und die antike Geschichtsschreibung.
- Quote paper
- Oliver Löser (Author), 2005, Der Ebrovertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/126810