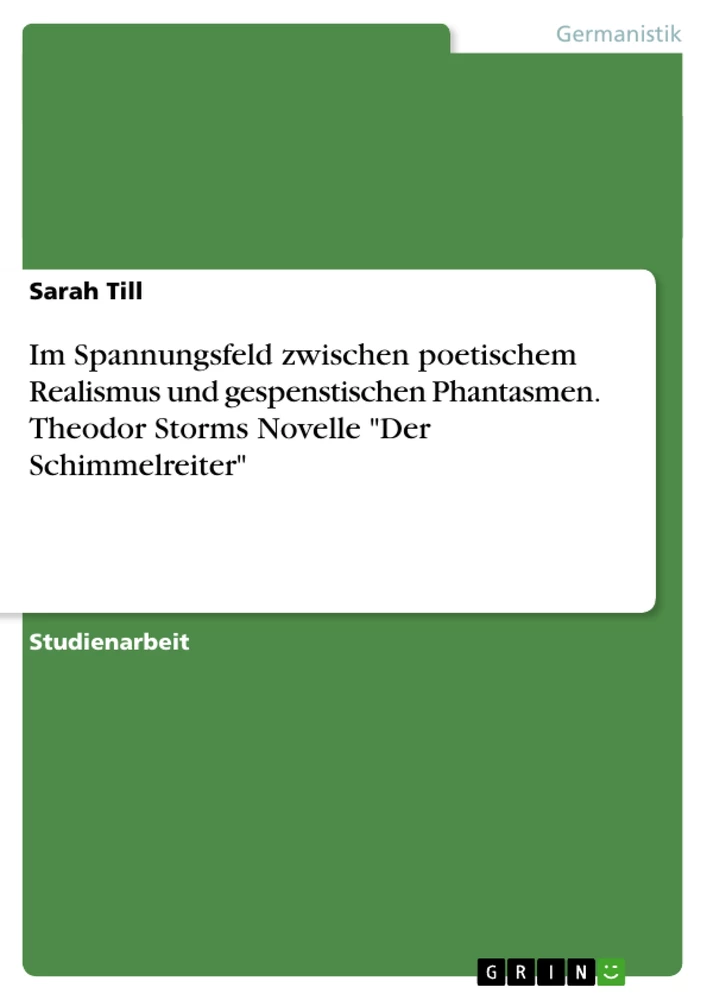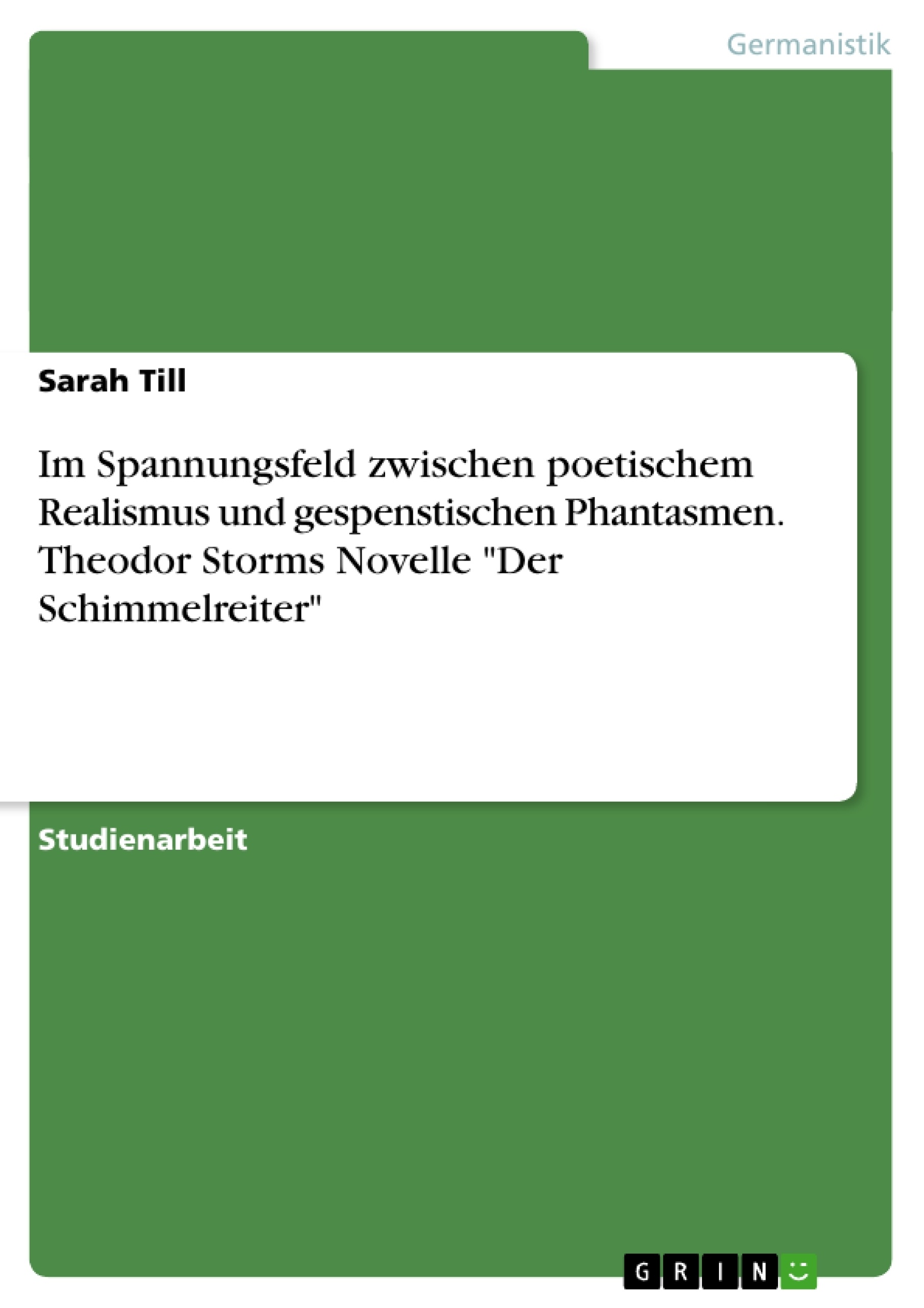Die Zeit, in der Theodor Storm lebte (vgl. Rothmann, 176-180), war gekennzeichnet durch den immensen wirtschaftlich-industriellen Aufschwung, den die expansive Industrialisierung Europas mit sich brachte.
In den Bereichen Physik, Psychologie und der entwicklungsgeschichtlichen Biologie konnten darüber hinaus neue naturwissenschaftliche Erkenntnisformen gewonnen werden. Die technische Auswertung der Naturwissenschaften begünstigte die angelaufene industrielle Revolution und damit den Aufschwung der bürgerlichen Großindustrie und des Kapitalismus. Allmählich setzte sich ein Wirklichkeitsverständnis für die Errungenschaften der Aufklärung ein und das bürgerliche Weltbild entstand.
Auch politisch-gesellschaftliche Aktivitäten prägten diese Zeit des Wandels: Mit der Reichsgründung 1871 ging der Traum von der politischen Einheit Deutschlands in Erfüllung. In die Flaute der Ereignislosigkeit der Restaurationsphase nach der gescheiterten 48er-Revolution kam damit Aufbruchsstimmung. Das dynamische Lebensgefühl der sich anschließenden Gründerphase weckte gestalterische Kräfte und entfesselte starke Handlungsimpulse in den Bereichen in Politik, Wirtschaft und Kunst.
Das, was unser heutiges Fortschrittsdenken und Technikvertrauen ausmacht, hat seine Wurzeln demnach in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Obwohl die heutige Welt scheinbar keine Rätsel mehr birgt, erfreuen sich Geschichten, die irrationale und übernatürliche Phänomene thematisieren, großer Beliebtheit. Die Tatsache, dass solche Geschichten heute weniger in traditionellen oralen Erzählsituationen denn mittels Kino oder Hörbuch weitergegeben werden, scheint dem Verlangen nach Spuk keinen Abbruch zu tun. Der Wunsch, Gruselgeschichten zu hören, war auch vielen der Zeitgenossen Theodor Storms eigen. Betrachtet man den Zeitgeist des Realismus, der diese Menschen umgetrieben haben muss, mag dies seltsam anmuten, befand man sich doch in einer rasanten Um- und Aufbruchsepoche in Richtung Zukunft.
Doch ausgerechnet Storms Alterswerk „Der Schimmelreiter“, das erst 1888 fertiggestellt wurde, weist genug phantastische Spukelemente auf, um die Frage nach einem anachronistischen Widerspruch zu stellen. Wie gezeigt werden wird, entkräftigt Storm einen solchen Vorwurf mit „Der Schimmelreiter“, indem er sich mit Hilfe diverser erzählstrategischer Mittel bezüglich der Spukelemente ins Reich der Ambiguitäten rettet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poetischer Realismus
- Gruselgeschichten im Realismus
- Storms Affinität zum Gruseligen
- Fiktionalisierte Realität
- Die Entwicklung der Schauerelemente in „Der Schimmelreiter“
- Demaskierung des Aberglaubens durch Relativierungssignale
- Gattungspoetologische Selbstreflexion
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einbindung phantastischer Elemente, insbesondere von Gruselelementen, in Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ vor dem Hintergrund des poetischen Realismus. Ziel ist es, den scheinbaren Widerspruch zwischen realistischen Darstellungsweisen und der Verwendung von irrationalen Motiven aufzuzeigen und zu analysieren, wie Storm diese Spannung literarisch auflöst.
- Der poetische Realismus und seine Ausprägungen im 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Grusel- und Schauerelementen im Realismus
- Die Entwicklung und Funktion der Spukelemente in „Der Schimmelreiter“
- Storms erzähltechnische Strategien zur Ambiguitätsgestaltung
- Die Beziehung zwischen Realität und Fiktion in Storms Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen und gesellschaftlichen Kontext, in dem Theodor Storm lebte und arbeitete, und hebt den Umbruch vom Restaurationszeitalter zur Gründerzeit hervor. Sie stellt die Frage nach der Manifestation dieser neuen Strömungen in "Der Schimmelreiter" und dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem Fortschrittsdenken des 19. Jahrhunderts und der anhaltenden Beliebtheit von Geschichten mit übernatürlichen Phänomenen. Die Einleitung deutet an, dass Storm diesen Widerspruch in seinem Werk durch geschickte erzähltechnische Mittel auflöst, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Poetischer Realismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Realismus" im Kontext des 19. Jahrhunderts, charakterisiert ihn durch den Optimismus bezüglich der Beherrschbarkeit der Realität und die Betonung von Kausalzusammenhängen zwischen individuellem und gesellschaftlichem Dasein. Es wird der "poetische Realismus" als eine Form der Wirklichkeitsinterpretation eingeführt, die Fiktion und Realität miteinander verwebt und die Erkenntnisfähigkeit des Lesers herausfordert. Die Rolle des Wahrscheinlichkeitsprinzips wird im Verhältnis zu fiktionalen Elementen diskutiert, und der Ansatz von Otto Ludwig, der die realistisch schaffende Phantasie betont, wird erläutert.
Die Entwicklung der Schauerelemente in „Der Schimmelreiter“: Dieses Kapitel (die Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und muss aus dem vollständigen Text entnommen werden). Es wird eine detaillierte Analyse der im Roman vorkommenden Spukelemente und ihrer Entwicklung im Laufe der Handlung geben, inklusive einer Auseinandersetzung mit der Funktion der Schauermomente in der Gesamtkomposition der Novelle.
Demaskierung des Aberglaubens durch Relativierungssignale: Dieses Kapitel (die Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und muss aus dem vollständigen Text entnommen werden). Die Analyse wird die verschiedenen literarischen Mittel untersuchen, die Storm verwendet, um die Glaubwürdigkeit der übernatürlichen Elemente zu relativieren und Aberglauben zu hinterfragen.
Gattungspoetologische Selbstreflexion: Dieses Kapitel (die Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und muss aus dem vollständigen Text entnommen werden). Es wird die Selbstreflexion des Autors bezüglich der literarischen Gattung und die bewusste Verwendung von realistischen und phantastischen Elementen im Roman untersuchen.
Schlüsselwörter
Poetischer Realismus, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Gruselgeschichten, Schauerelemente, Realität, Fiktion, Erzähltechnik, Ambiguität, Aberglaube, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Gruselelemente in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Integration phantastischer, insbesondere gruseliger Elemente, in Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter" im Kontext des poetischen Realismus. Im Mittelpunkt steht der scheinbare Widerspruch zwischen realistischen Darstellungsweisen und irrationalen Motiven und wie Storm diese Spannung literarisch auflöst.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den poetischen Realismus und seine Ausprägungen im 19. Jahrhundert, die Rolle von Grusel- und Schauerelementen im Realismus, die Entwicklung und Funktion dieser Elemente in "Der Schimmelreiter", Storms erzähltechnische Strategien zur Ambiguitätsgestaltung und die Beziehung zwischen Realität und Fiktion in Storms Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum poetischen Realismus, ein Kapitel zur Entwicklung der Schauerelemente in "Der Schimmelreiter", ein Kapitel zur Demaskierung des Aberglaubens durch Relativierungssignale, ein Kapitel zur gattungspoetologischen Selbstreflexion und einen Schluss. Die Kapitelübersichten geben einen ersten Einblick in den jeweiligen Inhalt, wobei detailliertere Zusammenfassungen der Kapitel 3-5 aufgrund fehlender Informationen im Ausgangstext ergänzt werden müssten.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den historischen und gesellschaftlichen Kontext von Storms Leben und Werk, hebt den gesellschaftlichen Wandel vom Restaurationszeitalter zur Gründerzeit hervor und untersucht die Manifestation dieser Strömungen in "Der Schimmelreiter". Sie thematisiert den scheinbaren Widerspruch zwischen Fortschrittsdenken und der anhaltenden Popularität übernatürlicher Geschichten und skizziert Storms literarische Lösung dieses Widerspruchs.
Wie wird der poetische Realismus definiert?
Das Kapitel zum poetischen Realismus definiert den Realismus des 19. Jahrhunderts, charakterisiert ihn durch Optimismus bezüglich der Beherrschbarkeit der Realität und die Betonung von Kausalzusammenhängen. Es führt den "poetischen Realismus" als eine Form der Wirklichkeitsinterpretation ein, die Fiktion und Realität verwebt und die Erkenntnisfähigkeit des Lesers herausfordert. Die Rolle des Wahrscheinlichkeitsprinzips im Verhältnis zu fiktionalen Elementen und der Ansatz von Otto Ludwig werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Poetischer Realismus, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Gruselgeschichten, Schauerelemente, Realität, Fiktion, Erzähltechnik, Ambiguität, Aberglaube, 19. Jahrhundert.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analysemethode, die die erzähltechnischen Strategien Storms im Umgang mit realistischen und phantastischen Elementen untersucht. Die Analyse fokussiert auf die Ambiguität der Darstellung und die Frage, wie Storm Aberglaube relativiert und hinterfragt.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den Kapiteln 3-5?
Detailliertere Zusammenfassungen der Kapitel 3-5 ("Die Entwicklung der Schauerelemente in „Der Schimmelreiter“", "Demaskierung des Aberglaubens durch Relativierungssignale", "Gattungspoetologische Selbstreflexion") sind im vorliegenden Text nicht enthalten und müssten aus dem vollständigen Text der Arbeit entnommen werden.
- Arbeit zitieren
- Sarah Till (Autor:in), 2007, Im Spannungsfeld zwischen poetischem Realismus und gespenstischen Phantasmen. Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/126597