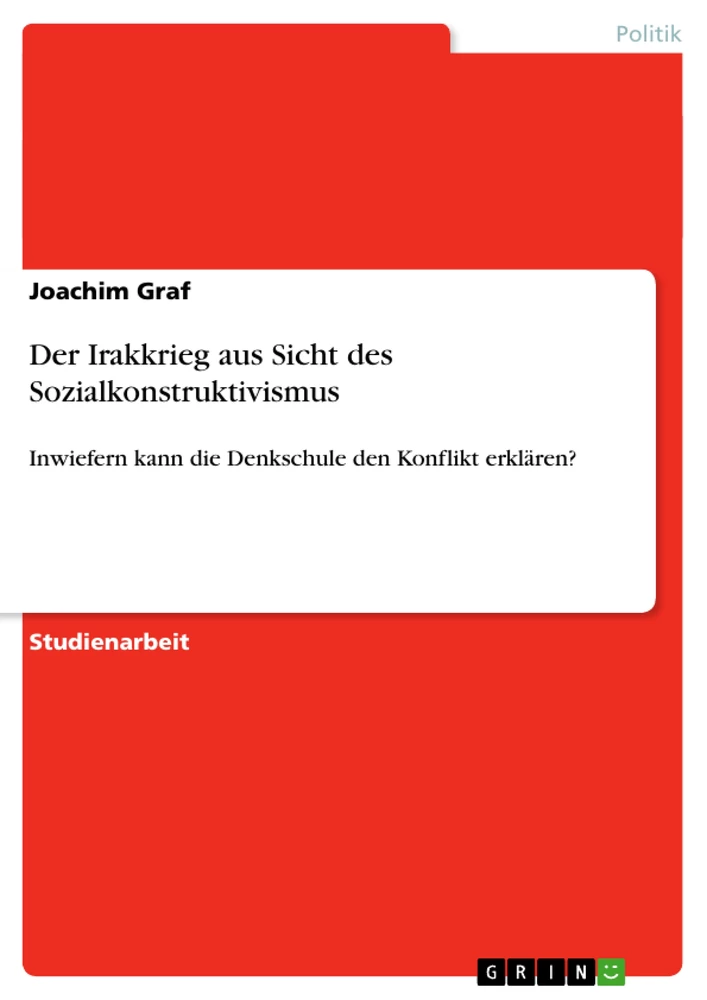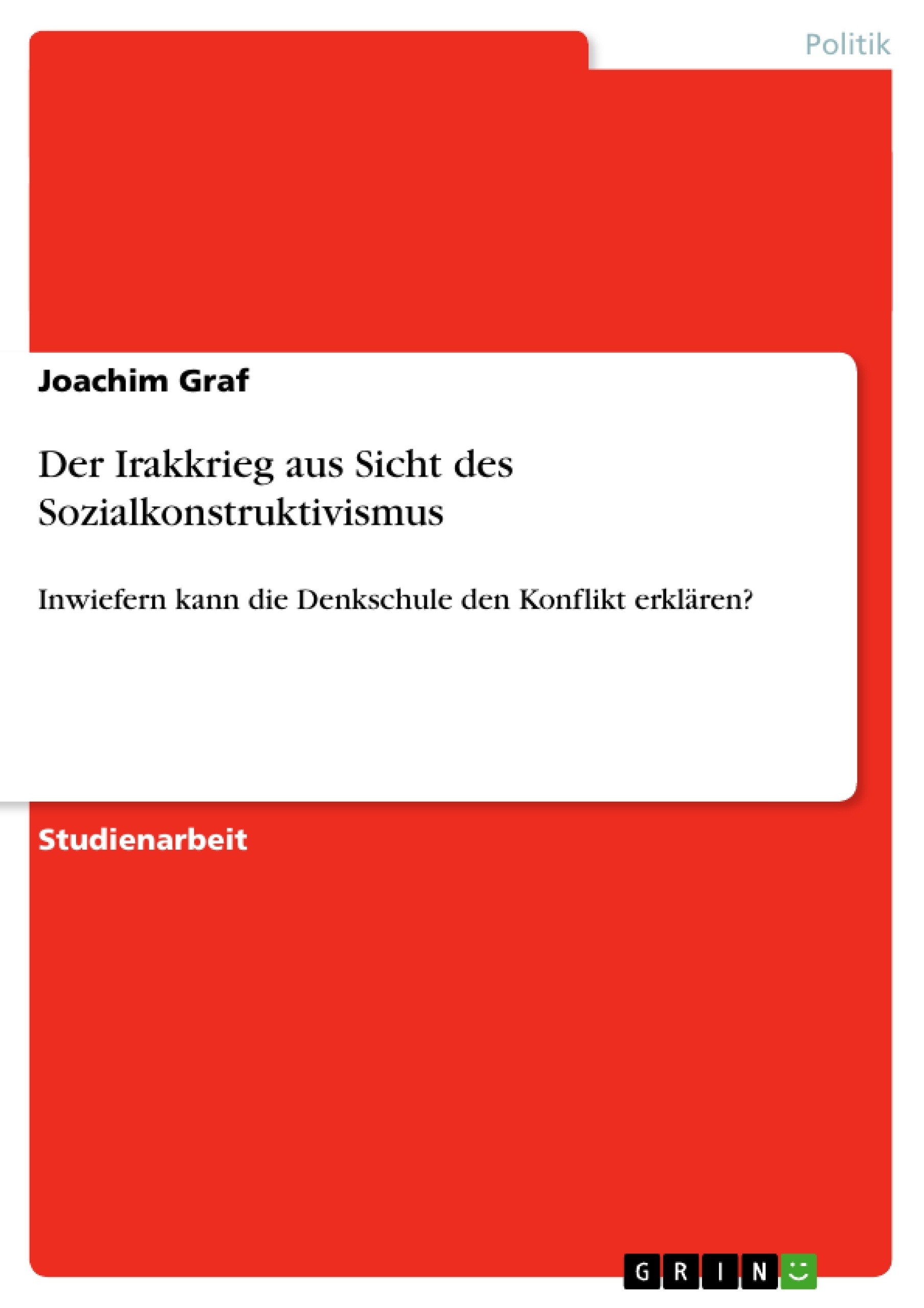Am 20. März 2003 verwandelte sich durch den militärischen Angriff der sog. coalition of the willing auf den Irak der latente Irakkonflikt in einen manifesten. Im offiziell bis zum 2. Mai 2003 dauernden dritten Golfkrieg wurde das irakische Regime Saddam Husseins abgesetzt, der Staat besetzt und demokratische Wahlen durchgeführt.
Der Irakkrieg kann als ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der politikwissenschaftlichen Teildisziplin IB angesehen werden, die sich allgemein mit dem Verhältnis von Staaten zueinander und schwerpunktmäßig mit Konflikten und der Frage, wie Kriege entstehen und wie solche zu verhindern sind, beschäftigt.
Eine dieser Theorieschulen der Internationalen Beziehungen ist der Konstruktivismus bzw. dessen Subtheorie Sozialkonstruktivismus, welcher erst in den 90er Jahren entstand, da zu dieser Zeit viele politikwissenschaftliche Theoretiker von der Notwendigkeit der Schaffung eines neuen Erklärungsansatzes in der IB überzeugt waren, da die bisherigen Theorien bezüglich der Vorhersage des unblutigen Ausgangs des Ost-West-Konflikts versagt hatten.
Doch wie interpretiert der Sozialkonstruktivismus den Irakkonflikt? Kann er die Manifestierung des amerikanisch-irakischen Gegensatzes, also die Austragung mittels militärischer Gewalt erklären? Vermag die Theorie den Konflikt so zu analysieren, dass die Gründe für den Krieg ersichtlich werden? Kann der Sozialkonstruktivismus den Konflikt plausibel offenbaren oder sind hierzu die Ansätze anderer Theorieschulen besser geeignet? Mit diesen Fragen möchte sich die vorliegende Hausarbeit auseinandersetzen.
Diesbezüglich soll im ersten Kapitel zunächst der Konflikt betrachtet und anhand des von Frank Schimmelpfennig entwickelten Konfliktfünfecks beschrieben werden.
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird dann kurz die Theorieschule des Sozialkonstruktivismus vorgestellt, wobei explizit auf die Grundannahmen des Konstruktivismus bzw. Sozialkonstruktivismus, sowie dessen Variablen, Kernhypothesen und Kausalmodell eingegangen wird.
Im darauf folgenden dritten Abschnitt soll eine fallspezifische Hypothese abgeleitet und die Theorie auf den Konflikt angewendet werden. In der Operationalisierung wird dann überprüft, wie gut die Theorie allgemein auf den Konflikt angewendet werden kann.
Das vierte Kapitel will dann überprüfen, warum die beteiligten Akteure keine gemeinsamen Identitäten aufbauen konnten.
Im Schlussteil werden schließlich die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Irakkonflikt aus Sicht des Konfliktfünfeckes von Schimmelpfennig
- Die Konfliktparteien
- Der Konfliktgegenstand
- Positionsdifferenzen
- Die Konfliktumwelt
- Der Konfliktaustrag
- Die Denkschule des Sozialkonstruktivismus
- Die Grundannahmen des Konstruktivismus/ Sozialen Konstruktivismus
- Die Variablen des Sozialkonstruktivismus
- Die drei Kernhypothesen des Sozialkonstruktivismus
- Das Kausalmodell des Sozialkonstruktivismus
- Ableitung der Hypothese und Anwendung auf den Konflikt
- Ableitung der fallspezifischen Hypothese und Anwendung auf den Konflikt
- Die Bestimmung der Variablen
- Operationalisierung
- Gründe für den Nichtaufbau gemeinsamer Identitäten der Akteure
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Irakkrieg aus der Perspektive des Sozialkonstruktivismus. Ziel ist es, die Denkschule des Sozialkonstruktivismus vorzustellen und zu untersuchen, inwiefern sie den Konflikt erklären kann. Dabei wird der Irakkrieg anhand des Konfliktfünfecks von Schimmelpfennig beschrieben und die fallspezifische Hypothese des Sozialkonstruktivismus abgeleitet.
- Die Grundannahmen des Sozialkonstruktivismus
- Die Rolle von Identitäten und Interaktionen im Konflikt
- Die Bedeutung von Diskursen und Interpretationen
- Die Analyse des Irakkrieges anhand des Konfliktfünfecks
- Die Anwendung des Sozialkonstruktivismus auf den Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Irakkrieg als Untersuchungsgegenstand vor und erläutert die Relevanz des Sozialkonstruktivismus für die Analyse des Konflikts. Kapitel 1 beschreibt den Irakkrieg anhand des Konfliktfünfecks von Schimmelpfennig, indem es die Konfliktparteien, den Konfliktgegenstand, die Positionsdifferenzen, die Konfliktumwelt und den Konfliktaustrag beleuchtet. Kapitel 2 stellt die Denkschule des Sozialkonstruktivismus vor, indem es auf die Grundannahmen, Variablen, Kernhypothesen und das Kausalmodell eingeht. Kapitel 3 leitet eine fallspezifische Hypothese ab und wendet den Sozialkonstruktivismus auf den Irakkrieg an. Die Operationalisierung überprüft die Anwendbarkeit der Theorie auf den Konflikt. Kapitel 4 untersucht die Gründe für den Nichtaufbau gemeinsamer Identitäten der Akteure. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und resümiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Irakkrieg, den Sozialkonstruktivismus, das Konfliktfünfeck, Identitäten, Interaktionen, Diskurse, Interpretationen, Konfliktparteien, Konfliktgegenstand, Positionsdifferenzen, Konfliktumwelt, Konfliktaustrag, Operationalisierung, und die Gründe für den Nichtaufbau gemeinsamer Identitäten der Akteure.
- Quote paper
- Joachim Graf (Author), 2007, Der Irakkrieg aus Sicht des Sozialkonstruktivismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/126596