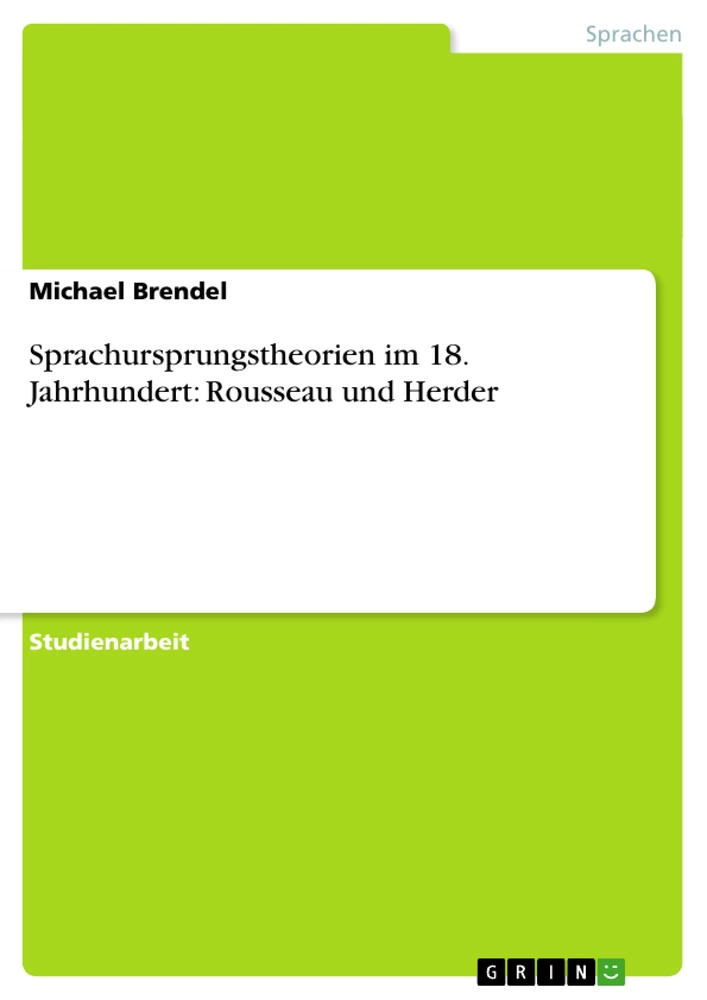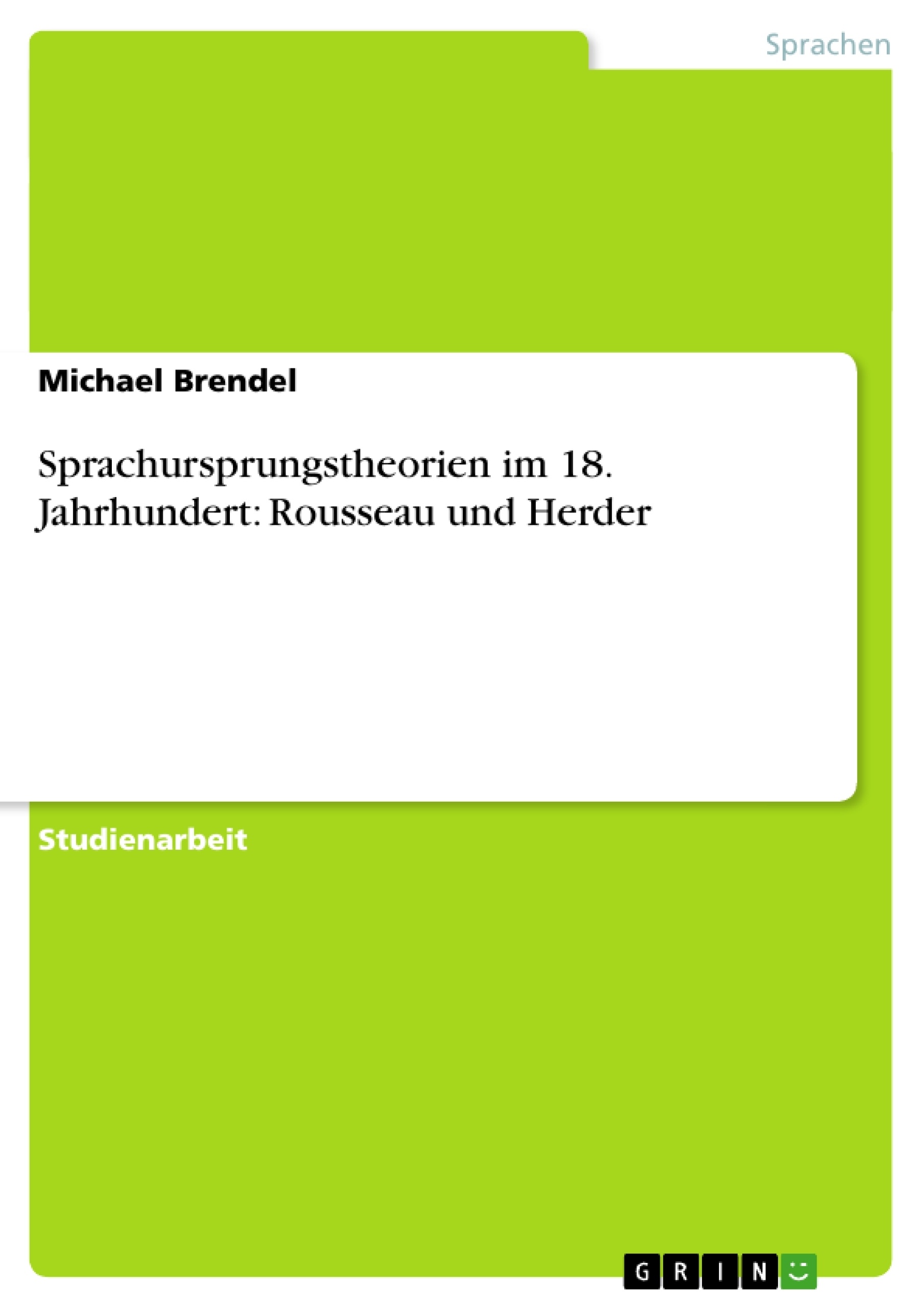Eine Fragestellung, die im Zeitalter der Aufklärung mit äußerst großem Eifer diskutiert wurde, ist die nach dem Ursprung der Sprache.
Auf der einen Seite propagierten Philosophen, die sich strikt an der biblischen Glaubenslehre orientierten, den göttlichen Ursprung der Sprache, welcher zumeist „die strikte Grenzziehung zwischen Mensch und Tier wie auch das Bild der nach dem Schöpfungsakt konstant bleibenden Lebewesen“ (Veldre 1997: S. 125) einschloss. Anhänger dieses göttlichen Ursprungs, wie z.B. Beauzée oder der deutsche Philosoph Süßmilch, gingen außerdem davon aus, dass der Mensch bereits als vernunftbegabtes Wesen mit voller Denkfähigkeit erschaffen wurde, was eine göttliche Eingabe der Sprache erst ermöglichte. Auf der anderen Seite begannen Philosophen, die Trennlinie zwischen Tier und Mensch anzutasten und sich mit einer möglichen Entwicklung des Menschen aus einem wie auch immer gearteten Naturzustand zu beschäftigen. Seit Condillac, dem Begründer des Sensualismus in Frankreich, gewannen außerdem Hypothesen an Bedeutung, die davon ausgingen, dass Sprache und Denken eng miteinander verknüpft sind und sich deshalb nur gemeinsam entwickeln konnten. Es waren jedoch nicht ausschließlich sensualistische Sprachursprungstheorien, die sich mit der Möglichkeit einer menschlichen Sprachschöpfung befassten.
Einer der bekanntesten und einflussreichsten französischen Sprachdenker des 18. Jahrhunderts war neben Condillac Jean-Jacques Rousseau, dem Droixhe und Hassler eine „sensualistisch-anthropologische Sicht der gemeinsamen Entwicklung von Gesellschaft, Sprache und Denken“ attestieren. Rousseau beschäftigt sich in zwei seiner Werke mit der Sprachursprungsthematik. Zum einen streift er diese in seinem Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), zum anderen behandelt er sie eingehend in seinem Essai sur l’origine des langues, welcher mit dem Untertitel où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale erst posthum (1781) veröffentlicht wurde. Der wohl bedeutendste Sprachtheoretiker auf deutscher Seite war zu dieser Zeit Johann Gottfried Herder, dessen Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772) für Aufsehen sorgte und als „Kulminationspunkt“ der Literatur zu dieser Thematik eingestuft werden kann. Auf den folgenden Seiten sollen sowohl die oben genannten Schriften Rousseaus als auch die Abhandlung Herders genauer unter die Lupe genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der Ursprung der Sprache nach Rousseau
- Das Verhältnis des Discours sur l'inégalité zum Essai sur l'origine des langues
- Der sprachtheoretische Exkurs des Discours als Kritik an Condillac
- Die Sprachursprungstheorie des Discours
- Die Begründung des affektiven Sprachursprungs im Essai sur l'origine des langues
- Rousseaus Klimatheorie: südliche versus nördliche Sprachen
- Der Ursprung der Sprache nach Herder
- Herders Reaktion auf die Sprachursprungshypothesen seiner Zeit
- Der Begriff der „Besonnenheit“ und seine Begründung durch die Theorie der „Sphären“
- Die Urszene der Sprachentstehung
- Das Ohr als „,erster Lehrmeister der Sprache"
- Der Ursprung der Sprache nach Rousseau
- Schluss
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sprachursprungstheorie im 18. Jahrhundert, insbesondere mit den Werken von Jean-Jacques Rousseau und Johann Gottfried Herder. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Theorien der beiden Denker und setzt sie in Beziehung zu den zeitgenössischen Debatten über den Ursprung der Sprache. Dabei werden die zentralen Argumente und die philosophischen Grundlagen der jeweiligen Theorien beleuchtet.
- Die Rolle der Affekte und der Natur im Sprachursprung
- Die Kritik an der sensualistischen Sprachursprungstheorie Condillacs
- Die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der Gesellschaft und des Menschen
- Die Verbindung von Sprache und Denken
- Die Rolle der Kultur und der Geschichte im Sprachursprung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den historischen Kontext der Sprachursprungstheorie im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Erklärung des Sprachursprungs, insbesondere die göttliche Schöpfungstheorie und die sensualistische Hypothese.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich Rousseaus Sprachursprungstheorie. Er analysiert die beiden Werke „Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes“ und „Essai sur l'origine des langues“ und untersucht die darin enthaltenen Theorien zum Sprachursprung. Dabei wird insbesondere auf die Kritik an Condillacs sensualistischer Hypothese und die Begründung des affektiven Sprachursprungs eingegangen.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit Herders Sprachursprungstheorie. Er analysiert Herders „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ und untersucht die darin enthaltenen Theorien zum Sprachursprung. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung der „Besonnenheit“ und die Rolle des „Ohrs“ als „erster Lehrmeister der Sprache“ eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sprachursprung, die Sprachursprungstheorie, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder, Condillac, Affekte, Natur, Gesellschaft, Kultur, Geschichte, Besonnenheit, Ohr, Sensualismus, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Essai sur l'origine des langues, Abhandlung über den Ursprung der Sprache.
- Quote paper
- Michael Brendel (Author), 2008, Sprachursprungstheorien im 18. Jahrhundert: Rousseau und Herder, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/126359