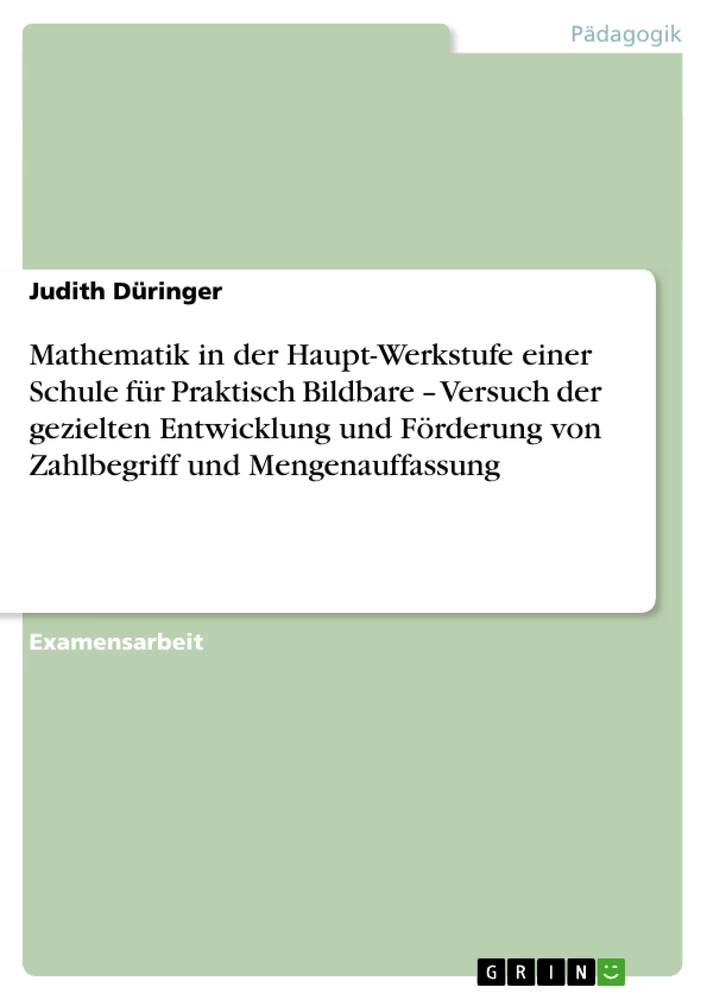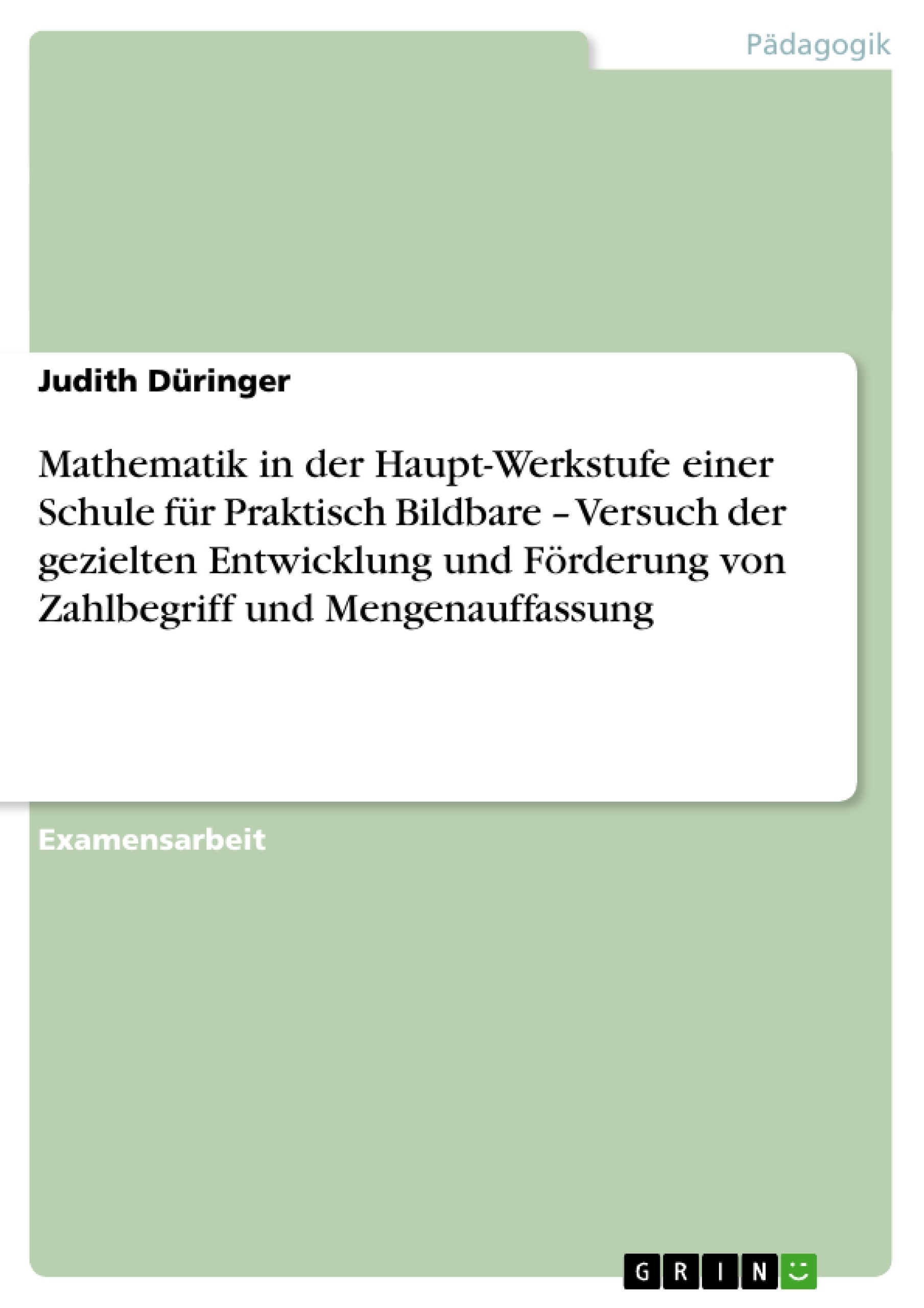Seit langem hat der Unterricht in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen an einer Schule für Praktisch Bildbare seinen festen Stellenwert.
Wurde vor einigen Jahrzehnten noch über die Sinnhaftigkeit des Unterrichts in den Kulturtechniken an einer Schule für Menschen mit einer geistigen Behinderung diskutiert, so hat sich in den vergangenen Jahren doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass mathematische Kompetenzen erarbeitet werden können und damit Voraussetzungen für eine bessere Bewältigung des Alltags geschaffen werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nicht erst bei der Bewältigung von schwierigen mathematischen Rechenoperationen von mathematischer Kompetenz gesprochen werden darf, sondern die Mathematik nach Piaget bereits im pränumerischen Bereich beginnt. Pränumerische Kenntnisse und Fähigkeiten, wie z.B. das Beherrschen der Stück-für-Stück Zuordnung bei der Verteilung von Bonbons, ermöglichen einem/einer SchülerIn seine/ihre Handlungskompetenzen in eigene Interessen zu integrieren und motiviert weiter zu entwickeln.
Im Schulalltag kommt dem angewandten Umgang mit Mengen und Zahlen deshalb große Bedeutung zu. Eine unterrichtsimmanente Diagnostik und Förderung findet z.B. beim Tischdecken (jedem Teller eine Tasse zuordnen), Einkaufen (bestimmte Mengen von Artikeln auswählen, Umgang mit Geld) oder beim Kochen (Zutaten abzählen) statt.
Im praktischen Unterrichtsalltag an einer Schule für Praktisch Bildbare wird aber auch immer wieder deutlich, dass viele SchülerInnen zwar sehr weit zählen können, ihnen der Aufbau der Zahlwortreihe und die Beziehung zwischen Zahlen und Mengen aber weitgehend verborgen bleibt.
Zur Erleichterung von Alltagshandlungen sind mathematische Kenntnisse und Fähigkeiten – vorrangig ein gesicherter Zahlbegriff – aber unabdingbar, da zahlreiche Alltagshandlungen mathematische Aspekte beinhalten. Eine konkrete Förderung wirkt sich somit positiv auf die Erweiterung und Verbesserung von Alltagskompetenzen aus. In den letzten Wochen und Monaten habe ich deshalb in einer Differenzierungsgruppe eine gezielte Förderung im elementaren mathematischen Lernen mit dem Ziel bzw. der Fragestellung durchgeführt, ob bei SchülerInnen mit einer Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung durch eine systematische Förderung nach dem Konzept des struktur- und niveauorientierten Lernens nach Kutzer der Zahlbegriff inhaltlich vermittelt und gefestigt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Vom pränumerischen Bereich zum Zahlbegriffserwerb
- Das „Haus der Mathematik“
- Sachstruktur des pränumerischen Bereichs und der Aspekte Klassifikation und Seriation
- Aspekte des Zahlbegriffs
- Motive für die Auswahl des Diagnose- und Förderkonzepts und Bezug zum Lehrplan
- Praxisteil – eine Förderung im elementaren mathematischen Lernen
- Vorüberlegungen und Rahmenbedingungen
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Beschreibung der Differenzierungsgruppe
- Zur Auswahl der Schülerinnen
- Diagnostik
- Diagnostisches Verfahren zur Ermittlung der Lernvoraussetzungen der Schülerinnen
- Beschreibung der Lernvoraussetzungen von Laura und Kübra
- Förderung
- Förderschwerpunkte bei Laura und Kübra
- Ein Einblick in die Förderung – Beschreibung von Förderbeispielen
- Exemplarische Darstellung einer Förderstunde
- Ergebnisse der Förderung
- Reflexion und Ausblick
- Zusammenfassende Beurteilung der Förderung – Reflexion
- Konsequenzen für die weitere förderdiagnostische Arbeit - Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gezielte Förderung des Zahlbegriffs und der Mengenauffassung bei Schülerinnen der Haupt-Werkstufe einer Schule für Praktisch Bildbare. Die Hauptfragestellung lautet, ob durch systematische Förderung nach dem Konzept des struktur- und niveauorientierten Lernens nach Kutzer der Zahlbegriff vermittelt und gefestigt werden kann. Die Arbeit analysiert den Prozess der Förderung, dokumentiert die Ergebnisse und reflektiert die Methodik.
- Entwicklung und Förderung des Zahlbegriffs bei Schülerinnen mit geistiger Behinderung
- Anwendung des struktur- und niveauorientierten Lernens nach Kutzer
- Diagnostik der Lernvoraussetzungen im Bereich Mathematik
- Analyse und Dokumentation der Fördermaßnahmen
- Reflexion der Fördermaßnahmen und Ausblick auf zukünftige Vorgehensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Mathematikunterrichts an Schulen für Praktisch Bildbare und betont die Notwendigkeit mathematischer Kompetenzen für die Bewältigung des Alltags. Sie beschreibt das Problem, dass viele SchülerInnen zwar die Zahlwortreihe aufsagen können, aber kein tiefes Verständnis des Zahlbegriffs besitzen. Die Arbeit untersucht daher, ob durch eine systematische Förderung der Zahlbegriff bei Schülerinnen mit geistiger Behinderung gefestigt werden kann. Die Methodik und die Struktur der Arbeit werden skizziert.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, beginnend mit dem pränumerischen Bereich und dem Weg zum Zahlbegriffserwerb. Es erläutert das „Haus der Mathematik“ als Modell und beschreibt die Aspekte der Klassifikation und Seriation im pränumerischen Bereich. Schließlich werden die wesentlichen Aspekte eines sicheren Zahlbegriffs definiert, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage für die Diagnostik und Förderung dienen.
Motive für die Auswahl des Diagnose- und Förderkonzepts und Bezug zum Lehrplan: Dieses Kapitel begründet die Wahl des struktur- und niveauorientierten Lernens nach Kutzer als Förderkonzept. Es werden die Gründe für die Auswahl der verwendeten Diagnose- und Fördermaterialien erläutert und die didaktische Begründung im Kontext des Lehrplans gegeben. Die Auswahl des Konzepts wird durch eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Anforderungen und dem pädagogischen Ansatz des Konzepts gerechtfertigt.
Vorüberlegungen und Rahmenbedingungen: Hier werden die institutionellen Rahmenbedingungen und die Zusammensetzung der Differenzierungsgruppe beschrieben. Der Auswahlprozess der beteiligten Schülerinnen wird detailliert dargestellt, um die Kontexte und die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu verdeutlichen. Die beschriebenen Rahmenbedingungen ermöglichen ein tieferes Verständnis der Studie und ihres Kontextes.
Diagnostik: In diesem Kapitel wird das diagnostische Verfahren zur Ermittlung der Lernvoraussetzungen der Schülerinnen vorgestellt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Lernvoraussetzungen der ausgewählten Schülerinnen Laura und Kübra zu Beginn der Fördersequenz. Diese Beschreibung dient als Grundlage für die Planung und Durchführung der individuellen Förderung.
Förderung: Dieses Kapitel präsentiert die Förderschwerpunkte von Laura und Kübra und beschreibt exemplarisch einige Förderbeispiele. Eine detaillierte Darstellung einer Förderstunde verdeutlicht die angewandte Methodik und zeigt die praktischen Umsetzung des gewählten Förderkonzeptes. Die Beschreibung der Förderbeispiele ermöglicht ein besseres Verständnis der individuellen Förderung.
Schlüsselwörter
Zahlbegriff, Mengenauffassung, geistige Behinderung, Förderung, Diagnostik, struktur- und niveauorientiertes Lernen, mathematische Kompetenz, inklusive Bildung, elementarmathematisches Lernen, Alltagskompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Förderung des Zahlbegriffs bei Schülerinnen mit geistiger Behinderung
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gezielte Förderung des Zahlbegriffs und der Mengenauffassung bei Schülerinnen mit geistiger Behinderung in der Haupt-Werkstufe einer Schule für Praktisch Bildbare. Die zentrale Frage ist, ob durch systematische Förderung nach dem Konzept des struktur- und niveauorientierten Lernens nach Kutzer der Zahlbegriff vermittelt und gefestigt werden kann.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet ein struktur- und niveauorientiertes Lernkonzept nach Kutzer. Es beinhaltet eine Diagnostik der Lernvoraussetzungen, die Planung und Durchführung individueller Fördermaßnahmen, die Dokumentation der Ergebnisse und eine abschließende Reflexion der Methodik.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die theoretischen Grundlagen des Zahlbegriffserwerbs, die Auswahl und Begründung des Förderkonzepts, die Durchführung der Diagnostik bei den ausgewählten Schülerinnen (Laura und Kübra), die detaillierte Beschreibung der Fördermaßnahmen, die Darstellung der Ergebnisse und eine kritische Reflexion des gesamten Prozesses.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Theoretische Grundlagen (inkl. pränumerischer Bereich, Zahlbegriff, "Haus der Mathematik"), Begründung des Förderkonzepts und Bezug zum Lehrplan, Beschreibung der Rahmenbedingungen und des Auswahlprozesses der Schülerinnen, Diagnostik der Lernvoraussetzungen, Beschreibung der Fördermaßnahmen (inkl. exemplarischer Förderstunde), Ergebnisse der Förderung und Reflexion/Ausblick.
Welche konkreten Fördermaßnahmen wurden durchgeführt?
Die Arbeit beschreibt exemplarisch einige Förderbeispiele und detailliert eine Förderstunde, um die praktische Umsetzung des gewählten Förderkonzepts zu verdeutlichen. Die konkreten Maßnahmen richten sich nach den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen Laura und Kübra, die zuvor diagnostiziert wurden.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit dokumentiert die Ergebnisse der Förderung bei Laura und Kübra. Eine zusammenfassende Beurteilung und Reflexion dieser Ergebnisse findet im Kapitel "Reflexion und Ausblick" statt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den durchgeführten Fördermaßnahmen und gibt einen Ausblick auf zukünftige förderdiagnostische Vorgehensweisen. Es wird reflektiert, inwieweit der Zahlbegriff durch die angewandte Methode gefestigt werden konnte und welche Konsequenzen sich für die weitere Arbeit ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zahlbegriff, Mengenauffassung, geistige Behinderung, Förderung, Diagnostik, struktur- und niveauorientiertes Lernen, mathematische Kompetenz, inklusive Bildung, elementarmathematisches Lernen, Alltagskompetenz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte, Förderlehrer, Lehramtsstudierende und alle, die sich mit der Förderung mathematischer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung beschäftigen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
(Hier könnte ein Link zum vollständigen Text eingefügt werden)
- Arbeit zitieren
- Judith Düringer (Autor:in), 2008, Mathematik in der Haupt-Werkstufe einer Schule für Praktisch Bildbare – Versuch der gezielten Entwicklung und Förderung von Zahlbegriff und Mengenauffassung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/126113