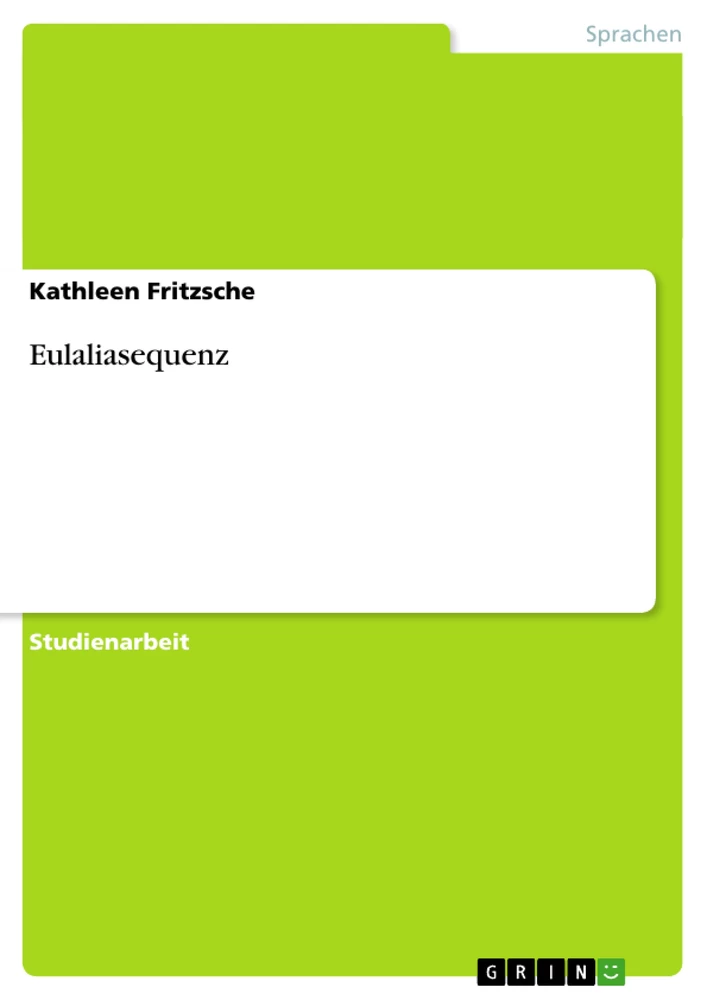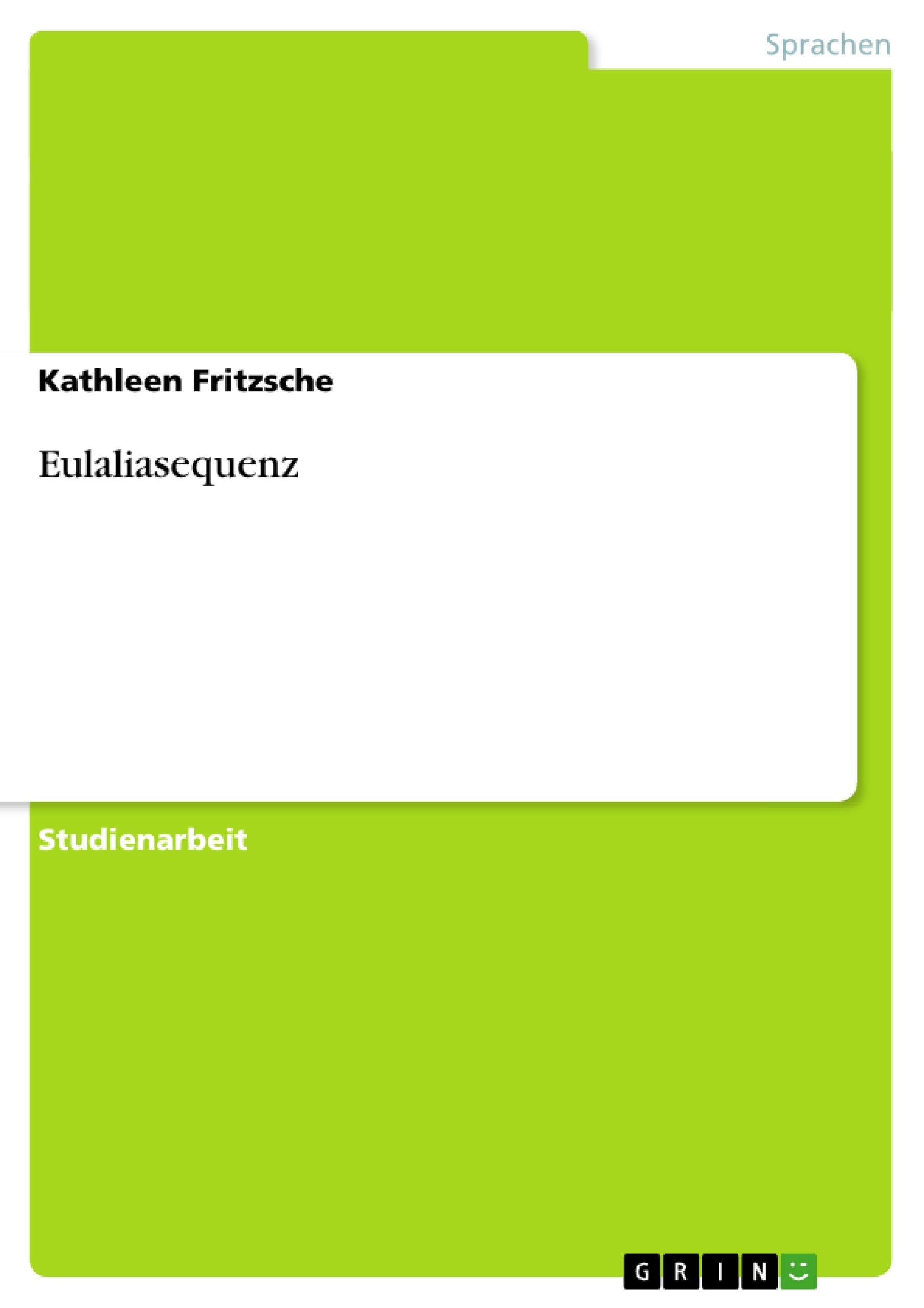Als die Römer im 1. Jahrhundert v.Chr. Gallien eroberten, um die Bewohner zu unterwerfen und zu assimilieren, konnte niemand ahnen, welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung des Lateinischen auf dem heutigen Gebiet Frankreichs haben würde. Nach
über Jahrhunderte andauernden Sprachkontakt mit den keltischsprachigen Galliern entwickelte sich in den unteren Bevölkerungsschichten eine Form des Vulgärlateins, so wie dies u.a. auch in Italien und Spanien der Fall war. Aus der galloromanischen Form des Vulgärlateins entstand nach und nach das Altfranzösische, welches anfangs als lingua rustica romana bezeichnet wurde. Durch das Konzil von Tours im Jahre 813 wurde
erstmals anerkannt, dass sich das Lateinische in Gallien anders entwickelte hatte, als das Lateinische in Rom. Das Konzil forderte die Kirchenvertreter auf, ihre Predigten nicht mehr im klassischen Latein sondern in der Sprache des Volkes zu halten, um die Predigten für jeden verständlich zu machen.
Der Text der Straßburger Eide aus dem Jahre 842 ist das erste überlieferte Dokument, welches eindeutig altfranzösische Sprachmerkmale der langue d’oïl aufweist. Die Eulaliasequenz folgte dann ca. 880 als erster erhaltener literarischer Text in
altfranzösischer Sprache, basierend auf einer lateinischen Vorlage. Anders als die Straßburger Eide gibt die Eulaliasequenz schon recht gut Auskunft über die Lautverhältnisse des Altfranzösischen zu jener Zeit. Der schon im 2. Jahrhundert n.Chr.
abgeschlossene Quantitätenkollaps der lateinischen Vokale, d.h. die Längen der Vokale hatten im Altfranzösischen keine bedeutungsunterscheidende Funktion mehr, hatte als Grundlage für die Diphthongierungen der Vokale im Altfranzösischen gedient, welche in der Eulaliasequenz erstmals orthographisch umgesetzt wurden.
Die vorliegende Hausarbeit betrachtet die Eulaliasequenz auf
sprachwissenschaftlicher Ebene näher. Im Folgenden werden zunächst der altfranzösische Originaltext und dessen deutsche Übersetzung dargestellt. Zudem wird auf den historischen Hintergrund und auf die Sequenz als literarische Form im Mittelalter eingegangen. Weiterhin wird eine ausführliche sprachwissenschaftliche Studie vorgenommen, um die Bereiche Phonetik und Phonologie, Morphosyntax, Lexik, das Problem des Verses 15 und die Orthographie in der Eulaliasequenz genauer zu
untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Text der Eulaliasequenz
2.1 Altfranzösischer Originaltext
2.2 Deutsche Übersetzung
3. Historischer Hintergrund
4. Die Sequenz als literarische Form im Mittelalter
5. Sprachwissenschaftliche Studie der Eulaliasequenz
5.1 Phonetik und Phonologie
5.2. Morphosyntax
5.2.1 Wortstellung
5.2.2 Nomen
5.2.3 Verben
5.2.4 Enklitika
5.2.5 Negation
5.2.6 Adjektive
5.3 Lexik
5.4 Das Problem des Verses 15 „Ellent adunet lo suon element“
5.5 Orthographie
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
8. Anhang
8.1 Manuskript des Originaltexts der altfranzösischen Version der Eulaliasequenz
8.2 Lateinische Version der Eulaliasequenz
1. Einleitung
Als die Römer im 1. Jahrhundert v.Chr. Gallien eroberten, um die Bewohner zu unterwerfen und zu assimilieren, konnte niemand ahnen, welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung des Lateinischen auf dem heutigen Gebiet Frankreichs haben würde. Nach über Jahrhunderte andauernden Sprachkontakt mit den keltischsprachigen Galliern entwickelte sich in den unteren Bevölkerungsschichten eine Form des Vulgärlateins1, so wie dies u.a. auch in Italien und Spanien der Fall war. Aus der galloromanischen Form des Vulgärlateins entstand nach und nach das Altfranzösische, welches anfangs als lingua rustica romana bezeichnet wurde. Durch das Konzil von Tours im Jahre 813 wurde erstmals anerkannt, dass sich das Lateinische in Gallien anders entwickelte hatte, als das Lateinische in Rom (Yaguello 2003, S. 23). Das Konzil forderte die Kirchenvertreter auf, ihre Predigten nicht mehr im klassischen Latein sondern in der Sprache des Volkes zu halten, um die Predigten für jeden verständlich zu machen2.
Der Text der Straßburger Eide3 aus dem Jahre 842 ist das erste überlieferte Dokument, welches eindeutig altfranzösische Sprachmerkmale der langue d’oïl aufweist. Die Eulaliasequenz4 folgte dann ca. 880 als erster erhaltener literarischer Text in altfranzösischer Sprache5, basierend auf einer lateinischen Vorlage6. Anders als die Straßburger Eide gibt die Eulaliasequenz schon recht gut Auskunft über die Lautverhältnisse des Altfranzösischen zu jener Zeit. Der schon im 2. Jahrhundert n.Chr. abgeschlossene Quantitätenkollaps der lateinischen Vokale, d.h. die Längen der Vokale hatten im Altfranzösischen keine bedeutungsunterscheidende Funktion mehr, hatte als Grundlage für die Diphthongierungen der Vokale im Altfranzösischen gedient, welche in der Eulaliasequenz erstmals orthographisch umgesetzt wurden (Rickard 1977, S. 38).
Die vorliegende Hausarbeit betrachtet die Eulaliasequenz auf sprachwissenschaftlicher Ebene näher. Im Folgenden werden zunächst der altfranzösische Originaltext und dessen deutsche Übersetzung dargestellt. Zudem wird auf den historischen Hintergrund und auf die Sequenz als literarische Form im Mittelalter eingegangen. Weiterhin wird eine ausführliche sprachwissenschaftliche Studie vorgenommen, um die Bereiche Phonetik und Phonologie, Morphosyntax, Lexik, das Problem des Verses 15 und die Orthographie in der Eulaliasequenz genauer zu untersuchen.
2. Text der Eulaliasequenz
2.1 Altfranzösischer Originaltext
7 Buona pulcella fut Eulalia,
Bel auret corps, bellezour anima
Voldrent la veintre li Deo inimi,
Voldrent la faire dïaule servir
Elle nont eskoltet les mals conseillers
Qu’elle Deo raneiet, chi maent sus en ciel
Ne por or ned argent ne paramenz,
Por manatce regiel ne preiement,
Nïule cose non la pouret omque pleier
La polle sempre non amast lo Deo menestier
E poro fut presentede Maximiien
Chi rex eret a cels dis soure pagiens
Il li enortet, dont lei nonque chielt,
Qued elle fuiet lo nom christiien
Ellent adunet8 lo suon element :
Melz sostendreiet les empedementz
Qu’elle perdesse sa virginitet ;
Por os furet morte a grand honestet
Enz enl fou lo getterent com arde tost:
Elle colpes non auret, poro nos coist
A czo nos voldret concreidre li rex pagiens ;
Ad une spede li roveret tolir lo chief
La domnizelle celle kose non contredist :
Volt lo seule lazsier, si ruovet Krist
In figure de colomb volat a ciel
Tuit oram que por nos degnet preier
Qued auuisset de nos Christus mercit
Post la mort et a Lui nos laist venir
Par souue clementia
2.2 Deutsche Übersetzung
9
Ein gutes junges Mädchen war Eulalia,
sie hatte einen schönen Körper, eine noch schönere Seele
Die Feinde Gottes wollten sie besiegen,
sie wollten sie dazu bringen, dem Teufel zu dienen
Sie hört nicht auf die schlechten Ratgeber,
dass sie Gott verleugnen solle, der oben im Himmel weilt,
weder Gold, noch Silber, noch Schmuck,
noch königliche Drohung, noch Bitten,
Keine Sache konnte sie jemals davon abbringen,
dass das Mädchen den Dienst für Gott nicht immerfort liebte
Und deswegen wurde sie Maximian vorgeführt,
der in jenen Tagen König der Heiden war
Er ermahnt sie, was sie nicht kümmert,
dass sie die Christen und ihre Religion verlassen soll
Sie erwidert, indem sie das Element, welches das ihre ist, bekräftigt,
lieber würde sie die Folter aushalten,
als dass sie ihre (spirituelle) Unschuld verliere,
deswegen gab sie ihr Leben zu großer Ehre hin
Hinein ins Feuer warfen sie sie, damit sie rasch verbrenne,
sie hatte keine Sünden, daher brannte sie nicht
Damit wollte der heidnische König sich nicht zufrieden geben;
er befahl, dass man ihr mit einem Schwert das Haupt abschlage
Das junge Mädchen widersprach dieser Sache nicht:
Sie wollte die Welt verlassen, und betet zu Christus,
in Gestalt einer Taube flog sie zum Himmel
Lasset uns alle beten, dass sie für uns bitten möge,
dass Christus Gnade mit uns haben möge
nach dem Tode und uns zu ihm kommen lasse
durch seine Milde
3. Historischer Hintergrund
Der Kult der Heiligen Eulalia wurde in Frankreich wiederbelebt, nachdem 878 angeblich die Gebeine der Heiligen in Barcelona entdeckt wurden (Ayres-Bennett 1996, S. 32). Die Sequenz schildert den Märtyrertod der Heiligen Eulalia in Spanien im 3. oder 4. Jahrhundert n.Chr.10 und gibt eine Lobeshymne auf die Heilige in einem liturgischen Rahmen wieder. Es ist ein klerikaler Text, der in einer Handschrift der Bibliothek von Valenciennes (Frankreich) überliefert ist, wohin sie 1791 aus der Bibliothek des Benediktinerklosters von Saint-Amand-les-Eaux (Frankreich) gelangte und da 1837 von Hoffmann von Fallersleben entdeckt wurde (Voretzsch 1925, S. 47). Durch das deutsche Gedicht, welches direkt im Anschluss an die Eulaliasequenz nieder geschrieben wurde und die Schlacht von Saucourt zum Thema hat, kann man das Jahr der Niederschrift der Sequenz auf um 880 bestimmen (Ayres-Bennett 1996, S. 32)11. Die Eulaliasequenz folgt in der Handschrift von Valenciennes auf eine lateinische Version12 desselben Themas, welche aber für die Kirchenvertreter der damaligen Zeit bestimmt war, wohingegen die französische Fassung für das einfache Volk gedacht war13. Inhaltlich stimmen beide Sequenzen aber nicht genau überein:
[…] die lateinische Sequenz ist eine lyrische Expektoration: der Sänger fordert den Musiker auf, ihn zu begleiten, um alle zu rühren über das Geschick der unschuldigen jungfräulichen Dulderin, deren Schutz erfleht wird; die französische hingegen ist panegyrische Erzählung (nach Prudentius und Baeda) mit Schlußgebet. (Becker 1907, S. 6).
Der Inhalt der französischen Sequenz ist nicht nur informativ, sondern auch zur religiösen Reflexion gedacht. Durch ihre größere syntaktische Varietät und Sorgfalt im Ausdruck besitzt sie sowohl sprachliche als auch literarische Bedeutung. Die Orthographie gibt im Allgemeinen guten Aufschluss über die lautlichen Verhältnisse der altfranzösischen Sprache am Ende des 9. Jahrhunderts. Im Vergleich zu den Straßburger Eiden wurde die durch die karolingische Renaissance ausgelöste neue Schreibform der Volkssprache schon viel stärker beachtet (Geckeler; Dietrich 2003, S. 189).
[...]
1 Lat. lingua vulgaris
2 Originaltext von dem Konzil, zitiert nach Yaguello 2003, S. 23: „Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere, quae dicuntur.”
3 Frz. Serments de Strasbourg
4 Frz. Séquence de Sainte Eulalie
5 Die Bezeichnung „altfranzösische Sprache“ ist hierbei problematisch, da es zu jener Zeit noch keine einheitliche altfranzösische Sprache gab. Gemeint ist hier der Dialekt des Franzischen, welcher vorwiegend im Gebiet der Ile-de-France gesprochen wurde und später als Grundlage für die Entwicklung der französischen Standard- und Literatursprache diente (cf. auch Hilty 1968). Cf. Kesselring 1973, S. 196: „Die ganze überlieferte altfranzösische Literatur ist Dialektliteratur. “Altfranzösisch“ selbst ist eine Abstraktion; es gab nur altfranzösische Dialekte. Die Entstehung der französischen Schrift-, Gemein- und Nationalsprache gehört höchstens der letzten altfranzösischen Epoche an. Verwaltungs- und Kirchensprache blieb bis ins 16. Jh. das Lateinische; das Romanische wurde nur für volkstümliche Zwecke verwendet.“ Zur Bedeutung der Dialekte in der Eulaliasequenz siehe Kapitel 5.3 der vorliegenden Hausarbeit.
6 Kesselring 1973, S. 191: „Um 880 die Eulaliasequenz […] Bearbeitung einer mittellateinischen Vorlage, dem CANTICUM EULALIAE des Prudentius, zu Ehren der spanischen Heiligen Eulalia aus Mérida (gest. 304) […].“
7 Text nach Berger; Brasseur 2004, S. 63
8 Auch: aduret. Cf. dazu Kapitel 5.4
9 Übersetzung nach Hesse und Berger; Brasseur 2004, S. 62
10 Voretzsch 1925, S. 47: „Ein selbst aus Spanien gebürtiger christlicher dichter des 4. jahrhunderts, Prudentius, hatte einen lateinischen hymnus auf die heilige von Mérida gedichtet. Auch sonst erscheint sie häufig in der lateinischen literatur, zumal in den martyrologien.“
11 Ayres-Bennett 1996, S. 32: „In the manuscript, which is closely contemporary to the date of composition, the French poem is placed between a Latin sequence on the same theme and a German poem that celebrates the battle of Saucourt which took place on 3 August 881 and speaks of the victor (Louis III, †882) as still being alive, thereby narrowing down with some precision the chronology.”
12 Cf. Anhang 8.2
13 Bruneau 1969, S. 64: „Un texte latin, nettement différent du texte français, était destiné aux clercs ; la séquence en langue rustique, sur le même air, était chantée par le peuple, qui pouvait la comprendre.“
- Arbeit zitieren
- M.A. Kathleen Fritzsche (Autor:in), 2007, Eulaliasequenz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/125930