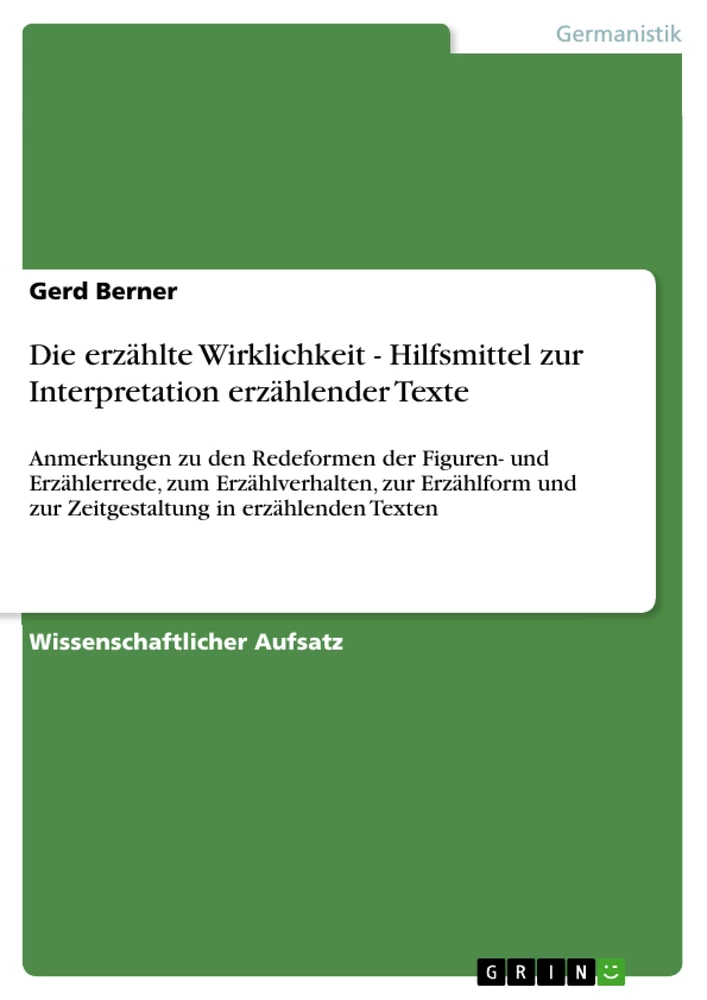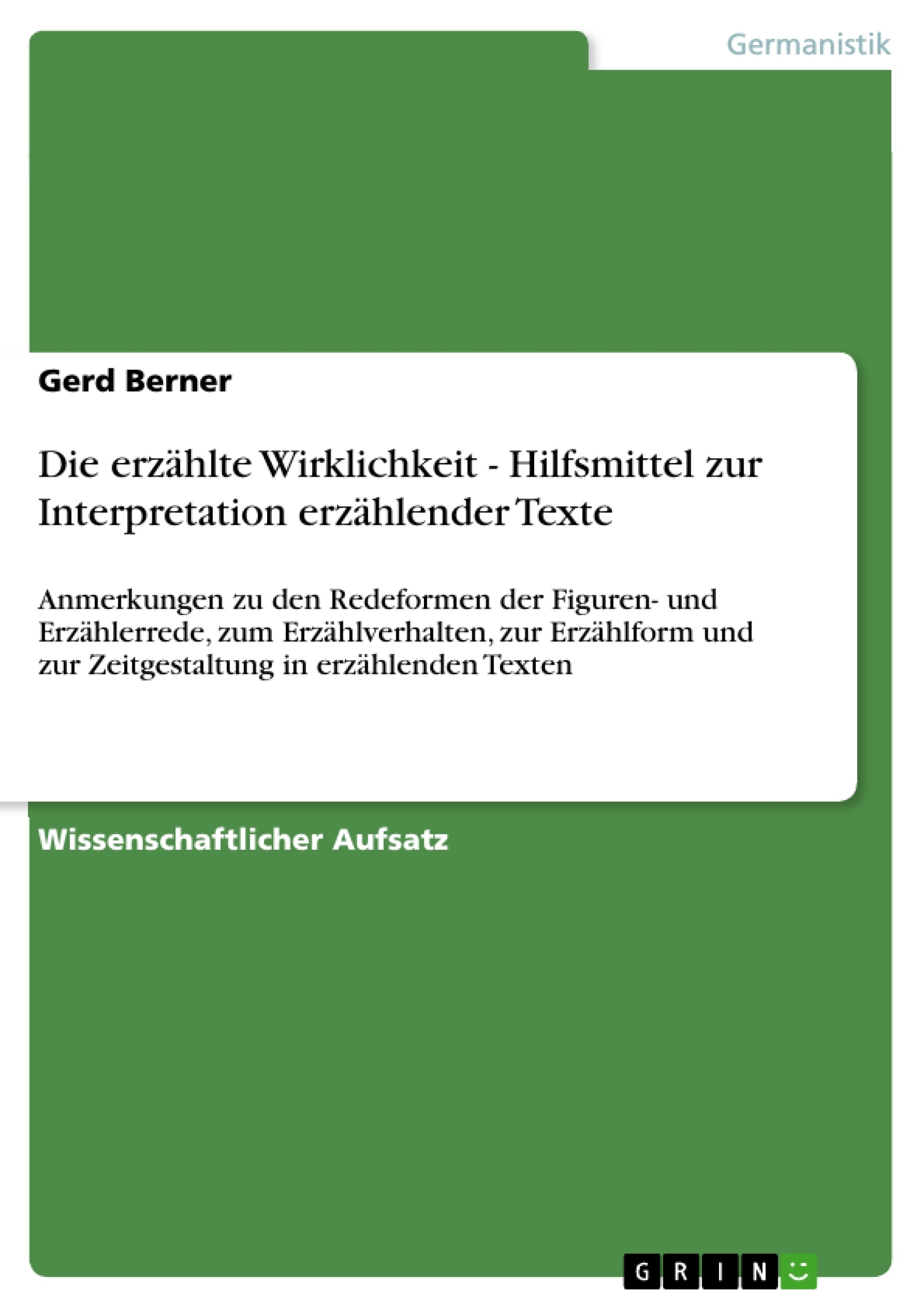Da die erzählte Wirklichkeit eines Erzähltextes im Wesentlichen aus einem erzählten Geschehen besteht, bei dem erzählte und erzählende Figuren an einem erzählten Ort zu einer erzählten Zeit als Handelnde beteiligt sind, habe ich in meinem Unterricht in der gymnasialen Oberstufe von den möglichen "Aspekten erzählender Prosa" (J. Vogt) die folgenden für eine Interpretation der fiktiven Welt wichtigen Bauelemente besonders beachtet: die Erzähler- und Figurenrede, die vier Möglichkeiten der stummen Rede, nämlich die erlebte Rede, den inneren Monolog, die psycho-narration und den Bewusstseinsstrom. Ich habe das auktoriale, personale und neutrale Erzählverhalten in der Ich- und der Er-Form erklärt und mit Textauszügen verdeutlicht. Bei der erzählten Zeit habe ich die Möglichkeiten der Zeitdarstellung bei linearem und nicht-linearem Zeitablauf dargestellt, also zeitdeckendes, zeitraffendes und zeitdehnendes Erzählen sowie Rückwendung und Vorausdeutung. Meine Abhandlung erklärt alle diese für die Analyse eines Erzähltextes wichtigen Fachbegriffe und belegt sie mit einsichtigen Auszügen aus epischen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts. Als Hilfsmittel für den täglichen Umgang mit zu analysierenden erzählerischen Texten habe ich drei Graphiken angefertigt und an das ausführliche Literaturverzeichnis angehängt,diese bieten dem Interpreten einen schnellen Überblick und informieren ihn in der Art eines visuellen Glossars über die für die Deutung eines epischen Textes unerlässliche Begrifflichkeit und deren Interdependenz. Meine Ausführungen stützen sich dabei auf die von Jochen Vogt und Jürgen H. Petersen vorgelegten narratologischen Standardwerke.
Inhaltsverzeichnis
- Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zur Figuren- und Erzählerrede
- Erzählerrede (Erzählerbericht)
- Figurenrede: gesprochene Rede
- Figurenrede: die vier Möglichkeiten der stummen Rede
- Figurenrede: die stumme erlebte Rede
- Figurenrede: der stumme innere Monolog
- Figurenrede: die stumme psycho-narration
- Figurenrede: der stumme Bewusstseinsstrom
- Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zum auktorialen, personalen und neutralen Erzählverhalten in der Ich- und der Er-Erzählform
- Ich-Erzählform
- auktoriales Erzählverhalten
- personales Erzählverhalten
- neutrales Erzählverhalten
- Er-Erzählform
- auktoriales Erzählverhalten
- personales Erzählverhalten
- neutrales Erzählverhalten
- Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zur erzählten Zeit
- Zeiten in Storms Schimmelreiter
- Erzählzeit vs. erzählte Zeit
- linearer Ablauf der erzählten Zeit
- zeitdeckendes Erzählen
- zeitraffendes Erzählen
- zeitdehnendes Erzählen
- nicht-linearer Ablauf der erzählten Zeit
- Rückwendung
- Vorausdeutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser wissenschaftliche Aufsatz untersucht verschiedene Aspekte der erzählten Wirklichkeit in narrativen Texten. Das Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis der Redeformen (Figurenrede und Erzählerrede), des Erzählverhaltens (auktorial, personal, neutral), der Erzählform (Ich- und Er-Form) und der Zeitgestaltung zu ermöglichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Mechanismen, mit denen die fiktive Welt in literarischen Texten konstruiert und dem Leser vermittelt wird.
- Analyse von Figuren- und Erzählerrede
- Untersuchung verschiedener Erzählverhalten
- Erörterung der Erzählzeit und erzählten Zeit
- Behandlung linearer und nicht-linearer Zeitstrukturen
- Anwendung der Theorie auf ausgewählte literarische Beispiele
Zusammenfassung der Kapitel
Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zur Figuren- und Erzählerrede: Dieses Kapitel analysiert die grundlegenden Elemente der Figuren- und Erzählerrede in narrativen Texten. Es differenziert zwischen Erzählerbericht und Figurenrede, wobei verschiedene Formen der Figurenrede, wie direkte und indirekte Rede sowie die stumme Rede (erlebte Rede, innerer Monolog, psychonarration und Bewusstseinsstrom), detailliert untersucht und anhand von Beispielen aus der Literatur veranschaulicht werden. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung der verschiedenen Redeformen und ihrer Funktion innerhalb des narrativen Gefüges. Der Unterschied zwischen knappen Redeberichten und ausführlicherer Wiedergabe von Figurenrede wird ebenso beleuchtet, wie das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit in Bezug auf die direkte Rede.
Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zum auktorialen, personalen und neutralen Erzählverhalten in der Ich- und der Er-Erzählform: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erzählverhalten in Ich- und Er-Erzählungen und unterscheidet zwischen auktorialem, personalem und neutralem Erzählverhalten. Es werden die jeweiligen Charakteristika dieser Erzählweisen analysiert und anhand von Beispielen aus der Literatur veranschaulicht, wie diese Erzählweisen die Perspektive und den Zugang des Lesers zur erzählten Welt beeinflussen. Der Unterschied zwischen den Erzählweisen in Ich- und Er-Erzählungen wird hervorgehoben, wobei die Rolle des Erzählers und seine Positionierung in Bezug auf die Geschichte im Mittelpunkt stehen. Die Analyse zeigt auf, wie die Wahl des Erzählverhaltens die Interpretation des Textes maßgeblich prägt.
Die erzählte Wirklichkeit: Anmerkungen zur erzählten Zeit: In diesem Kapitel steht die Zeitgestaltung in narrativen Texten im Zentrum. Es wird die Unterscheidung zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit erläutert und die verschiedenen Techniken des Zeitraffens, Zeitdehnens und zeitdeckenden Erzählens analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung linearer und nicht-linearer Zeitabläufe, inklusive der Funktionen von Rückwendungen und Vorausdeutungen. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie die Manipulation der Zeit die Wirkung und Interpretation des Textes beeinflusst, und wie diese Techniken die Spannung und die Struktur eines Erzähltextes formen. Die Analyse verdeutlicht den Einfluss der Zeitgestaltung auf das Verständnis der narrativen Handlung.
Schlüsselwörter
Erzählte Wirklichkeit, Figurenrede, Erzählerrede, Erzählverhalten, Erzählform, Ich-Erzählform, Er-Erzählform, auktorial, personal, neutral, Erzählzeit, erzählte Zeit, Zeitgestaltung, zeitdeckendes Erzählen, zeitraffendes Erzählen, zeitdehnendes Erzählen, Rückwendung, Vorausdeutung, literarische Analyse, narrative Techniken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Erzählten Wirklichkeit
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert verschiedene Aspekte der erzählten Wirklichkeit in narrativen Texten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Redeformen (Figurenrede und Erzählerrede), des Erzählverhaltens (auktorial, personal, neutral), der Erzählform (Ich- und Er-Form) und der Zeitgestaltung in literarischen Werken.
Welche Aspekte der Figurenrede werden behandelt?
Die Analyse der Figurenrede umfasst direkte und indirekte Rede sowie verschiedene Formen der stummen Rede: erlebte Rede, innerer Monolog, psychonarration und Bewusstseinsstrom. Es wird untersucht, wie diese Formen die Vermittlung der fiktiven Welt beeinflussen und wie sie sich vom Erzählerbericht unterscheiden.
Welche Erzählverhalten werden unterschieden und wie werden sie analysiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen auktorialem, personalem und neutralem Erzählverhalten in sowohl Ich- als auch Er-Erzählungen. Die Analyse untersucht die jeweiligen Charakteristika, ihre Auswirkungen auf die Perspektive des Lesers und wie sie die Interpretation des Textes beeinflussen.
Wie wird die Erzählzeit behandelt?
Die Analyse der Erzählzeit umfasst die Unterscheidung zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit, sowie die Techniken des Zeitraffens, Zeitdehnens und zeitdeckenden Erzählens. Es wird untersucht, wie lineare und nicht-lineare Zeitabläufe (inkl. Rückwendungen und Vorausdeutungen) die Wirkung und Interpretation des Textes beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Das erste Kapitel analysiert Figuren- und Erzählerrede, das zweite Kapitel behandelt die verschiedenen Erzählverhalten in Ich- und Er-Erzählungen, und das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Zeitgestaltung in narrativen Texten.
Welche Schlüsselwörter sind für die Arbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Erzählte Wirklichkeit, Figurenrede, Erzählerrede, Erzählverhalten, Erzählform, Ich-Erzählform, Er-Erzählform, auktorial, personal, neutral, Erzählzeit, erzählte Zeit, Zeitgestaltung, zeitdeckendes Erzählen, zeitraffendes Erzählen, zeitdehnendes Erzählen, Rückwendung, Vorausdeutung, literarische Analyse, narrative Techniken.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Das Ziel ist ein tiefergehendes Verständnis der Mechanismen, mit denen die fiktive Welt in literarischen Texten konstruiert und dem Leser vermittelt wird. Die Analyse soll ein umfassendes Verständnis der verschiedenen narrativen Techniken ermöglichen.
Für wen ist diese Analyse relevant?
Diese Analyse ist relevant für Studierende der Literaturwissenschaft, Germanistik und vergleichbarer Fächer, die sich mit narrativen Texten und deren Analyse auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der vollständige Text enthält detaillierte Ausführungen zu den oben genannten Punkten, inklusive konkreter Beispiele aus der Literatur.
- Arbeit zitieren
- Gerd Berner (Autor:in), 2013, Die erzählte Wirklichkeit - Hilfsmittel zur Interpretation erzählender Texte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/125801