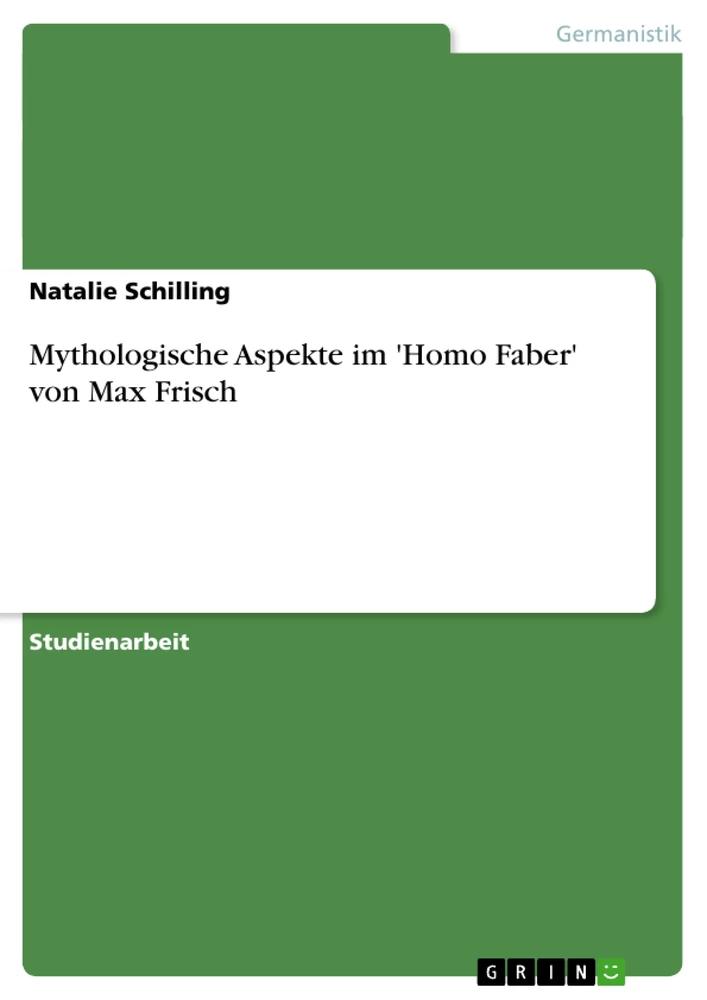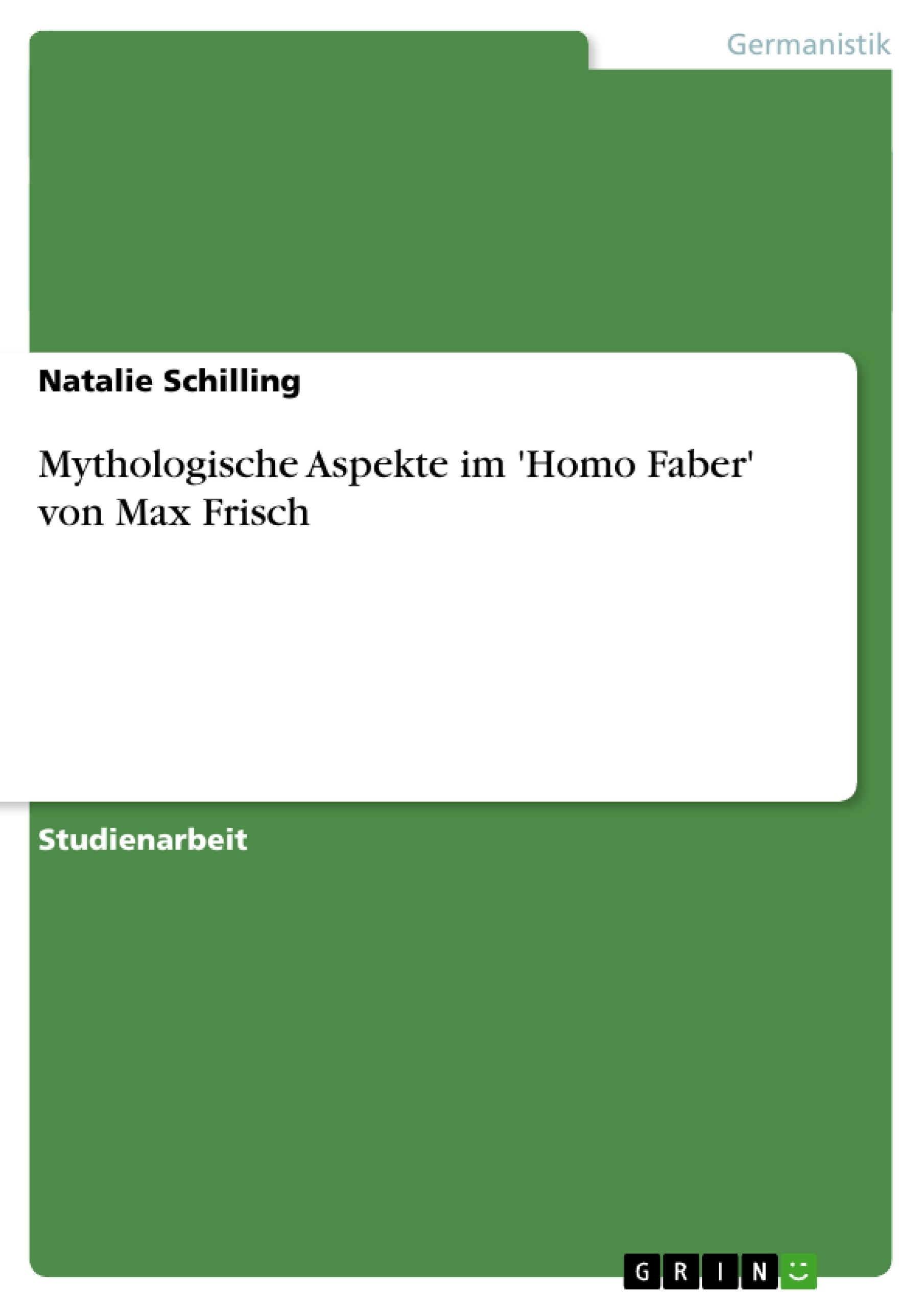Der Roman “Homo Faber” von Max Frisch aus dem Jahre 1957, als “Bericht” bezeichnet, repräsentiert in eben dieser Art und Weise die menschliche Existenz der materialistischen Wirtschaftswunderjahre. Es findet eine Auseinandersetzung mit der Moderne statt und der verschiedenen Aspekte, die diese beinhaltet, nämlich auf der einen Seite eine fortschreitende Industrialisierung und Technisierung des Lebens und auf der anderen Seite die Problematiken, die diese mit sich bringen wie die Stellung des Individuums und fehlende Wertvorstellungen, sowie das Verschwinden der Religion, die der Mensch des 19. Jahrhunderts mit Beginn der Technisierung abschafft. Der Mensch ist Herr über die Natur geworden und kann außer seinen eigenen Tod alles kontrollieren, wodurch Religionen außer Kraft gesetzt werden und gleichzeitig die Suche nach dem Sinn des Seins stärker hervortritt, als je zuvor. Gleichzeitig steht kontrastiv eine Orientierung in Richtung des Unbewussten statt.
Glauben und Zweifel an Technik und Zivilisation werden durch eine “duale Erzähltechnik” dargestellt, die diese verschiedenen Perspektiven vermittelt. Dem entspricht eine doppelte Erzählmotivation des Berichterstatters und Protagonisten, der auf der einen Seite versucht, sich und seiner damaligen Freundin Hanna die Unschuld am Tod ihrer Tochter Sabeth zu beteuern, auf der anderen Seite resümiert er sein Leben in einem Rückblick, mit der Gewissheit, bald sterben zu müssen.
Auf der Gegenseite zur Technik ist im Roman ein weitverzweigtes Netz aus mythologischen Anspielungen entworfen. Diese mal mehr, mal weniger deutlichen Metaphern sollen in dieser Arbeit untersucht werden und ihr Zusammenhang zum technischen Menschen und dem, was er in diesem Bericht zu erreichen sucht, hergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Technik
- Mythologie im „Homo Faber“
- Erinnyen
- Ödipus
- Agamemnon
- Verfremdung
- Schuld und Zufall
- Psychologische Aspekte
- Demeter-Kore-Mythos und Fabers Initiierung in die Eleusischen Mysterien
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mythologischen Anspielungen in Max Frischs Roman „Homo Faber“ und deren Zusammenhang mit der technisch geprägten Hauptfigur Walter Faber. Es wird analysiert, wie Fabers technisches Weltbild mit seinen emotionalen Defiziten und der Suche nach Sinn im Leben interagiert.
- Die Darstellung von Technik als Weltanschauung und deren Auswirkungen auf die menschliche Existenz.
- Die Verwendung mythologischer Metaphern zur Beleuchtung von Fabers innerem Konflikt und seiner Entwicklung.
- Die Auseinandersetzung mit Schuld, Zufall und dem menschlichen Versagen.
- Die Rolle des Unbewussten und die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit.
- Fabers allmählicher Wandel und seine Annäherung an ein umfassenderes Verständnis des Lebens.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman „Homo Faber“ und seine Thematik vor, fokussiert auf die Auseinandersetzung mit Moderne, Technik und dem Verlust religiöser Werte. Das Kapitel Technik charakterisiert die Hauptfigur Walter Faber als typischen Vertreter des technisch geprägten Menschen, der seine Emotionen verdrängt und sich in die Welt der Technik flüchtet. Die Kapitel über Mythologie im „Homo Faber“ (Erinnyen, Ödipus, Agamemnon) analysieren die mythologischen Bezüge im Roman und deren Bedeutung für die Handlung. Die Kapitel Verfremdung, Schuld und Zufall sowie Psychologische Aspekte untersuchen verschiedene Aspekte von Fabers Persönlichkeit und seinen Handlungsmotiven. Das Kapitel über den Demeter-Kore-Mythos behandelt den Einfluss des Mythos auf Fabers Entwicklung und seine Initiation.
Schlüsselwörter
Max Frisch, Homo Faber, Technik, Mythologie, Moderne, Existenzialismus, Schuld, Zufall, Identität, Verfremdung, Unbewusstes, Demeter-Kore-Mythos, Initiation.
- Quote paper
- Natalie Schilling (Author), 2008, Mythologische Aspekte im 'Homo Faber' von Max Frisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/124500