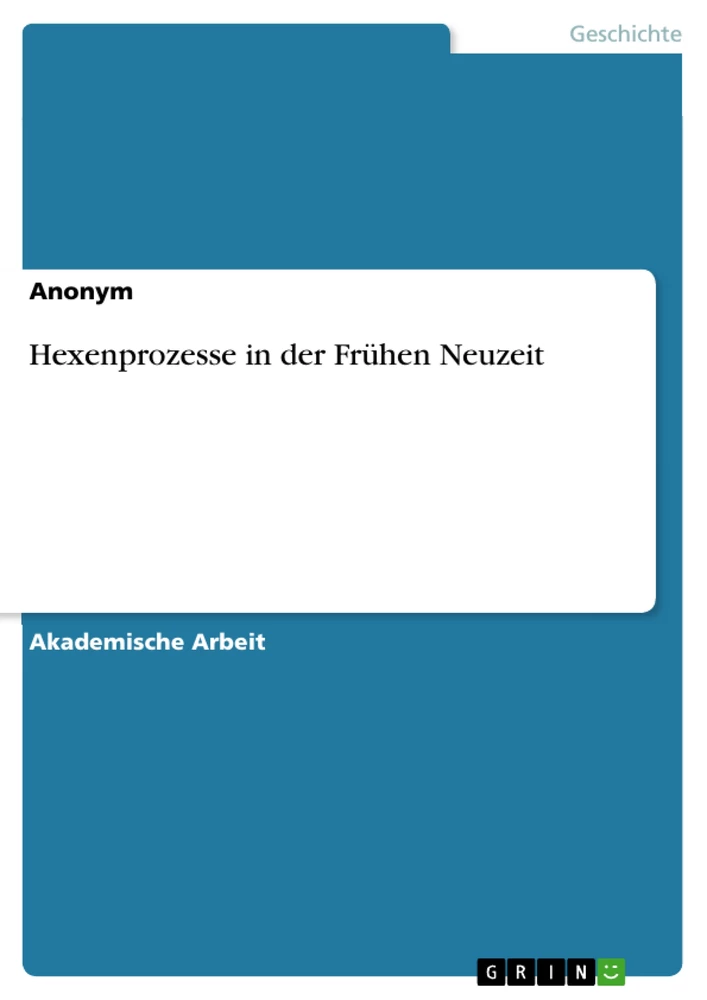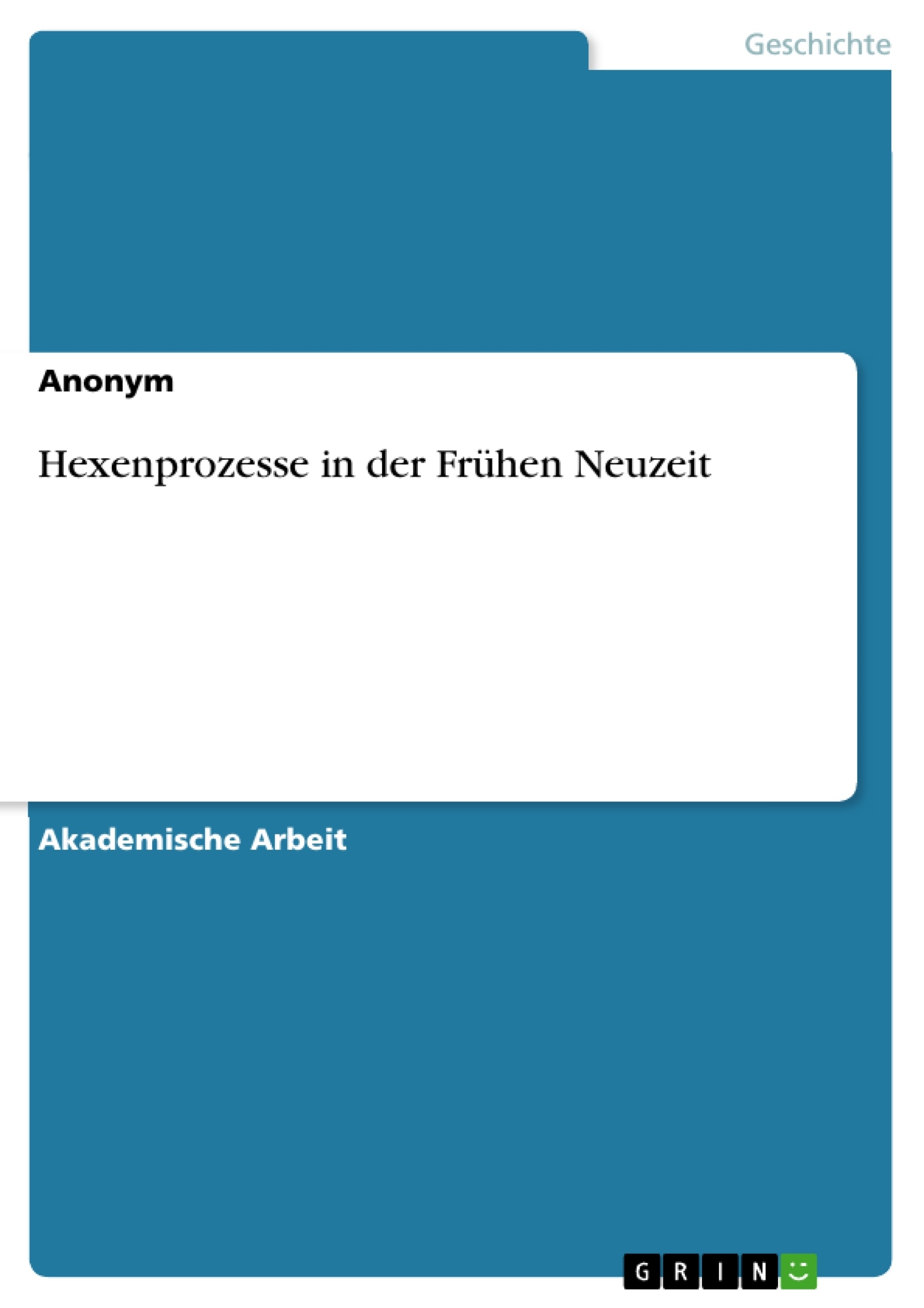Was bedeutete überhaupt Hexerei in der Frühen Neuzeit und welche Glaubensinhalte wurden damit verbunden? Dies ist nur eine der Fragen, die in dieser Arbeit beantwortet werden soll. Unter der These, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Hexerei in der Bevölkerung und in der Kirche gab und die Landbevölkerung durch ihre sozialen Beziehungen anfälliger für Hexereibeschuldigen waren, soll diese Arbeit geführt werden.
Dabei wird zunächst auf das Phänomen der Hexerei eingegangen und wie sich diese in der Frühen Neuzeit darstellte. Daraufhin wird auf die Frage eingegangen, was den Tatbestand der Hexerei ausmachte, welche Glaubensvorstellungen damit verbunden waren und wie sich die Vorstellung im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit wandelte. Um ein besseres Verständnis über den Hergang des Hexenprozesses zu gewinnen, wird zunächst die Zuständigkeit von weltlichen und geistlichen Gerichten erörtert. Darauf folgt eine knappe Erklärung des Inquisitionsprozesses, seinen Hergang um dann anhand der der Hexerei beschuldigten Bengina Schultzen aus dem mecklenburgischen Penzlin zu zeigen, wie ein Hexenprozess ablaufen konnte. B. Schultzen erfüllte außerdem alle Kriterien, die die Risikogruppe bei Hexenprozessen ausmachte. Auch kann der Fall der B. Schultzen exemplarisch dafür stehen, warum gerade die Landbevölkerung anfälliger für Hexerei beschuldigen war. Dabei wird auch auf die sozialen Strukturen innerhalb einer dörflichen Gemeinde eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Phänomen der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit
- Was ist Hexerei?
- Die Zuständigkeit von weltlichen und geistlichen Gerichten
- Der Inquisitionsprozess
- Die dörfliche Gemeinde
- Der Hexenprozess am Beispiel der Benigna Schultzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Vorstellungen von Hexerei in der Bevölkerung und in der Kirche und untersucht, warum die Landbevölkerung anfälliger für Hexereibeschuldigungen war.
- Definition von Hexerei in der frühen Neuzeit
- Rolle des Teufelspakts und der schwarzen Magie
- Zuständigkeit von weltlichen und geistlichen Gerichten im Hexenprozess
- Der Ablauf eines Hexenprozesses am Beispiel von Benigna Schultzen
- Soziale Strukturen und Hexenverfolgungen in der dörflichen Gemeinde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit vor und beleuchtet die historischen Hintergründe und die Relevanz des Themas. Im zweiten Kapitel wird das Phänomen der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit näher betrachtet. Es werden die historischen Ursachen und Entwicklungen sowie die Rolle der Konfessionen und der sozialen Strukturen beleuchtet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Hexerei in der frühen Neuzeit und den damit verbundenen Glaubensvorstellungen. Dabei werden sowohl die volkstümlichen als auch die kirchlichen Sichtweisen betrachtet. Das vierte Kapitel analysiert die Zuständigkeit von weltlichen und geistlichen Gerichten im Hexenprozess. Es wird erläutert, wie der Inquisitionsprozess ablief und welche Faktoren Einfluss auf die Verurteilung von Angeklagten hatten. Im fünften Kapitel wird der Hexenprozess am Beispiel der Benigna Schultzen aus dem mecklenburgischen Penzlin dargestellt. Der Fall der B. Schultzen zeigt beispielhaft, wie ein Hexenprozess ablaufen konnte und warum die Landbevölkerung anfälliger für Hexerei beschuldigen war. Zudem werden die sozialen Strukturen innerhalb einer dörflichen Gemeinde beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgungen, Hexerei, Frühe Neuzeit, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Inquisitionsprozess, Teufelspakt, schwarze Magie, volkstümlicher Hexenglaube, kirchliche Hexenlehre, dörfliche Gemeinde, soziale Strukturen, Benigna Schultzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Hexenprozesse in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1242809