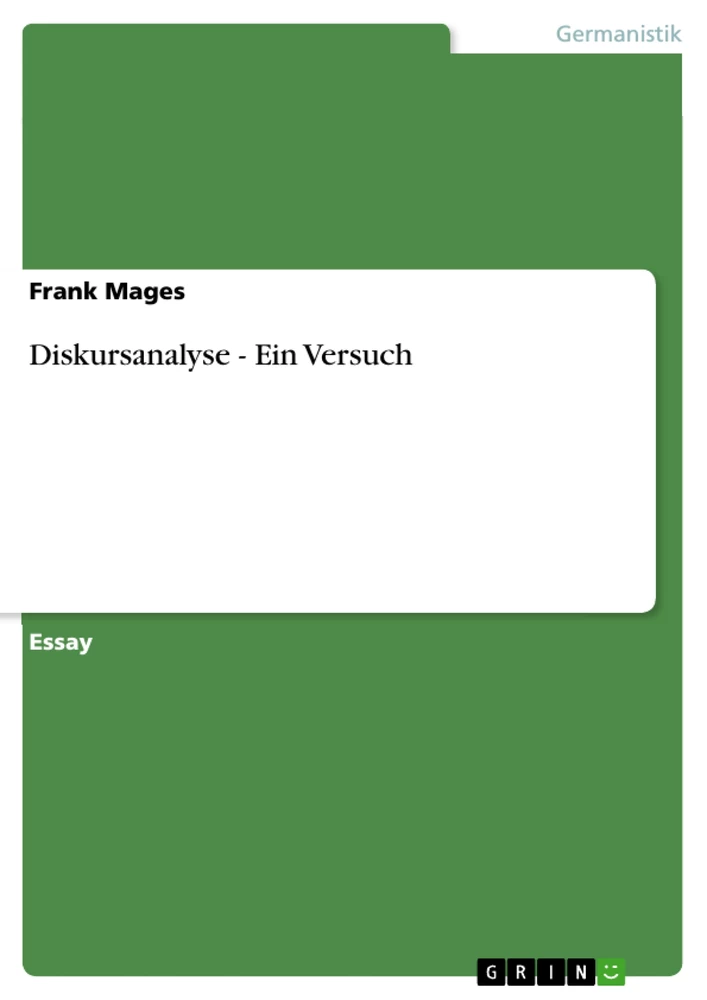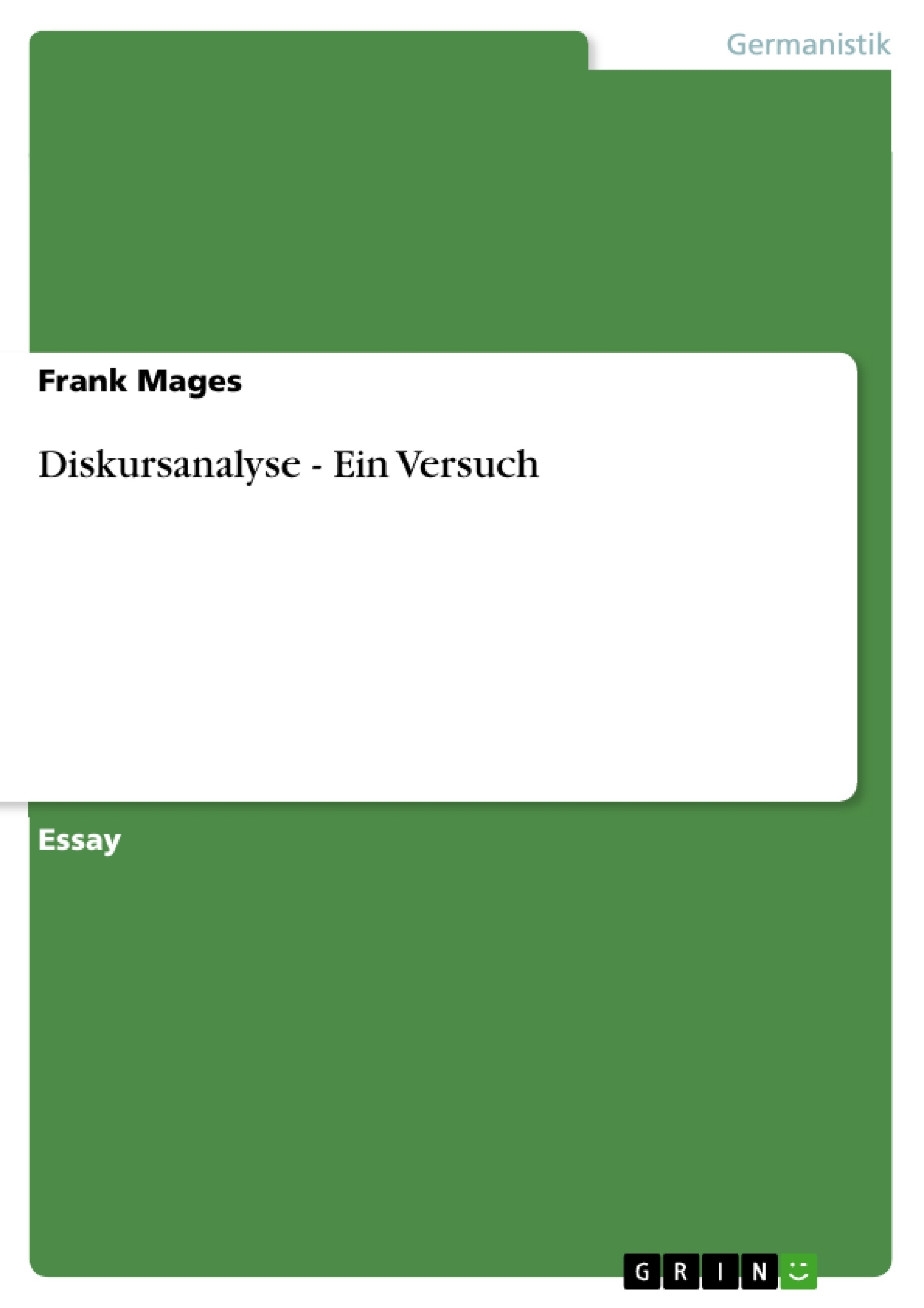Die Diskursanalyse unterscheidet sich von anderen Methoden der Textanalyse, da sie keine Textanalyse im eigentlichen Sinne liefern kann und will. Das liegt daran, dass sie Texte nicht als einzelne Texte wahrnehmen kann, sondern nur als Ansammlung von sprachlichen beziehungsweise schriftlichen Äußerungen. Vielmehr sieht sie es als ihre Aufgabe die historischen Rahmenbedingungen der Textentstehung zu hinterfragen.1 Die Diskursanalyse liefert demnach keine textinterne Interpretation, sondern sie leistet eine Offenlegung der
„außertextlichen Konstitutionsbedingungen der Literatur“2 vor dem Hintergrund von Ausschließungs- und Verknappungsprozeduren und -mechanismen von diskursiver Ordnung und deren Auswirkungen auf die Entstehung von Texten und deren Interpretation.3
1 Vgl. Kittler, Friedrich A.: Diskursanalyse. In: David E. Wellbery (Hrsg.): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht Modellanalysen am Beispiel von Kleists Das Erdbeben in Chili. München 31993. S. 24 – 38. S. 24.
2 Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg 2007. S. 87.
3 Vgl. Ebd. S. 87.
Inhaltsverzeichnis
- Diskursanalyse im Vergleich zu anderen Methoden
- Foucaults Diskursbegriff
- Externe Ausschließungs- und Verknappungsprozeduren
- Verbot und Gegenüberstellung von Vernunft und Wahnsinn
- Beispiel: Theodor Fontanes "Irrungen, Wirrungen"
- Überschneidungen zwischen Verbot und Opposition
- Interne Ausschließungsmechanismen
- Der Kommentar als Ordnungsfunktion
- Der Autor als diskursives Prinzip
- Organisation von Disziplinen
- Die "sprechenden Subjekte"
- Diskursgesellschaften und Doktrinen
- Das Erziehungssystem als Ausschlussmechanismus
- Der Interdiskurs und die Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Diskursanalyse als Methode der Textinterpretation. Ziel ist es, Foucaults Diskursbegriff zu erläutern und die Ausschluss- und Verknappungsprozeduren, die die Textproduktion und -interpretation beeinflussen, zu analysieren.
- Foucaults Diskursbegriff und seine Anwendung auf literarische Texte
- Externe und interne Ausschließungsmechanismen in der Diskursanalyse
- Die Rolle des Autors und des Kommentars in der Diskursanalyse
- Der Einfluss von Disziplinen und Diskursgesellschaften auf die Textinterpretation
- Der Interdiskurs und seine Bedeutung für die Literaturanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Diskursanalyse im Vergleich zu anderen Textanalysemethoden und führt in Foucaults Diskursbegriff ein. Es wird deutlich, dass die Diskursanalyse nicht eine textinterne, sondern eine text-externe Perspektive einnimmt. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Ausschließungs- und Verknappungsprozeduren, die den Diskurs formen. Die externen Prozeduren werden anhand von Beispielen aus Theodor Fontanes "Irrungen, Wirrungen" illustriert, wobei die Tabuisierung des Sexuellen und die Oppositionen von Vernunft und Wahnsinn im Fokus stehen. Die internen Ausschließungsmechanismen umfassen die Rolle des Kommentars, des Autors, der Disziplinen, der "sprechenden Subjekte", sowie den Einfluss von Diskursgesellschaften und des Erziehungssystems. Abschließend wird der Begriff des Interdiskurses und dessen Relevanz für die Literaturanalyse diskutiert.
Schlüsselwörter
Diskursanalyse, Michel Foucault, Textinterpretation, Ausschließungsprozeduren, Verknappungsprozeduren, Interdiskurs, Literaturanalyse, Theodor Fontane, "Irrungen, Wirrungen", Vernunft, Wahnsinn, Kommentar, Autor, Disziplin, Ritual.
- Quote paper
- Frank Mages (Author), 2008, Diskursanalyse - Ein Versuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/124215