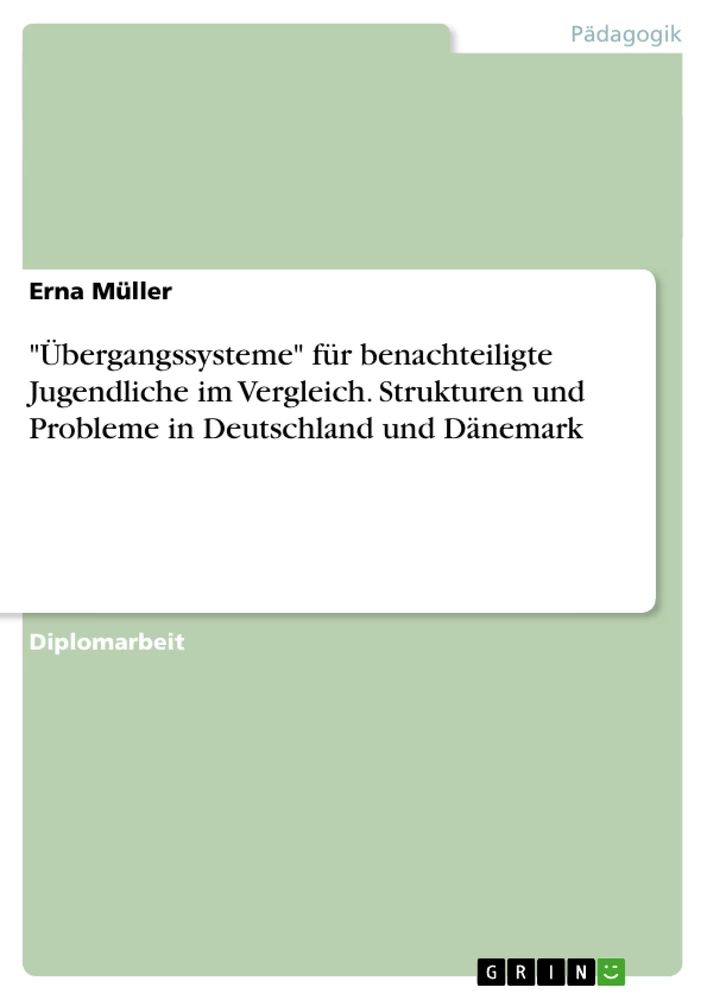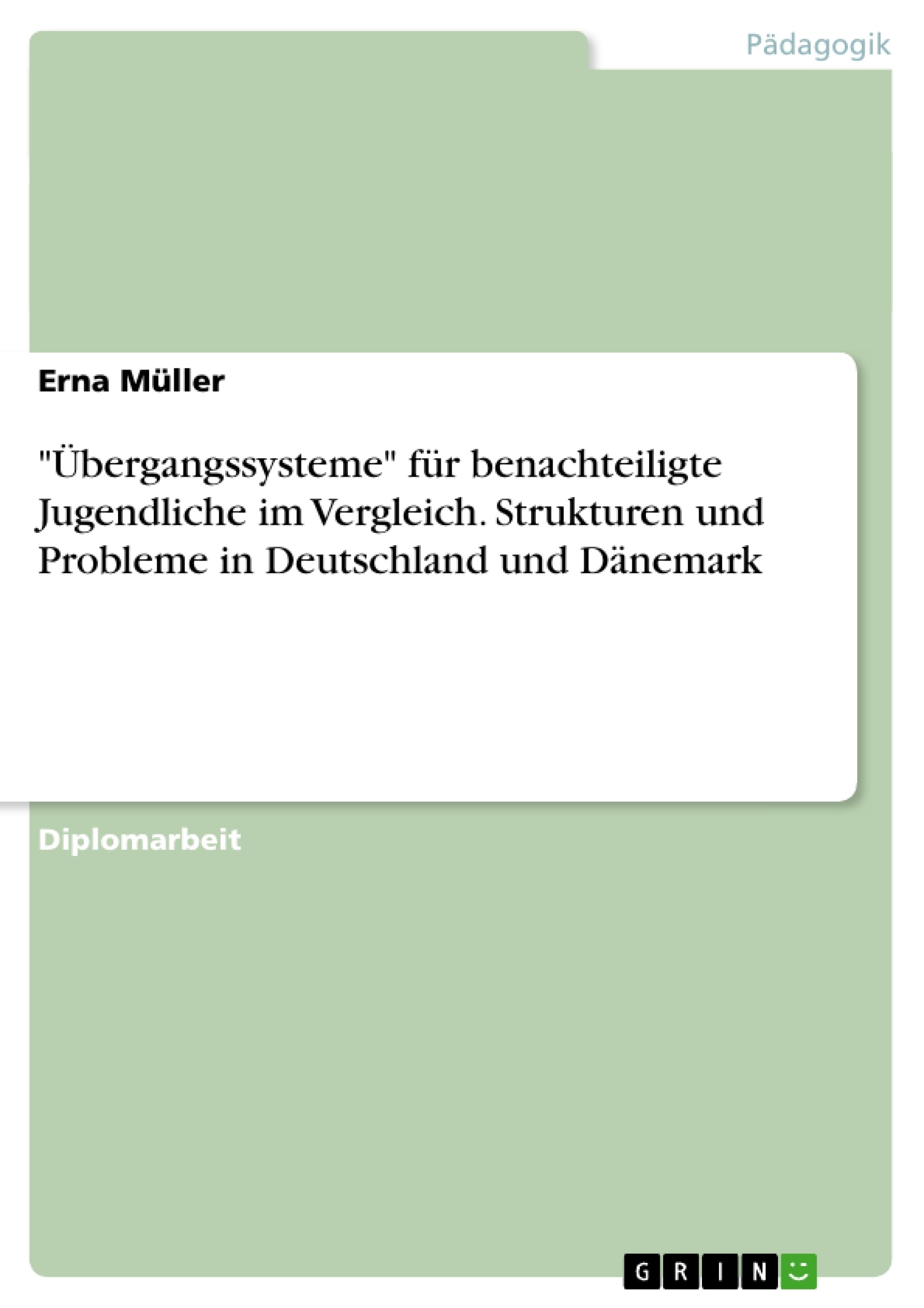Wir leben in einem Zeitalter des ständigen Wandels in der Gesellschaft, der sich vor allem in der Berufs- und Arbeitswelt zeigt. Diese wird verändert durch den wachsenden, durch die Globalisierung verursachten Konkurrenzdruck, die Internationalisierung der Wirtschaft mit ihren Forderungen nach Effizienzsteigerung und Flexibilität und die Zunahme wissensintensiver Dienstleistungstätigkeiten und technologischer Innovationen.
So sehen sich heutzutage Betriebe, Arbeitnehmer und mit ihnen auch Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung ständig neu gestellten Anforderungen ausgesetzt. Diesen werden sie nur mit einem Zuwachs an individueller Bildung, Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Kreativität gewachsen sein. Aber auch Schule, Bildungs-, Übergangs- und Ausbildungssystem werden zunehmend durch diese Fortschritte beeinflusst und müssen auf die aktuellen Herausforderungen ihrer Zeit reagieren und dabei die Zukunft ihrer Klientel mit in den Blick nehmen. Trotz der großen Wertschätzung, die vor allem das "duale System" im deutschen Berufsbildungssystem genießt, ist es dringend notwendig, dort anzusetzen, wo verstärkt Probleme auftreten, nämlich bei der Integration der nachwachsenden Generation in die Berufswelt. Denn der Anspruch aller Bewerber/-innen, eine berufliche Ausbildung aufzunehmen, wird gegenwärtig
nicht mehr erfüllt. Gerade junge Menschen, vor allem benachteiligte Jugendliche, darunter auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in den Startlöchern zu einer beruflichen Karriere stehen, sehen sich diesen kolossalen Hürden gegenüber.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Bildung und Berufsbildung in Deutschland
- Das Berufsbildungssystem in Deutschland
- Das "duale System" als "Königsweg"
- Das "Übergangssystem" in Deutschland – Generation in der Warteschleife
- Definition des "Übergangssystems"
- Struktur des "Übergangssystems"
- Institutionelle Strukturen
- Institutionelle Verteilungsmechanismen und riskante Hürden
- Institutionen im "Übergangssystem"
- Definition des "Benachteiligtenbegriffs"
- Zielgruppen und deren Probleme
- Die Benachteiligtenförderung – Maßnahmen und Probleme im "Übergangssystem"
- Begriff, Ziele und Entwicklung
- Fördermaßnahmen
- Berufsschulische Vorbereitungsmaßnahme (BVJ)
- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)
- Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ/EQ)
- Von der Schule in den Beruf – Die Krise des "Übergangssystems"
- Das dänische Bildungs- und Berufsbildungssystem
- Ein Überblick über das dänische Bildungssystem
- Das dänische Berufsbildungssystem
- Ein kurzer historischer Abriss
- Struktur des Berufsbildungssystems – VET-System
- Klassische Merkmale der beruflichen Erstausbildung
- Zahlen und Fakten
- Akteure der Berufsbildung
- Reformpädagogische Bewegungen in Dänemark – Überblick
- Das "Übergangssystem" in Dänemark
- Struktur des "Übergangssystems"
- Produktionsschulen
- Berufsgrundausbildung (EGU)
- Probleme des "Übergangssystems"
- Struktur des "Übergangssystems"
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten im "Übergangssystem" – Deutschland – Dänemark
- Vergleichskriterien
- Vergleichsbetrachtung
- Akzeptanz des "Übergangssystems"
- Vergütung
- Chancen auf Ausbildung
- Optionen und Wege im "Übergangssystem"
- Ursachen des "Übergangssystems"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Strukturen und Probleme von Übergangssystemen für benachteiligte Jugendliche in Deutschland und Dänemark. Sie untersucht die Herausforderungen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und vergleicht die Ansätze beider Länder zur Integration benachteiligter Jugendlicher.
- Das deutsche und dänische Berufsbildungssystem im Überblick
- Definition und Struktur des Übergangssystems in beiden Ländern
- Fördermaßnahmen für benachteiligte Jugendliche in Deutschland (BVJ, BvB, EQJ/EQ)
- Dänische Fördermaßnahmen (Produktionsschulen, EGU)
- Vergleich der Übergangssysteme und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung der hohen Jugendarbeitslosigkeit und die Notwendigkeit der Untersuchung von Übergangssystemen. Kapitel 2 gibt einen Überblick über das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem, inklusive des dualen Systems. Kapitel 3 definiert das deutsche Übergangssystem, beschreibt seine Strukturen, beteiligten Institutionen und benachteiligte Zielgruppen, sowie Fördermaßnahmen wie BVJ, BvB und EQJ/EQ. Kapitel 4 bietet einen Überblick über das dänische Bildungs- und Berufsbildungssystem, einschließlich seines historischen Verlaufs und der Struktur des VET-Systems. Kapitel 5 beschreibt das dänische Übergangssystem mit seinen Hauptmaßnahmen: Produktionsschulen und EGU. Kapitel 6 vergleicht die Übergangssysteme Deutschlands und Dänemarks anhand verschiedener Kriterien.
Schlüsselwörter
Übergangssystem, benachteiligte Jugendliche, Berufsbildung, duales System, VET-System, Jugendarbeitslosigkeit, Fördermaßnahmen, Produktionsschulen, EGU, BVJ, BvB, EQJ/EQ, Deutschland, Dänemark, Integration.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Hdl. Erna Müller (Autor:in), 2008, "Übergangssysteme" für benachteiligte Jugendliche im Vergleich. Strukturen und Probleme in Deutschland und Dänemark, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/123623