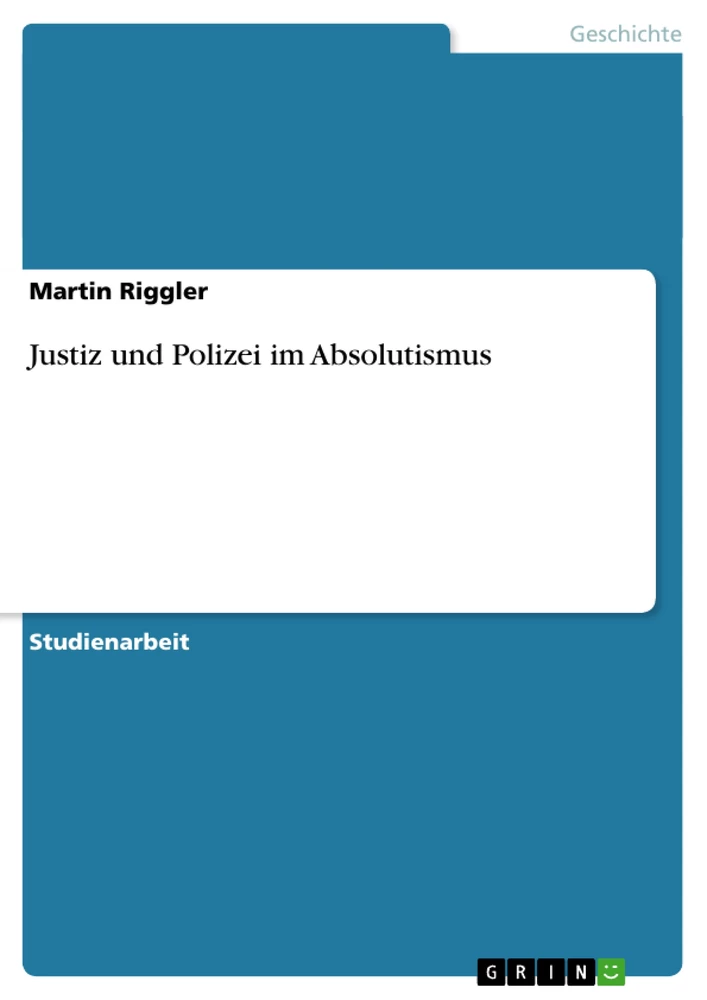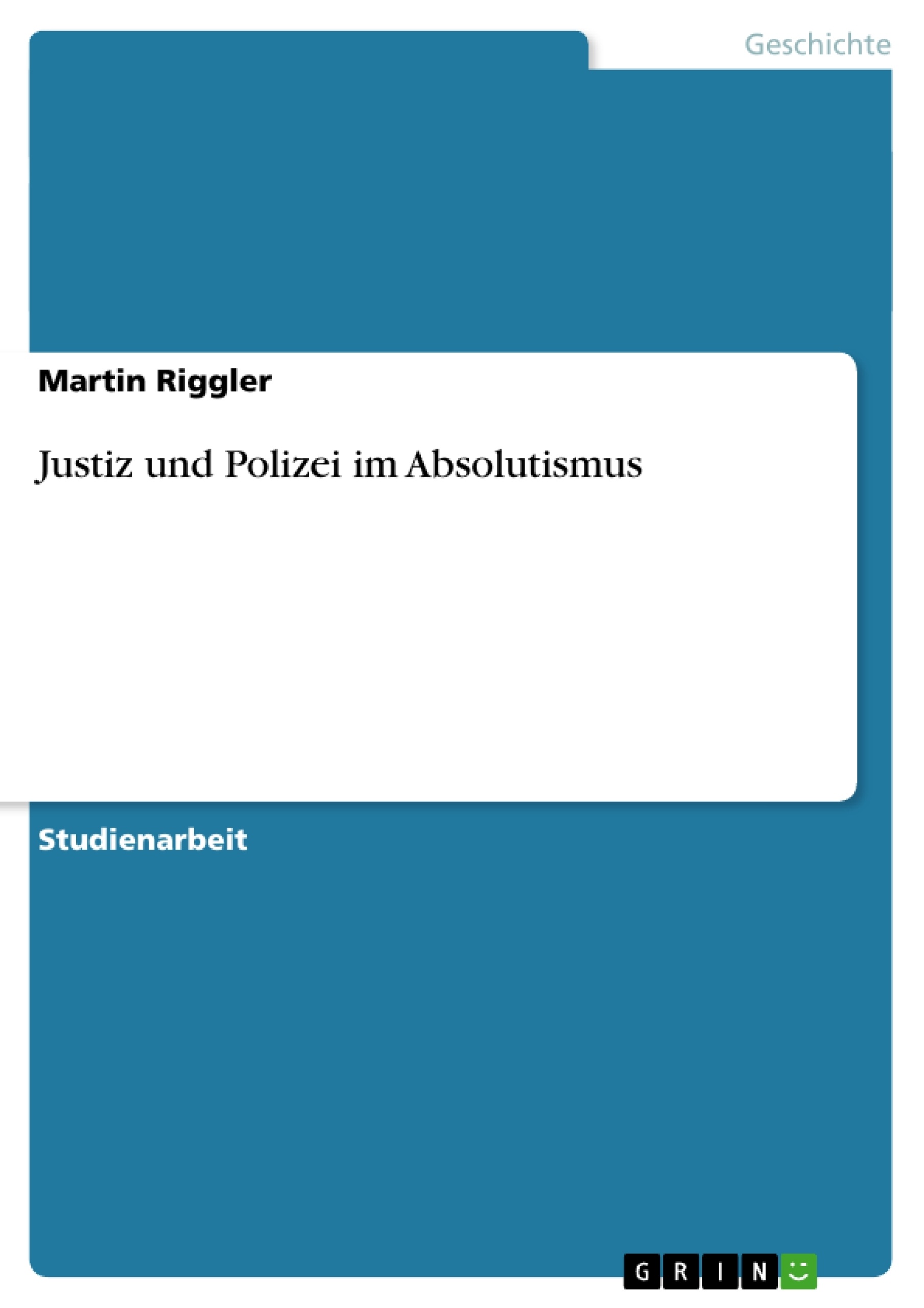Das Werden des modernen Staates lässt sich in den jeweiligen Stadien der neuzeitlichen
europäischen Geschichte anhand verschiedener Staatsformen nachvollziehen; so widmet
sich dieser Text dem Absolutismus, als Zwischenschritt von der Lehnsherrschaft des
ausgehenden Mittelalters zur bürgerlichen Gesellschaft in der konstitutionellen Monarchie.
Dazu zählt die Analyse der innerstaatlichen Strukturen und den sich entwickelnden
Elementen von Exekutive und Judikative, in Form von Polizeiapparat und Gerichtsbarkeit.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Zur Arbeit
1.1 Aufbau und Konzept
1.2 Ziel
II. Hauotteil
1. Der absolutistische Staat
1.1 DieStrukturderHerrschaft
1.2 Weltbild und Gesellschaft unter dem Einfluss des Monarchen
2. Recht und Justiz
2.1 Gestaltungundlnhalte des Rechtsystems
2.2 Der Rechtsgedanke im Absolutismus
2.3 UberdieRechtspraxis
3. Die „ gute Policey"
3.1 Entwicklung des Polizeiwesens
3.2 Aufgabenfelder undKonzipierung im Uberblick
3.3 Fortgang und Entfaltung
III. Schluss
1. Fazit
IV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
1. Zur Arbeit
Das Werden des modernen Staates lasst sich in den jeweiligen Stadien der neuzeitlichen europaischen Geschichte anhand verschiedener Staatsformen nachvollziehen; so widmet sich dieser Text dem Absolutismus, als Zwischenschritt von der Lehnsherrschaft des ausgehenden Mittelalters zur burgerlichen Gesellschaft in der konstitutionellen Monarchie. Dazu zahlt die Analyse der innerstaatlichen Strukturen und den sich entwickelnden Elementen von Exekutive und Judikative, in Form von Polizeiapparat und Gerichtsbarkeit.
1.1 Aufbau und Konzept
Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Anschluss an diesen einleitenden Teil in drei wesentliche Bereiche. Zunachst sollen in Kurze der absolutistische Staat und die hinter ihm stehenden Ideen und Prinzipien im Allgemeinen betrachtet werden, um daraufhin die Institutionen von Justiz und Polizei im Einzelnen zu betrachten und diese im Schwerpunkt abzuhandeln. Die Vorgehensweise ist dabei sowohl beschreibender als auch analytischer Natur, es soll an erster Stelle erlauternd dargestellt und gegebenenfalls im Vergleich zu heutigen Begebenheiten, aber auch im Ruckgriff auf bereits in Antike und Mittelalter formulierten staatstheoretischen Konzepten, beurteilt werden. Das Ende dieser Arbeit findet sich in einem abschlieRenden Fazit.
1.2 Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser die Entwicklung und die Rolle von Justiz und Polizei im absolutistischen Staat, mit Focus auf das 18. Jahrhundert, aufzuzeigen und exemplarisch darzustellen. Dabei ist eine abstrahierende Vorgehensweise angesichts der vorgegebenen Themenstellung nicht vermeidbar, sie soll vielmehr die Obersichtlichkeit des Gesamttextes wahren. Die zum Beleg der hier getatigten Aussagen ausgewahlte Literatur soll Oberzeugungskraft, Vollstandigkeit und Stichhaltigkeit der eigenen Ausfuhrungen unterstutzen und dem Leser dabei die wissenschaftlichen Grundlagen dieses Textes nahebringen.
II. Hauptteil
1. Der absolutistische Staat
Angesichts der schweren Erschutterung von staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung, welche die europaischen Staaten im 16. Jahrhundert uber sich ergehen lassen mussten, verlangten die Umstande des Zeitalters gewissermaRen nach einer machtvollen Instanz in Form einer zentralisierten Gewalt. Die Antwort hierzu hatte, in Form einer theoretischen Begrundung, Niccolo Machiavelli bereits formuliert. In seinem Werk „ll principe" stellte er die Notwendigkeit eines starken Herrschers zum Wohle von dessen Volk heraus. Der ebenfalls bei Machiavelli inhaltlich und nicht explizit verwendete Begriff der Staatsrason - gemeint war die Erfullung des Herrschaftsauftrags um jeden Preis, frei von moralischen Bedenken - lieferte einen gedanklichen Baustein des Fundaments jener Auspragung der Monarchie, welche namensgebend fur eine ganze Epoche werden sollte. Basale Erganzungen lieferten die durch Jean Bodin und Thomas Hobbes gesetzten Prinzipien der Souveranitat und des Gesellschaftvertrages[1]. Auf besagtem geistigen Fundament aufbauend, entwickelte sich durch die sehr realen auReren Umstande bedingt, mit Anbruch des 17. Jahrhundert zunachst in Frankreich und Spanien, bald aber auch in vielen weiteren Teilen Kontinentaleuropas, der Absolutismus.
1.1 Die Struktur der Herrschaft
An der Spitze des Staates stand entsprechend den eben angefuhrten Prinzipien der Souveran als "princeps legibus (ab)solutus", das heiRt, als nicht an die Gesetze gebundener (nicht einmal die eigenen), frei von Kontroll- oder anderen Mitwirkungsinstanzen agierender Herrscher. Der Monarch als Trager der Souveranitat blieb nur noch an die Rechte Gottes und der Natur gebunden. In der Person des Herrschers sammelte sich die gesamte Macht des Staates, nach innen wie nach auRen, ohne die Einwirkung politischer Korperschaften, wie des Hochadels, von Standeversammlungen oder Stadten. Diese wurden gezielt entmachtet, beziehungsweise wurde der Hochadel durch den Aufbau des Hofstaates, im nach diesem Prinzip benannten hofischen Absolutismus, direkt an den Monarchen gebunden. Denn nur
wer dem Herrscher nahe war, konnte vor diesem seine Interessen vertreten und wurde bestenfalls sogar wirtschaftlich oder bei Amtervergaben bevorzugt, was verbunden mit den horrenden Lebenshaltungskosten am Herrschaftshof fur viele Adelige eine Unumganglichkeit bedeutete. Im Gegenzug wurden konigliche Beamte mit der Verwaltung und Fuhrung der Provinzen beauftragt, gestutzt durch die Steuererhebungen (welche auf diese Weise erzielt wurden) und das merkantilistische Wirtschaftsystem, sollten somit die fur den Erhalt des stehenden Heeres, das Mazenatentum und den Lebenswandel des Herrschers, sowie den Unterhalt eben jener Masse an Beamten selbst notwendigen finanziellen Mittel erwachsen[2].
1.2 Weltbild und Gesellschaft unter dem Einfluss des Monarchen
Die standische Gliederung der Gesellschaft blieb im Absolutismus weiterhin bestehen, jedoch erhohte sich im Verlauf der Epoche der Druck des Dritten Standes, was in Frankreich zum radikalen Bruch mit dem hofischen Absolutismus in Form der Franzosischen Revolution fuhrte, wohingegen sich in anderen europaischen Staaten wie PreuRen und Osterreich ein aufgeklarter Absolutismus entwickelte. Dieser besaR zwar hinsichtlich Pressefreiheit und freier offentlicher MeinungsauRerung nach wie eine restriktive Natur, war allerdings im Falle der Herrschaft Friedrichs II. ganz im Sinne der Burger von zahlreichen aufklarerischen Elementen durchdrungen. In ihrer Absicht, die gesellschaftliche Ordnung zu wahren, hielten die Monarchen jedoch nicht allein am mittelalterlichen Weltbild vom gottgewollten und gesegneten Herrscher fest, sie verlieRen sich lieber auf handfeste MaRnahmen, um ihre Machtanspruche im Inneren des Staates zu sichern. Die im Absolutismus begonnene Durchorganisierung des Staatswesens mittels der inneren Verwaltung, erlaubte uber den erwahnten Ausbau des Finanzwesens, den Auf- und Ausbau von Justizapparat und Polizeikraften, bis zu einem MaRe hin, bei welchem man aus heutiger Sicht auf die Strukturen, nicht die Mannstarken, prinzipiell den Begriff „Polizeistaat" verwenden mochte[3]. Dem absolutistischem Herrschaftsprinzip nach stand der Monarch namlich als Rechtsbewahrer an der Spitze von Judikative und Exekutive - und selbiger war, dem gleichen Prinzip folgend, als Rechtsschopfer bekannter Weise nach nicht an die Gesetze gebunden.
2. Recht und Judikative
Die Verbindung von Recht und Judikative im Absolutismus stand, nach dem bislang Angefuhrten, unter anderen Vorzeichen als in der uns bekannten und gewohnten Art des modernen Rechtsstaates. So gilt es nun, die Konstanten und Umstande dieser Zeit mit Blick auf diesen thematischen Komplex aufzugreifen - daher behandeln die folgenden Punkte zunachst die organisatorischen Strukturen der rechtsprechenden Gewalt und befassen sich anschlieRend mit dem absolutistischen Rechtsgedanken, beziehungsweise gerade auch mit dem Wandel dessen, was zu jener Zeit als Recht und Gerechtigkeit angesehen wurde. Zuletzt wird ein tiefergehender Blick in die Praxis der Rechtsprechung jener Periode die vorherige Analyse erganzen.
2.1 Gestaltung und Inhalte des Rechtsystems
Als systemimmanente Notwendigkeit bedurfte es aus Sicht des Monarchen, soviel Herrschaftsgewalt als moglich ausuben zu konnen; eine wirksame Moglichkeit dazu bot die Kontrolle des Rechtssystems. Das Recht war bereits in vorantiker Zeit als dynamisches Mittel der Gemeinschaftsgestaltung durch den Herrscher eingesetzt worden, die entscheidende Problematik in Bezug auf Kontinentaleuropa wurde durch die Vielzahl regionaler Sonderentwicklung aufgeworfen, welche es dem Souveran erschwerte, eine allein auf ihn ausgerichtete und durch ihn kontrollierte Justiz zu etablieren, indem er moglichst viele Gerichtsbezirke in seinem Territorium unter seinen Einfluss brachte[4].
Zunachst existierten auf lokaler Ebene zahlreiche durch den zustandigen Herrschaftstrager, sprich einen Adeligen, ein Mitglied des Klerus oder eine Gemeindeversammlung verwaltete niedere Gerichtsbezirke.
Als hoherrangige Gerichtsbarkeit schlossen sich die landesherrlichen Gerichte an. Hierfand sich im Vergleich zu den vorher genannten Bezirken auch vorrangig juristisch gebildetes Personal. Es wurden mehr Falle von kriminalistischer Natur verhandelt, allerdings auch Appellationen der niederen Gerichte oder direkt eingebrachte Zivilstreitigkeiten. So gesehen war dies mit Blick auf die Struktur des Rechtsystems der Ort, an welchen der absolutistische Monarch die Rechtsprechung anzusiedeln suchte.
Es existierte jedoch parallel eine geistliche Gerichtsbarkeit, welche sich vor allem mit Vergehen wie Ehebruch, Fluchen und Ahnlichem befasste, auch diese war hierarchisch aufgebaut, auf lokaler Ebene mit Synodalgerichten bei den Protestanten, sowie auf territorialer Ebene je nach Konfession mit Offizialatgerichten oder Konsistorien. Es kam jedoch vor, ganz entgegen dem Willen des Monarchen, dass auch weltliche Delikte durch die geistliche Gerichtsbarkeit entschieden wurden. Da es des Weiteren noch zahlreiche Sondergerichte gab, welche sich speziellen Rechtsbereichen widmeten, beispielsweise Marken- und Holzgerichte, welche sich unter anderem mit dem Holzfrevel befassten, oder weiteren historisch gewachsenen Appellationsinstanzen und Immunitaten, wie im Falle von Klerus, Militar und Zunften, waren die Bemuhungen zu Errichtung einer zentralen, herrschaftlichen Justiz nicht immer zwangslaufig erfolgreich[5].
Fur das Reich gilt es daruber hinaus zu erwahnen, dass im Zuge des Absolutismus die groReren Territorien Appellationsprivilegien erhielten und somit von den auf dessen Gebiet eigentlich uber ihnen stehenden Gerichtsbarkeiten von Reichskammergericht und Reichshofrat unabhangig wurden[6].
2.2 Der Rechtsgedanke im Absolutismus
Der Rechtsgedanke im Absolutismus orientierte sich zunachst im Wesentlichen an den naturrechtlichen Normen der Antike sowie denen des spaten Mittelalters[7]. Dies galt insbesondere fur die Gerechtigkeitslehre des Aristoteles und der Stoa, bei ersterem inhaltlich an der Auseinandersetzung mit dem, dass es als naturgemaR zu bestimmen galt und somit die Grundlage des naturlichen Rechts ausmachen sollte. Dies beinhaltet als methodischen Ausgang die Polis, mit dem Menschen als „zoon politikon" und die Fortsetzung mit der Frage nach dem allgemein in der Ordnung und den Gesetzen der Welt Gultigen der stoischen Rechtsphilosophie[8]. Spatere Theoretiker wie Augustinus und Thomas von Aquin entwickelten die bestehenden Grundsatze weiter, zunachst unter Einbezug des christlichen Glaubens, also einer gottlichen Begrundung der gegebenen Ordnung, weiterfuhrend im Gedanken einer in der Natur der Dinge verfugten Prinzip der Vernunft[9]. Der mehr als ein Jahrhundert dauernde Weg von einer Rechtslehre, welche die bestehende Ordnung der Gesellschaft auf theoretischem Niveau rechtfertigte und verteidigte, zu einem neuen Verstandnis von Recht und Gerechtigkeit bedurfte vieler Stationen. Erst allmahlich entwickelte sich ein breites emanzipatorisches Verstandnis und die Neigung zum Rechtspositivismus hin, was bedingt durch die Ordnungsform „Staat", der in dieser Form erstmals in der Neuzeit auftrat, notwendig wurde[10]. Mit dem ursprunglichen Interesse des Monarchen, seine Beamten an Adel und Klerus vorbei als Verwalter in seinem Sinne zu bestimmen, legte dieser allerdings letztlich zum eigenen Nachteil Hand an die Grundsatze des Systems, welches doch seine alleinige Herrschaft stutzen sollte.
Denn auch im Bewusstsein, als Diener des Staates und des Souverans zu handeln, konnte die Richterschaft neue, richtungsweisende Ideen und den Willen des Volkes nicht schlicht verleugnen, selbst wenn dies letzen Endes zu Einschnitten in der absolutistischen Machtausubung fuhrte[11]. Zusammen gesehen mit dem enormen finanziellen Aufwand, den die Aufrechterhaltung dieses Apparates bedeutete, wurde das System zusehends zur Belastung fur sich selbst. In der Folge fand im gleichen MaR, in welchem der Staat versuchte seine Kontrolle auszubauen, eine Starkung des Rechtsschutzbedurfnisses der Burger statt, sowohl hinsichtlich des Eigentums als auch der personlichen Freiheit in Sinne des „habeas corpus"-Prinzips. Die Dynamik der Rechtsverhaltnisse blieb nicht allein auf den Stand von Burger und Obrigkeit zueinander begrenzt, auch auf zwischenstaatlicher Ebene entwickelte sich eine tiefergehende Systematik als Vorlaufer des modernen Volkerrechts[12].
SchlieRlich zeigte sich durch die Aufklarung und die einhergehenden gesellschaftlichen Entwicklungen bedingt, ein weiterer Wandel im Bereich der Rechtswissenschaft.
In PreuRen erfolgte dies beispielsweise mit den Werken Kants ab der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, in Frankreich kam es schlieRlich kurz darauf durch die Revolution 1789 und ihre Folgeereignisse bedingt zu einem kompletten Paradigmenwechsel.
2.3 Uber die Rechtspraxis
Ein bestimmender Faktor fur die Rechtspraxis in der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts und im Laufe des 18. Jahrhunderts war das Justizpersonal. Als Reprasentant der Obrigkeit ohnehin nicht des Volkes Liebling, war es trotz zahlreicher Untertanenprozesse vor dem RKG als bestechlich und gewinnsuchtig gebrandmarkt. Die Welt der Justiz blieb daruber hinaus demjenigen vollkommen verschlossen, der nicht des Lateinischen und der Schrift an sich machtig war, Misstrauen war somit bei einem GroRteil der Bevolkerung verbreitet.
Die Ursachen fur das schlechte Bild des Rechtswesens lagen zum einen darin, dass die Einnahmen der Richterschaft, trotz Sold und zugehorigen Leistungen in Form von Naturalien, nicht zum Lebensunterhalt reichten. Es galt so lange Zeit weder als sittenwidrig noch als pflichtwidrig, wenn durch die Streitparteien „Verehrungen", sprich: Geschenke, uberreicht wurden. Zum anderen waren die Zivilprozesse jener Zeit dem Grundsatz ,,quod non est in actis, non est in mundo" verhaftet, dies bedeutet den Verzicht auf mundliche Verhandlungen und somit die hohe Wertigkeit der eigentlichen Leistung des Advokaten beim Verfassen des bei Gericht einzureichenden Schriftstucks[12].
Urteile wurden in der Regel fur den Einzelfall abgefasst, da eine weitgehende, einheitliche Kodifizierung der Rechtsfolgen straflichen Verhaltens noch nicht erfolgt war, zum anderen weil den Landesherren nicht daran gelegen war, ein durch Rechtsspruche gepragtes Recht in der Art des ,,Common law" entstehen zu lassen. Insgesamt zeichnete sich eine Abkehr von der mittelalterlichen Strafbemessung, mit einer hohen Zahl an Todes- und Leibesstrafen, hin zu aufgeklarten Tendenzen, bei welchen VerhaltnismaRigkeit und Nutzen der Strafe in den Vordergrund standen; auch das Modell der Zuchthauser konnte zunehmend Erfolg verbuchen.
Neben der Ablehnung von Verfahren mit auf Aberglauben beruhenden Tatbestanden, wie Hexenprozessen, kamen mit der Sakularisierung auch zunehmend soziale und ethische Aspekte hinsichtlich der Beschuldigten bei der Urteilsfindung in den Focus der Rechtsprechung, so etwa bei der Problematik der Kindstotung durch junge, unverheiratete Mutter niedrigen sozialen Standes. Dieses damals wie heute bewegende Thema wurde in Goethes „Faust" mit der Gretchentragodie verarbeitet, angeregt durch einen Fall aus FrankfurtimJahre 1772[13].
3. Die „gute Policey"
Nicht nur Justiz und Verwaltung waren im betrachteten Zeitraum ab dem Jahre 1650 zusehens einem Prozess der Ausdifferenzierung unterworfen; zunachst in Konkurrenz zur Justiz, entwickelte sich die Polizei alsTeil der Exekutive zu einer unentbehrlichen Institution des neuzeitlichen Staates. Der Ursprung des Begriffs „Polizei" liegt in der griechischen Sprache, dem Wort „noAn£ia", und beschreibt die Verfassung des stadtischen Gemeinwesens oder den burgerlichen Status. Ober das Lateinische und die Orientierung am Romischen Recht („ius politiae") ging diese Bezeichnung spater auch in den deutschen Sprach- und Rechtsgebrauch uber. Es ist somit zu beachten, dass aus rechtsgeschichtlicher Perspektive, an die jeweilige Auffassung gebunden, viele unterschiedliche Inhalte mit dem Begriff der „Polizei" verbunden sind[14].
Im Folgenden sollen zunachst die Entwicklung des Polizeiapparates, seine Konzipierung und konkreten Aufgaben, sowie als kurzer Blick uber den eigentlich behandelten Zeitrahmen hinaus, dessen fortschreitende Entwicklung dargestellt werden.
3.1 Entwicklung des Polizeiwesens
Die Form von Polizei, welche hier thematisiert wird, war mit der modernen Variante des 20. und 21. Jahrhunderts weitestgehend unvergleichbar. Sie entwickelte sich in einem mit der wachsenden Urbanisierung verbundenen Prozess beginnend mit dem 15. bis hin zum 16. Jahrhundert. Die neue Art des Zusammenlebens im stadtischen Raum verlangte nach einer spezifischen Regelungsform des offentlichen Lebens, der Sinn dieser Institution lag also in der Erfullung eines sozialethischen Auftrags mit dem Ziel einer von Recht und Ordnung erfullten „guten Policey"[15].
Im 17. Jahrhundert vollzog sich eine entscheidende Wende mit dem Aufstieg der absolutistischen Monarchien, es fand zugleich eine Sakularisierung der Politik statt und in diesem neuen Staatsmodell kam es neben der bereits erwahnten Verdichtung der Staatstatigkeit in der Justiz auch zum Bestreben, die staatliche Autoritat mit einem direkt gestaltenden, exekutiven Element auszustatten. Die Steuerung des Gemeinwohls im Sinne der offentlichen Ordnung und des gesellschaftlichen Friedens als Staatsinteresse war nunmehr die offizielle Funktion der Polizei, verbunden mit einem enormen Zuwachs an Kompetenzen und zugleich groRen Definitionsmacht fur denjenigen, welcher die Inhalte dieses neuen Machtapparates festlegen durfte[16].
Der hier verwendete Begriff vom „Gemeinwohl" muss allerdings aus dem absolutistischen Blickwinkel heraus betrachtet werden, das heiRt, es waren hier nicht zwangsweise die Rechte des Individuums an sich, beziehungsweise mehrer solcher zueinander, die es zu schutzen galt, denn das Gemeinwohl war in seiner Bedeutung deckungsgleich mit dem Staatswohl, also wiederum dem Wohl des Monarchen[17]. Zugleich bluhten notwendigerweise, denn das staatliche Engagement wollte auf sich auf gut ausgebildetes Personal stutzen, an den Universitaten im Gebiet des deutschen Reiches, die Kameral- und Polizeiwissenschaften auf[18].
Wie bereits erwahnt, standen die Polizeiangelegenheiten, zumindest in ihren Ursprungen, in Konkurrenz zur judikativen Gewalt. Dies ergab sich aus einem Kompetenzkonflikt. Eine genaue Unterscheidung der Zustandigkeiten hatte zur Zeit des Absolutismus nicht stattgefunden, und gestaltete sich als Widerspruch von bewahrendem und gestalterischem Anspruch beider Gewalten, wobei die Entwicklung letztlich dahinging, dass die Justiz bekannter Weise zu relativer Unabhangigkeit und zur Betonung der individuellen Rechte fand. Zu den mehrfach angefuhrten Eigenschaften des politischen Systems des Absolutismus gehorte demgemaR allerdings auch, im Ruckgriff auf den bereits vormals verwendeten modernen Terminus „Polizeistaat", dass Akte der Exekutive nicht justiziabel waren[19].
3.2 Aufgaben und Konzipierung im Uberblick
Die Aufgaben der Polizei waren zunachst nur unwesentlich gegliedert, ihrer Eigenschaft als Steuerungsinstrument nach wurde sie mit der Kontrolle der Bevolkerungsbewegung, also der Freizugigkeit, der Erhaltung der offentlichen Moral, sowie der offentlichen Ordnung im Allgemeinen beauftragt. Die erstgenannte Form der Oberwachung diente zum einen der Obhut der eigenen „Landeskinder" dahingehend, dass diese wertvolle Steuerzahler und Arbeitskrafte in Kriegszeiten auch Soldaten darstellten, zum anderen war diese Oberwachung der Problematik der Gefahrenabwehr mit Blick auf umherziehende Banden von Raubern und Bettlern geschuldet. Diese beeintrachtigten die offentliche Sicherheit durch Oberfalle auf Reisende oder einsam gelegene Wohnstatten und gefahrdeten so zugleich den uberregionalen Handel als Einkunftsquelle der Obrigkeit, entzogen sich dann der Strafverfolgung durch einen Wechsel der Territorien[20].
Die Erhaltung der offentlichen Moral war ein Nebeneffekt der auch an dieser Stelle einwirkenden Sakularisierung, insofern, als der Einfluss auf gesellschafltiche Normen duch die Kirche ausblieb, wurde von staatlicher Seite mehr noch als bereits im Mittelalter eingegriffen. Hier lag besonders die soziale Komponente im staatlichen Handel aufder Hand: Mit dem Eingreifen der Polizei in das Vergnugungsgeschaft mit Glucksspielerei, dem Zechen in Wirtshausern und der Missachtung der Nachtruhe, sollte eine Diziplinierung jener Bevolkerungsteile erfolgen, welche bereits ohne diese gefahrlichen Versuchungen Nahe am Verlust ihrer finanziellen Sicherheit standen[21]. Bei Ausbleiben solcher Regelungen ware damit sicherlich zusatzlich noch eine Verscharfung der zuerst angefuhrten Sachlage erfolgt. Zudem wurde der soziale Frieden durch MaRnahmen gesichert, welchen den Umgang mit Sexualitat und das Auftreten in der Offentlichkeit beruhrten.
Die zuletzt aufgefuhrte offentliche Ordung im Allgemeinen umfasste ein weites, vom zuvor Aufgefuhrten getrennt zu betrachtendes Feld. So ging es hier zum Beispiel um die Durchsetzung der Marktordnungen und damit verbunden Preis- und Qualitatskontrollen, aber auch um das Regiment im Forst-, Jagd- und Verkehrswesen, insbesondere der damit verbunden Bekampfung der Wilderei[22]. Neben der Bekampfung von Alltagskriminalitat, als aus heutiger Sicht klassischer MaRnahme, lag auch die Aufgabe des Brandschutzes durch vorbeugendende Kontrollen und MaRnahmen in den Handen der Polizei.
lm weiteren Sinne der offentlichen Ordnung, als von Monarchen bestimmt, stand naturlich auch die Umsetzung der Gesetze vor politischem Hintergrund, also beispielsweise die Kontrolle von Versammlungen allzu aufklarerisch gesinnter Burger oder die Zensur der Presse. So stellte die Vielzahl verschiedener Aufgabenbereiche den Ausgang der Polizei aus dem staatlichen Verwaltungsappart einerseits einen Spiegel ihrer Zeit dar, indem sie sich an den jeweils aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen ausrichtete.
Die Aufstellung und Konzipierung der Polizei in Form von Rekrutierung und Ausbildung wiederum orientierten sich ab 1800 am Militar, dem es nicht nur in diesem Sinne nahestand - im Bereich des Staatsinneren wurden schlieRlich beide gleichermaRen als repressives Element durch den Herrscher angewandt[23].
Die jeweiligen territorialen Polizeisysteme wurden im Zuge der absolutistischen Staatsentwicklung zunehmend einer feineren Differenzierung und zentralen Ausrichtung unterzogen. Frankreich nahm auch hier eine Vorreiterrolle ein, bereits im Jahr 1699 richtet es die ,,Surete" ein, die erste kriminalpolizeiliche Organisation der Welt. Dieses seinerseits modernste Polizeisystem war neben anderen Entwicklungen Vorbild auch fur die deutschen Staaten, insbesondere fur PreuRen unter Friedrich dem GroRen[24].
3.3 Fortgang und Entfaltung
lm gleichen MaRe, in dem die staatliche Entwicklung Europas in Richtung der heutigen Verhaltnisse voranschritt, entwickelte sich das Polizeiwesen zu dem, was uns heute aus unserem Alltag bekannt ist. Diese Entwicklung verlief nicht linear, wie die Entgleisung der Rechtsverhaltnisse im Nationalsozialismus zeigte.
Nicht zuletzt konnen manche der nachfolgend erwahnten Errungenschaften durch einen Teil des deutschen Volkes erst seit nicht ganz zwei Jahrzehnten in Anspruch genommen werden. Einen grundlegenden Wandel stellte die Unterwerfung des hoheitlichen Handelns unter die prufenden Instanzen der Justiz dar, aber auch die Anpassung an gesellschaftliche Realitaten durch die Aufgliederung der Polizei in unterschiedliche Bereiche, jeweils mit einem an die verschiedenen Aufgaben gebundenen Rahmen von Zustandigkeiten und Handlungskompetenzen.
Trotz dieser Anpassungen dient die Polizei nach wie vor als Steuerungsmittel der Gesellschaft durch die Staatsfuhrung, vor allem mit den Mitteln des Zwangs. Allerdings geschieht dies nunmehr dank den Errungenschaften von Republik und Gewaltenteilung unter der Legitimation und der Kontrolle durch das Volk.
III. Schluss
1. Fazit
Justiz und Polizeiwesen haben im betrachteten Zeitraum, von der Mitte des 17. bis zum Ausklingen des 18. Jahrhunderts, jener Hochzeit der absolutistischen Staaten, einen grundlegenden Wandel erfahren - wie sich zeigt emanzipierten sich beide in ihrer Rolle als Staatsgewalten, die Justiz in ihrem Anspruch auf Unabhangigkeit, die Polizei in ihrer Abgrenzung zu der ubrigen Verwaltung und der rechtsprechenden Gewalt.
Beide geben einen exemplarischen Einblick in die Entstehung moderner Staatlichkeit anhand von dessen Zentralisierungs- und Institutionalisierungsanspruch.
Die Auseinandersetzung mit der Thematik erbrachte einen tiefergehenden Einblick in das Werden des modernen Staates anhand zweier spezifischer Bereiche und hatte sich durchaus auch weiter fortsetzen lassen, jedoch nicht ohne den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen. Interessant waren insbesondere die Einblicke in das Wirken von Judikative und Exekutive anhand der in der Literatur genannten Fallbeispielen, welche wiederzugeben leider mit der notwendigen Pragnanz des Textes nicht in Einklang zu bringen gewesen ware.
Als problematisch erwies sich zudem das zu weit gesteckte Feld, welches die Formulierung des Themas vorgab.
Eine aktuelle Forschungsdebatte daruber hinaus in dieser Arbeit aufzugreifen, war leider ebenso wenig moglich. Dies hatte insofern vom eigentlichen Thema weggefuhrt, da diese zuletzt die inhaltliche Verwendung der Bezeichnung „Absolutismus" an sich behandelte. [27324 Zeichen (mit Leerzeichen)]
IV. Literaturverzeichnis
Asch, Ronald G. und Duchhardt, Heinz (Hrsg.): Der Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchistischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Koln, 1996.
Birtsch, Gunter (Hrsg.): Grund- und Freiheitsrechte von der standischen zur spatburgerlichen Gesellschaft, Gottingen, 1987.
Bockenforde, Ernst-Wolfgang: Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie, Stuttgart, 2002.
Bockenforde, Ernst-Wolfgang: Vom Wandel des Menschenbildes im Recht, Munster, 2001.
Duchhardt, Heinz: Europa am Vorabend der Moderne 1650-1800, Stuttgart, 2003.
Gall, Lothar (Hrsg.), Enzyklopadie deutscherGeschichte, Band 46, Munchen, 1998.
Harnischmacher, Robert und Semerak, Arved: Deutsche Polizeigeschichte - Eine allgemeine Einfuhrung in die Grundlagen, Stuttgart, 1986.
Hinrichs, Ernst: Fursten und Machte - Zum Problem des europaischen Absolutismus, Gottingen, 2000.
Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), Opladen, 1989.
Kissling, Peter: „Gute Policey" im Berchtesgadener Land: Rechtsentwicklung und Verwaltung zwischen Landschaft und Obrigkeit 1377 bis 1803, Frankfurt am Main, 1999.
Schmelz, Christoph: Die Entwicklung des Rechtswegestaates am Beispiel der Trennung von Justiz und Policey im 18. Jahrhundert im Spiegel der Rechtsprechung des Reichskammergerichtes und des Wismarer Tribunals, Berlin, 2004.
Stolleis, Michael (Hrsg.): Policey im Europa derfruhen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1996.
[...]
[1] Hinrichs, Ernst: Fursten und Machte - Zum Problem des europaischen Absolutismus, Gottingen, 2000, S.23 f.
[2] Gommel, Rainer: Die Entwicklung der Wirtschaft im Zeitalter des Merkantilismus 1620-1800, in: Gall, Lothar (Hrsg.), Enzyklopadie deutscher Geschichte, Band 46, Munchen, 1998, S.43 f.
[3] Harnischmacher, Robert und Semerak, Arved: Deutsche Polizeigeschichte - Eine allgemeine Einfuhrung in die Grundlagen, Stuttgart, 1986, S.24.
[4] Schmelz, Christoph: Die Entwicklung des Rechtswegestaates am Beispiel der Trennung von Justiz und Policey im 18. Jahrhundert im Spiegel der Rechtsprechung des Reichskammergerichtes und des Wismarer Tribunals, Berlin, 2004, S.85.
[5] Asch, Ronald G. und Duchhardt, Heinz: Die Geburt des Absolutismus im 17. Jahrhundert - Epochenwende der europaischen Geschichte oder optische Tauschung, in: Asch, Ronald G. und Duchhardt, Heinz (Hrsg.): Der Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchistischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 15501700), Koln, 1996, S.18 f.
[6] Wolfgang, Schmale: Das heilige romische Reich und die Herrschaft des Rechts. Ein ProblemaufriR, in: Ebd.: S.240.
[7] Bockenforde, Ernst-Wolfgang: Vom Wandel des Menschenbildes im Recht, Munster, 2001, S.12 f.
[8] Bockenforde, Ernst-Wolfgang: Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie, Stuttgart, 2002, S.105 f.
[9] Ebd.:S.194 f.
[10] Ebd.:S.5
[11] Duchhardt, Heinz: Europa am Vorabend der Moderne 1650-1800, Stuttgart, 2003, S.59. Ebd.:S.77.
[12] Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), Opladen, 1989, S.46.
[13] Ebd.:S.93.
[14] Schmelz, Christoph: Die Entwicklung des Rechtswegestaates am Beispiel der Trennung von Justiz und Policey im 18. Jahrhundert im Spiegel der Rechtsprechung des Reichskammergerichtes und des Wismarer Tribunals, Berlin, 2004, S.34.
[15] Matthias, Weber: Standische Disziplinierungsbestrebungen durch Polizeiordnungen und Mechanismen ihrer Durchsetzung; Regionalstudie Schlesien, in: Stolleis, Michael (Hrsg.): Policey im Europa der fruhen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1996, S.333.
[16] Ebd.:S.36 f.
[17] Winfried, Schulze: Standische Gesellschaft und Individualrechte, in: Birtsch, Gunter (Hrsg.): Grund- und Freiheitsrechte von der standischen zur spatburgerlichen Gesellschaft, Gottingen, 1987, S.170 f.
[18] Duchhardt, Heinz: Europa am Vorabend der Moderne 1650-1800, Stuttgart, 2003, S.58.
[19] Harnischmacher, Robert und Semerak, Arved: Deutsche Polizeigeschichte - Eine allgemeine Einfuhrung in die Grundlagen, Stuttgart, 1986, S.25 f.
[20] Kissling, Peter: „Gute Policey" im Berchtesgadener Land: Rechtsentwicklung und Verwaltung zwischen Landschaft und Obrigkeit 1377 bis 1803, Frankfurt am Main, 1999, S.200 f.
[21] Ebd.:S.217ff.
[22] Stolleis, Michael (Hrsg.): Policey im Europa derfruhen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1996, S.383.
[23] Harnischmacher, Robert und Semerak, Arved: Deutsche Polizeigeschichte - Eine allgemeine Einfuhrung in die Grundlagen, Stuttgart, 1986, S.29.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über den Absolutismus?
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und Rolle von Justiz und Polizei im absolutistischen Staat, insbesondere im 18. Jahrhundert.
Welche Bereiche werden in dieser Arbeit über den Absolutismus behandelt?
Die Arbeit behandelt den absolutistischen Staat im Allgemeinen, die Institutionen von Justiz und Polizei im Einzelnen, sowie deren Entwicklung und Funktion innerhalb des Staates.
Was sind die Hauptziele dieser Arbeit über den Absolutismus?
Das Hauptziel ist es, die Entwicklung von Justiz und Polizei im absolutistischen Staat aufzuzeigen und exemplarisch darzustellen, unter Berücksichtigung der innerstaatlichen Strukturen und der Entwicklung von Exekutive und Judikative.
Welche theoretischen Grundlagen werden in Bezug auf den absolutistischen Staat diskutiert?
Es werden die Ideen von Niccolo Machiavelli (Staatsräson), Jean Bodin (Souveränität) und Thomas Hobbes (Gesellschaftsvertrag) als wichtige Bausteine für das Verständnis des Absolutismus betrachtet.
Wie war die Struktur der Herrschaft im absolutistischen Staat organisiert?
An der Spitze stand der Monarch als Souverän, der nicht an Gesetze gebunden war und die gesamte Macht des Staates in sich vereinte. Politische Körperschaften wie der Hochadel wurden entmachtet oder durch den Hofstaat an den Monarchen gebunden.
Welche Rolle spielte das Rechtssystem im Absolutismus?
Das Rechtssystem stand unter der Kontrolle des Monarchen. Es gab regionale Sonderentwicklungen, die es dem Souverän erschwerten, eine allein auf ihn ausgerichtete Justiz zu etablieren. Es existierten verschiedene Gerichtsbarkeiten (lokale, landesherrliche, geistliche), die nicht immer einheitlich waren.
Wie entwickelte sich das Polizeiwesen im Absolutismus?
Die Polizei entwickelte sich in Konkurrenz zur Justiz und wurde zu einer unentbehrlichen Institution des neuzeitlichen Staates. Sie war Teil der Exekutive und diente der Steuerung des Gemeinwohls im Sinne der öffentlichen Ordnung und des gesellschaftlichen Friedens, wobei das Gemeinwohl oft mit dem Staatswohl des Monarchen gleichgesetzt wurde.
Welche Aufgaben hatte die Polizei im absolutistischen Staat?
Die Aufgaben umfassten die Kontrolle der Bevölkerungsbewegung, die Erhaltung der öffentlichen Moral und Ordnung, die Durchsetzung der Marktordnungen, Brandschutz und die Bekämpfung von Alltagskriminalität. Auch die Umsetzung politisch motivierter Gesetze (z.B. Zensur) gehörte dazu.
Welche Veränderungen gab es im Rechtsgedanken während des Absolutismus?
Der Rechtsgedanke orientierte sich zunächst an naturrechtlichen Normen der Antike und des Mittelalters, entwickelte sich aber im Laufe der Zeit hin zu einem Rechtspositivismus. Es entstand ein größeres Bedürfnis nach Rechtsschutz und persönlichen Freiheiten.
Wie war die Rechtspraxis im Absolutismus gestaltet?
Die Rechtspraxis war oft von Bestechlichkeit und Gewinnsucht geprägt. Zivilprozesse basierten stark auf schriftlichen Dokumenten. Es gab eine Tendenz zur Abkehr von mittelalterlichen Strafen hin zu verhältnismäßigeren Strafen, die auch den Nutzen berücksichtigen sollten.
Wie beeinflusste die Aufklärung die Rechtswissenschaft und die Rechtsprechung?
Die Aufklärung führte zu einem Wandel im Bereich der Rechtswissenschaft, der in Preußen durch die Werke Kants und in Frankreich durch die Revolution 1789 und ihre Folgen beschleunigt wurde. Es kam zu einem Paradigmenwechsel in Bezug auf das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit.
Welche Rolle spielte die Kameralwissenschaft im Absolutismus?
An den Universitäten blühten die Kameral- und Polizeiwissenschaften auf, um das staatliche Engagement zu unterstützen und gut ausgebildetes Personal bereitzustellen.
- Quote paper
- Martin Riggler (Author), 2008, Justiz und Polizei im Absolutismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/123054